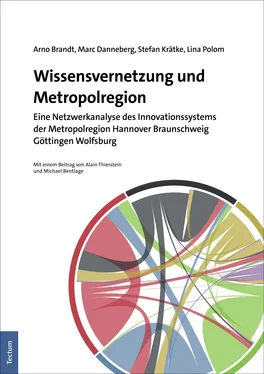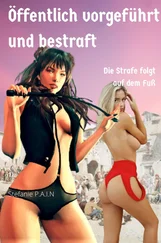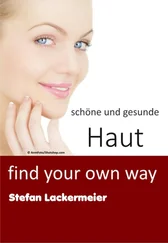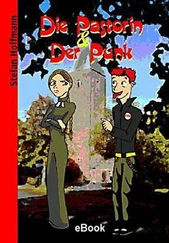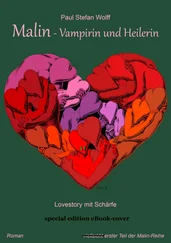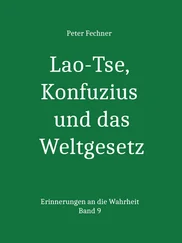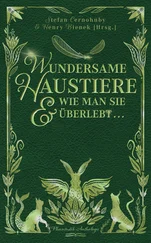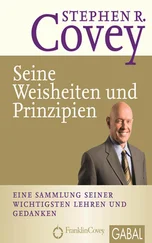Dank gilt auch Professor Dr. Alain Thierstein und Dr. Michael Bentlage, die auf der Basis der in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg erhobenen Daten einen eigenständigen Beitrag zur Netzwerkanalyse verfasst haben.
Dr. Arno Brandt
1 Einleitung
1.1 Der Übergang zur wissensbasierten Ökonomie
Die entwickelten Industrieländer sind heute durch eine zunehmend wissensintensivere Wirtschaft geprägt, die mittlerweile alle Sektoren der Wirtschaft erfasst. Dieser Strukturwandel wird durch die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft zusätzlich befördert (Brandt 2019, Brandt 2015). Auf Basis der hoch entwickelten Informations- und Kommunikationstechnologien ist eine wissensbasierte Ökonomie entstanden, die vor allem bei den wissensintensiven Dienstleistungen und Industrien ein dynamisches Beschäftigungswachstum aufweist. Produkt- und Technologielebenszyklen werden zunehmend kürzer und wirtschaftliches Wachstum beruht maßgeblich auf der Generierung von neuem Wissen und Innovationen. Die wissensbasierte Ökonomie ist jedoch kein homogener Wirtschaftssektor. Vielmehr beschreibt sie ein breites Spektrum unterschiedlicher Aktivitäten, deren gemeinsame Merkmale intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und eine wachsende Bedeutung von Informationsgütern oder -dienstleistungen in den jeweiligen Wertschöpfungsketten sind (vgl. Strambach 2011; Kujath, Zillmer 2010; Kujath 2005) 1.
Die wissensbasierte Ökonomie ist eine „people-driven-economy“, die auf die Gewinnung hoch qualifizierter Arbeitskräfte angewiesen ist. Wissen und Kreativität sind ihre wichtigsten Motoren und werden durch Investitionen in Humankapital sowie durch Lernen bestimmt. Aus- und Weiterbildungsprozessen kommt im Zuge eines „lebenslangen Lernens“ eine wachsende Bedeutung zu (Stiglitz 2015). Steigende Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie die öffentliche und private Bildung gelten dabei als Investitionen in Wissen und signalisieren den Bedeutungsgewinn der Wissensarbeit (Infobox).
Mit der zunehmenden Rolle des Wissens als wichtigste Ressource einer innovationsgetriebenen Wirtschaftsentwicklung gewinnt für die Unternehmen auch die Zusammenarbeit in formellen und informellen Netzwerken bzw. Forschungskooperationen an Bedeutung. Netzwerke bzw. Kooperationen repräsentieren spezifische Organisationsformen zwischen Markt und Hierarchie, die unter bestimmten Voraussetzungen in besonderer Weise geeignet sind, den Wissensaustausch zu befördern. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Preismechanismus (Markt) und der Anweisungsmechanismus (Hierarchie) nicht funktionieren bzw. zu suboptimalen Ergebnissen führen, so dass sich die Kooperation als institutionelle Zwischenform als überlegen erweist. Diesen Zusammenhang begründet Walter Powells als einer der Begründer der ökonomischen Netzwerktheorie mit spezifischen Vorteilen der Kooperation bzw. Netzwerkaktivität als eigenständigem Koordinierungsmechanismus zwischen Markt und Hierarchie: „In netzwerkartigen Formen der Ressourcenallokation finden Transaktionen weder durch diskrete Tauschprozesse noch durch administrative Anweisungen statt, sondern innerhalb von Netzwerken von Individuen, die in wechselseitige, sich gegenseitig bevorzugende und unterstützende Handlungszusammenhänge involviert sind. Netzwerke können sehr komplex sein: sie beinhalten weder die expliziten Kriterien des Marktes noch den üblichen Paternalismus von Hierarchien. Eine grundlegende Annahme bei Netzwerkbeziehungen ist, dass einzelne Parteien von den Ressourcen der anderen abhängig sind, und dass durch die Kombination von Ressourcen Vorteile erzielt werden können“ (Powell 1996, S. 224). Die Kooperation bzw. Netzwerkaktivität sind vor allem deshalb als Koordinationsmechanismus für den Austausch von Wissen prädestiniert, weil Wissen ein immaterielles Gut ist und sich zu weiten Teilen dem Preis- und Anweisungsmechanismus entzieht. Stattdessen ist der Transfer von Wissen in besonderer Weise auf Vertrauen, Reziprozität und Reputation gegründet, die für die Funktionsweise von Kooperations- bzw. Netzwerkbeziehungen von zentraler Bedeutung sind (Strambach 2011, Sukowski 2002; Genosko 1999).
INFOBOX
Wissensintensive Wirtschaft in Deutschland
Der Anteil der Beschäftigten in Deutschland, die über einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss verfügen, ist zwischen 2009 und 2016 von 12,6% auf 16,8% angewachsen. Positiv verlief auch die Entwicklung beim FuE-Personal. Gegenüber 2008 ist in Deutschland die Zahl der Forscher und Entwickler bis 2016 um knapp 22 Prozent auf fast 405.000 gewachsen. Während die Anzahl der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland insgesamt zwischen 2009 und 2015 um 4,7 Prozent gestiegen ist, erhöhte sich die Anzahl des in Forschung und Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe beschäftigten Personals im gleichen Zeitraum um 17,9 Prozent. Auch das Feld der wissensintensiven Wirtschaftszweige verzeichnete in den vergangenen Jahren ein messbares Wachstum. Von 2009 bis 2016 ist die Beschäftigung der Wissensintensiven Dienstleistungen und des wissensintensiven Verarbeitenden Gewerbes um 14,5% gewachsen und damit in etwa so stark wie die Beschäftigungsentwicklung insgesamt. Darunter haben sich die Wissensintensiven Dienstleistungen (+18,1 %) deutlich positiver entwickelt als das Wissensintensive Verarbeitende Gewerbe (+8,1%). Der Anteil dieser Wirtschaftszweige an der Beschäftigung insgesamt beträgt 2016 knapp ein Drittel (31,1%).
Quelle: IAB, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Der Wissensaustausch wird nicht zuletzt durch die fortschreitende Digitalisierung erleichtert. Digitale Netze können nur kodifiziertes Wissen (explizites Wissen) übertragen, d.h. Wissen, das in verbaler oder schriftlicher Form (auch Grafiken, Blaupausen, Algorithmen etc.) festgehalten wird und personenunabhängig transferiert werden kann. Die Digitalisierung führt aber auch zur Aufwertung der nicht kodifizierbaren und damit technisch nicht substituierbaren Wissensformen. Kodifiziertes Wissen setzt einen Fundus von kontextuellem Hintergrund- und praktischem Umsetzungswissen voraus, das auch als implizites Wissen oder „Tacit knowledge“ bezeichnet wird (Polanyi 1985).
Unter implizitem Wissen „wird das kontext- und situationsabhängige, schwer zu kommunizierende Hintergrundwissen verstanden. Es umfasst Erfahrungen, Routinen und latente Praktiken und ist in Personen und Organisationen gebunden“ (Maier, Tödtling, Trippl 2006, S. 112). Tacit knowledge ist daher definitionsgemäß nicht kodifizierbar und kann nicht schriftlich niedergelegt werden (Audretsch, Feldman 2003, S. 6; Hellbrecht 2004, S. 424; Genosko 1999, S. 38). Folglich ist das implizite Wissen schwer kommunizierbar, formalisierbar und teilbar, so dass es weitgehend nur „face to face“ weitergegeben werden kann (Brökel 2016, Brandt 2014; Strambach 2011; Franz 2002). Dies erschwert die Diffusion des impliziten Wissens über größere Distanzen hinaus (Stiglitz 1999, S. 4ff.). Räumliche Nähe ist eine wesentliche Voraussetzung für die Vermittlung von implizitem Wissen. Auch im Zeitalter moderner IuK-Technologien besteht damit eine fortdauernde Relevanz von Face-to-face- Kommunikation und räumlicher Nähe 2. Dies bedeutet auch, dass den regionsspezifischen Wissensbeständen trotz einer globalisierten Informationsflut auch weiterhin eine zentrale Bedeutung für die Regionalentwicklung zukommt (vgl. Siebel 2015; Brandt 2014; Krätke 2002; Genosko 1999).
Eine Erweiterung hat das Konzept der räumlichen Nähe durch das Konzept der relationalen Nähe gefunden, wobei Nähe dabei umfassend, d.h. neben räumlicher Nähe auch als kognitive, gesellschaftliche, organisatorische und institutionelle Nähe betrachtet wird (Thierstein, Wiese 2011, Barthelt, Glückler 2012; Lüthi et al. 2013, Boschma 2005). Unter „relationaler Nähe“ werden insbesondere die Ähnlichkeiten unterschiedlicher Regionen in Hinblick auf ihre gemeinsam geteilten Verhaltensnormen, kulturellen Gepflogenheiten, ihr gegenseitiges Vertrauen, ihr Zugehörigkeitsgefühl und ihre Kooperationsressourcen verstanden (Belderbos et al. 2012). Relationale Nähe spielt für den überregionalen Transfer von Wissensspillovern eine bedeutende Rolle, steht aber nicht in einem Gegensatz zur räumlichen Nähe. Wissen wird „erst im Austausch zwischen Menschen geschaffen, welche sich sowohl räumlich als auch in Netzwerken nahe und vertraut sind und zu diesem Austausch auch bereit sowie in der Lage sind: Räumliche und relationale Nähe spielen sich je nach Technologie- und Handlungsfeld gegenseitig und komplementär in die Hände“ (Thierstein, Wiese 2011, S. 129).
Читать дальше