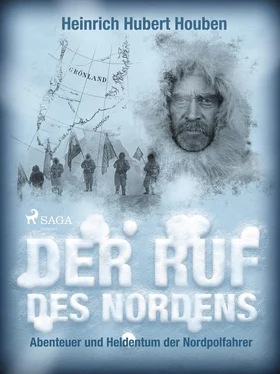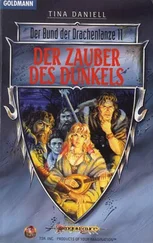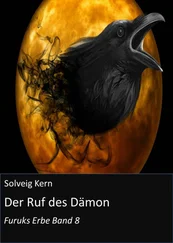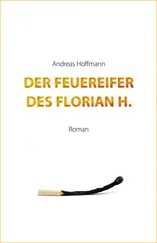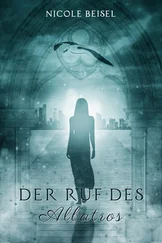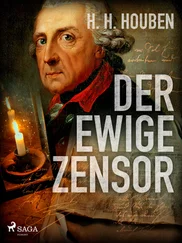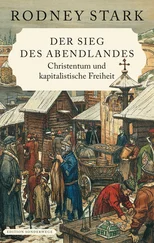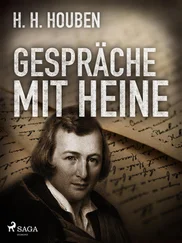Bläulich weiß und glitzernd dehnen sich unendliche Gefilde; nirgends organisches Leben, nur die Stürme heulen durch die dunkle, kalte Halbjahrsnacht. Dicke Nebel oder das Gewirr eisiger Schneeflocken erfüllen die Luft. Manchmal in klaren Nächten strahlt das überirdische Wunder des Nordlichts auf: weißgrünlich glitzernde Lichtschlangen zucken von Osten und Westen zum Zenit empor und verbinden sich zu einer hehren Lichtkrone, die lange Bänder phantastisch über das schwarze Himmelsgewölbe flattern läßt. Nur wenige Stunden dauert das Schauspiel; langsam verrinnen die Lichtquellen wieder und verlieren sich im dunkeln All. Dann wandeln wieder die Gestirne über der schwarzen Nacht; der Mond gleitet seine leuchtende Bahn von Osten nach Westen und wieder nach Osten, am Firmament kreisend, ohne unter dem Horizont zu verschwinden. Gespenstisch gießt er sein Silberlicht über Schneefelder und Eisberge. Ist aber der Himmel bedeckt, sind vom Nebel alle Gestirne ausgelöscht, dann begräbt grausige Finsternis, wie ein ungeheures Gewölbe, die erstarrte Welt. Dann heulen die rasenden Stürme — das berstende Eis donnert und kracht — und das gebrechliche Schifflein der Polfahrer knarrt und krümmt sich stöhnend zwischen den andrängenden Eisschollen. Wie sehnt man sich da nach der Sonne!
Und endlich wird es wieder Tag — je weiter vom Pol entfernt, desto früher im Jahr. Anfang Februar lugt auf Spitzbergen die Sonne um Mittag über den Rand des Horizonts. Bald steigt sie sieghaft empor, bis sie die Nacht völlig verdrängt, und auf ein halbes Jahr ist nun sie die unumschränkte Herrscherin. Sie glitzert und funkelt in Milliarden Eiskristallen. Um Mitternacht läuft ihre glührote Kugel am Horizont entlang, ohne zu verschwinden. Der Glanz des Gestirns und die bläuliche Weiße der Eis- und Schneegefilde sind fast unerträglich für das Menschenauge, und es sehnt sich wieder nach der Nacht, wie ehemals nach dem fernen Tag.
Grüne Flächen, wo das Auge ausruhen könnte, gibt es nur wenige auf der arktischen Inselwelt. Meist starrt auch hier alles von Eis und Schnee; steile, wildgezackte Klüfte und Bergkegel erheben sich hier und da; nur selten ein geschütztes Tal, dessen Sohle sich mit grünem Moos und saftigem Gras bedeckt, in dem sogar eine bescheidene Blumenflora um ihr Eintagsdasein ringt.
Dennoch ist die Tierwelt der Arktis sehr mannigfaltig. Die größten Säugetiere der Erde scheinen sich aus vorsintflutlicher Zeit dort hinübergerettet zu haben. In den sich plötzlich bildenden Spalten des Meereises tummelt sich der riesige Wal; der kleinere Finnwal kommt bis an Norwegens Küsten herunter. Der Narwal mit seinem mächtigen Stoßzahn jagt in der Meerestiefe. Das häßliche Walroß mit seinem bärtigen Gesicht, aus dem zwei gekrümmte, gelbliche Hauer nach unten ragen, sonnt sich auf dem Packeis und schnauft vor Behagen; es findet sich meist im Kreis einer großen Familie. Auf dem Neueis sammeln sich die Seehunde mit ihren Jungen, rekeln sich in der Sonne und kratzen sich mit der tölpischen Finne, der Vorderflosse, die Seiten. An ihre unbehilflichen Jungen pirscht sich der Eisbär heran, der König der Arktis. In ungeheuren Schwärmen ziehen Eidergänse, Möwen und Lummen zu den einsamsten Klippen der Inseln, um dort zu brüten, und der Polarfuchs holt sich die frischesten Eier aus den für kurze Pause verlassenen Nestern.
Diese eigenartige, grausame Schönheit der arktischen Natur hat ihre dämonische Anziehungskraft seit Jahrhunderten auf die Menschheit ausgeübt, und der trotzige Widerstand der Naturkraft hat den Ehrgeiz tollkühner Abenteurer und wissensdurstiger Forscher fast bis zur Leidenschaft erhitzt. Wieviel Menschenopfer wurden dem Moloch Nordpol gebracht! Wieviel Widerstandskraft und Geistesgegenwart, Mut und Entbehrungsfähigkeit steckte schon in den mittelalterlichen Draufgängern, die über den Nordpol hin den Weg zu den Goldländern China und Indien suchten. Und heute, im Zeitalter der Wissenschaft: welch eiserner Fleiß, wieviel Scharfsinn und Kenntnis, wieviel hartnäckige Selbsterziehung gehört dazu, um, nach dem großen Vorbild Fridtjof Nansens, das bloße Abenteuer oder die Sportleistung zu einer Kulturtat zu erheben, an deren Ergebnissen die Wissenschaft der ganzen Welt teilhat. Wahrlich, ein großer Teil menschlichen Heldentums hat die Polarregion zum Schauplatz, und von diesem Heldentum sollen die folgenden Blätter erzählen.
Wer war der erste Nordpolfahrer? Wer versuchte zum erstenmal, sich mit eigenen Augen vom „Ende der Welt“, an das man ehemals glaubte, zu überzeugen? Beide Fragen hängen aufs engste zusammen.
Die Kulturvölker des Altertums sahen sich mit der gespannten Aufmerksamkeit erster Entdecker in der Welt um; sie studierten ihre Nachbarn, Land und Volk, sie fragten, was hinter diesen wohne, und dann wieder dahinter nach Mitternacht, nach Norden. Die Irrfahrten des Helden Odysseus im 12. Jahrhundert v. Chr., die nicht über das Mittelländische Meer hinausgingen, lebten in Homers unsterblichen Gesängen fort und machten Schule; bald gab es eine Menge abenteuerlustiger Gesellen, die weit umherkamen und noch viel zahlreicherer Menschen „Städte gesehen und Sitte gelernt“ hatten; und wo ihre eigene Odyssee, ihr persönliches Erlebnis endete, wußten sie weitere Fragen vom Hörensagen zu beantworten und phantastisch auszuschmücken. Wahrheit und Dichtung verwuchs untrennbar ineinander. Griechenlands erster Geschichtschreiber, Herodot von Halikarnaß, erwähnt die Sage von den Hyperboräern, die über dem brausenden Boreas (dem Sturm) wohnen sollten; aber obwohl auch Homer davon erzählt, erscheint dem Historiker diese schon alte Tradition sehr verdächtig; ebenso die Sage von den Einäugigen, als deren Heimat ebenfalls der Norden galt. „Gibt es Menschen über dem Nordwind, so gibt es auch welche über dem Südwind“, erklärt Herodot; „es ist geradezu lächerlich,“ fügt er hinzu, „so oft man schon den Umkreis der Erde gezeichnet hat, noch keiner hat ihn mit rechtem Verstand dargestellt. Da malen sie den Ozean rings um die Erde fließend und die Erde kreisrund, wie mit dem Zirkel gezogen.“ Mit der alten Vorstellung von der festen Erdscheibe, die auf dem Okeanos, dem Meere, schwimme, konnte also auch er sich nicht mehr befreunden. Die Sage von den Hyperboräern, den „übernordischen Leuten“, erhielt sich aber trotz Herodot und lebte ein halbes Jahrtausend nach ihm bei den Römern wieder auf. Da oben im Norden sollte ein seliges Volk wohnen, dem die Sonne nur einmal auf- und untergehe und alle Früchte aufs schnellste reiften. In diesen alten Überlieferungen, deren Träger wir kaum ahnen können, steckt also immer ein Stück Wahrheit: man wußte damals schon von dem langen Tag und der ebenso langen Nacht im Norden.
Etwa 1000 Jahre v. Chr. kamen die Phönizier, das klassische Seefahrervolk des Altertums, schon hoch in den geheimnisvollen Norden hinauf; auf ihren ziemlich großen, kunstvoll gebauten und hochgeschnäbelten Ruderschiffen, die auch mit Mast und Segel versehen waren, gelangten sie bis zu den britischen Inseln. Dort erhandelten sie Zinn, und die hochentwickelte Kultur der Phönizier ist gewiß nicht ohne Einfluß auf die nordischen Barbaren, die keltischen Ureinwohner, geblieben. Auf den breiten Straßen der Flüsse drangen sie auch weit ins Innere Englands hinein.
Der erste indes, der eine regelrechte Entdeckungsfahrt nach dem Norden unternahm, war Pytheas aus Marsilia, dem heutigen Marseille. Er lebte zur Zeit Alexanders des Großen (4. Jahrhundert v. Chr.) und war, ebenso wie sein Zeitgenosse Aristoteles und andere, schon von der Kugelgestalt der Erde überzeugt. Wenn man Spitzen von Bergen, Türmen usw. aus der Ferne zuerst erblickte, mußte deren Grundlinie tiefer liegen als der Standpunkt des Beschauers. Diese Biegung der Erdoberfläche wollte er mit eigenen Augen beobachten und die „Steigung des Pols“ untersuchen. Pytheas war es, der zum erstenmal die „Sonnenhöhe“ eines Ortes feststellte, er ist jedenfalls auch der Erfinder der dazu nötigen nautischen Instrumente, ohne die — natürlich in ihrer unendlich vervollkommneten Gestalt — heute kein Schiff auch nur die kürzeste Seefahrt unternimmt. Seine Reise ins Blaue oder richtiger ins Dunkle hinein beschrieb er in einem Werk „Vom Ozean“, das nur in Bruchstücken erhalten ist; aber sie zeigen doch, mit welch geschultem, klarem Blick der alte Grieche die ihm so völlig neue Welt des Nordens mit ihrem Nebel, Schnee und Eis erfaßt hat. Ihm verdanken wir auch die erste geschichtliche Erwähnung der Germanen, von denen er Bernstein einhandelte.
Читать дальше