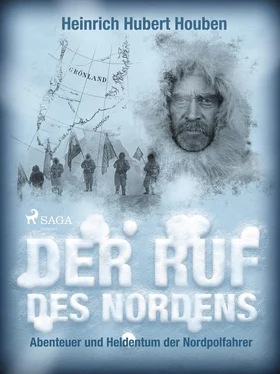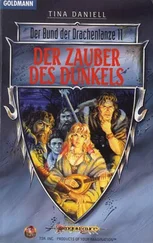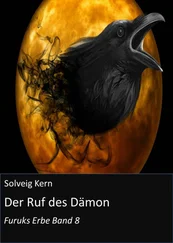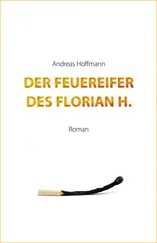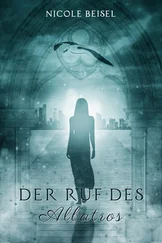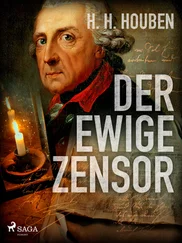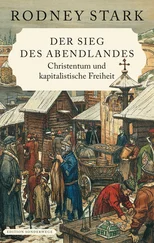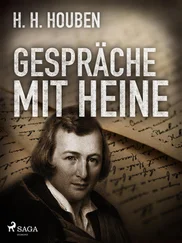1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 Mit diesem 3. August, der Entdeckung der Hudson-Bai, endet das Tagebuch des Kapitäns. Was sich weiter begab, wissen wir nur aus den gerichtlichen Aussagen der Matrosen. Hudson war ein Mann von eisernem Willen und rücksichtsloser Strenge. Die Leidenschaft des Entdeckers beseelte ihn ganz, er achtete sein eigenes Leben nicht, auch nicht das seiner Leute. Kehrte er jetzt nicht um, dann war von Heimkehr in diesem Jahr nicht mehr die Rede; die Hudson-Straße ist nur kurze Zeit eisfrei und passierbar. Zu einer Überwinterung reichten die Lebensmittel nicht. Hudson steuerte längs der Ostküste der Bai südwärts, erreichte im September die James-Bai und wurde Anfang November in einem Inselhafen vom Eise eingeschlossen. Das Schiff ließ er auf den Strand ziehen und das Winterlager herrüsten. Schon im September hatte er einen widerspenstigen Offizier absetzen müssen; die Mannschaft gehorchte nur noch widerwillig seinem Befehl. Der Zimmermann weigerte sich, die Winterhütte zu bauen, er sei Schiffszimmermann, nicht Landzimmermann. Noch ließ sich der Aufruhr bändigen, und der Winter wurde trotz der knappen Lebensmittel ohne sonderliche Entbehrung überstanden; die Jagd auf Zugvögel erwies sich als einfach und sehr ergiebig. Im Frühjahr aber wurde diese Beute rar, die Rationen mußten auf ein Minimum herabgesetzt werden, und der Kapitän überwachte mit unnachgiebiger Strenge die Verteilung der Lebensmittel. Der Groll wuchs und kam schließlich zu einem furchtbaren Ausbruch. Anführer der Meuterer war ein Maat namens Green, den Hudson als verlassene Waise aus dem Elend gezogen, in sein Haus aufgenommen und als seinen Liebling verhätschelt hatte. Als Ende Juni die Bai eisfrei wurde und das Schiff zur Abfahrt unter Segel ging, traten die Meuterer, Green an der Spitze, ihrem Kapitän mit der Waffe in der Hand entgegen. Nur wenige Getreue scharten sich um ihn, sechs Matrosen und der Schiffsmathematiker Woodhouse, Hudson nebst seinem Sohn, der noch Kind war, wurde mit jenen sieben in einem Boot, fast ohne Nahrungsmittel, nur mit einer Flinte als Waffe, ausgesetzt und seinem Schicksal überlassen, während das Schiff nach Norden davonfuhr. Nie hat sich eine Spur von ihm mehr gefunden, völliges Dunkel schwebt über dem gräßlichen Ende Hudsons, seines Sohnes und seiner sieben Gefährten. Das Schiff fand den Rückweg nach England, aber ein Teil der Leute kam auf der fürchterlichen Fahrt ums Leben; die einen, darunter der Rädelsführer Green, fielen im Kampf mit räuberischen Eskimos oder Indianern, die andern verhungerten; der Rest fristete sein Leben durch Fische, Seevögel und Seetang, schließlich durch Knochen, die sie in Weinessig aufweichten. Sie wurden vor Gericht gestellt und schwer bestraft. Eine Rettungsexpedition unter Sir Thomas Button kehrte ergebnislos zurück; sie fand weder die neun Verschollenen noch einen westlichen Ausgang aus der Hudson-Bai, die sich als ein Binnenmeer erwies, allerdings mit einer kanalartigen Verzweigung nach Norden, den Fox-Kanal, wie er nach seinem späteren Erforscher Kapitän Luke Fox (1631) genannt wurde. Alle Versuche aber, sich durch das Inselgewirr, in das sich der Norden Amerikas auflöst, durchzukämpfen, erwiesen sich als vergeblich, und die Hoffnung, hier eine Durchfahrt nach Nordwesten zu finden, mußte aufgegeben werden.
Einer der Männer, die zunächst den Spuren Hudsons folgten, war William Baffin. Seine Expedition zur Hudson-Bai im Jahre 1615 ließ ihn die Unmöglichkeit weiteren Vordringens erkennen. Wenn es überhaupt eine nordwestliche Durchfahrt gebe, erklärte er, könne sie nur an der Westküste Grönlands hinauf gefunden werden. Hier hatte unterdes John Davis auf drei Fahrten (1685—1687) die 340 Kilometer breite Meeresstraße zwischen Grönland und den amerikanischen Polarinseln bis zum 73. Grad hinauf gründlich durchforscht und damit die Kenntnis der Polarwelt um ein gewaltiges Stück erweitert. Diese Aufklärungsarbeit setzte keiner erfolgreicher fort als Baffin, der im Jahre 1616 durch die Davis-Straße hinauf die gewaltige Bai durchquerte, die den Namen ihres Entdeckers erhielt, ebenso wie das Land im Westen. Baffin erreichte als erster die Melville-Bai, den Smith-Sund und den Lancaster-Sund, Namen, die in der spätern Polarforschung große Berühmtheit gewannen, und war auf dem richtigen Wege. Dennoch verzweifelte er, eine Durchfahrt nach Nordwesten zu finden, da die Fluthöhe, je weiter er kam, immer mehr abnahm, also durch den Atlantischen Ozean bestimmt wurde. Außerdem litten seine Leute an Skorbut, und die Küsten waren durch die vorgelagerten Eisbänke unzugänglich. Er kehrte daher zurück und machte aus seiner Überzeugung kein Hehl, daß der Glaube an einen nordwestlichen Seeweg endgültig aufzugeben sei. Damit scheidet dies Problem auf zwei Jahrhunderte aus der Entdeckungsgeschichte aus. Baffin hat durch diese Erklärung seinen eigenen Ruhm aufs empfindlichste geschädigt, und die Gegner seiner Theorie gingen schließlich so weit, alle seine Berichte als unglaubwürdig zu verdächtigen. Das geschah am nachdrücklichsten durch einen Engländer namens Barrow, den Sekretär der englischen Admiralität, — aber unglücklicherweise im selben Jahr 1818, als die englische Expedition von James Ross alle Entdeckungen Baffins aufs glänzendste bestätigte und den Ruhm des großen Forschers wiederherstellte.
Der große arktische Kontinent Grönland war den Walfischfängern im 16. und 17. Jahrhundert wohlbekannt; wenn das Eis es erlaubte, legten sie oft an seinen Küsten an, tauschten auch bei den Eskimos Seehundsfelle gegen Nadeln und Töpfe ein. Die Seefahrer, die den nordwestlichen Durchgang nach Indien suchten, Frobisher, Davis, Baffin und Hudson, kannten Grönlands Südspitze, auch Teile der Westküste. Politisch aber war es Niemandsland, als Handelsstation vergessen, und selbst die Kirche hatte ihr nördlichstes Bistum aufgegeben. Die alten Sagen aber lebten fort: von der grünen Insel, die ein Eiswall umgab, von den Normannen, die ehemals von dort auf ihren Wikingerschiffen die Meere durcheilt und Christen geworden waren, über die ein Bischof herrschte Von wilden Bewohnern, die in Fellbooten zwischen den Eisschollen umherflitzten, wußten die Walfischjäger genug zu erzählen; Christen aber waren sie da oben nie begegnet. War der Normannenstamm Eriks des Roten völlig ausgestorben und ausgerottet? Oder waren seine Nachkommen in Barbarei und Heidentum zurückgesunken und mit den Ureinwohnern verwildert? War es nicht Christenpflicht, ihre Spur zu suchen, ihnen aufs neue das Evangelium zu verkünden und sie in die Gemeinschaft der europäischen Kultur zurückzuführen?
Ein frommer lutherischer Pfarrer namens Hans Egede hing diesen Fragen nach und wurde darüber zum Missionar. In Norwegen 1686 geboren, studierte Egede in Kopenhagen Theologie; schon mit 21 Jahren war er Prediger auf den Lofoten, nördlichen Inseln seiner Heimat; er war Gatte einer tüchtigen Frau und Vater von vier Kindern. Dieses Stilleben befriedigte ihn nicht, er fühlte sich zu einer größeren Aufgabe berufen und verlangte, als Missionar nach Grönland zu gehen Der Bischof zuckte die Achseln — Missionen kosten Geld. Damals lag König Friedrich II. mit Karl XII. von Schweden im Kampf — für Kulturaufgaben blieb da nichts übrig Egede ließ sich nicht abschrecken; er gab 1718 seine Pfarre auf und suchte unternehmende Kaufleute, die sich an einer Expedition nach Grönland beteiligten. Als der Friede geschlossen war, gelang ihm in Bergen die Gründung einer „Gesellschaft für den grönländischen Handel“. Mit Unterstützung des Dänenkönigs, dem jetzt Norwegen wieder gehörte, wurde ein Segelschiff, die „Hoffnung“, ausgerüstet, und nach stürmischer Überfahrt betrat Egede mit seiner Familie und etlichen Landsleuten, die sich ihm angeschlossen hatten, die Westküste Grönlands. Seinen Landungsplatz nannte er „Godthaab“ (Gute Hoffnung); so heißt der Ort noch heute.
Читать дальше