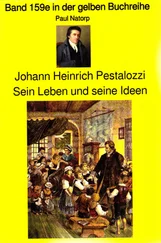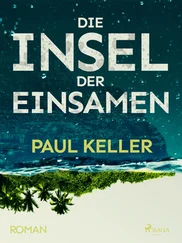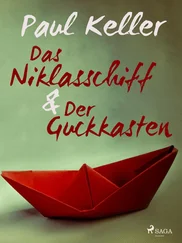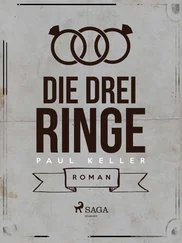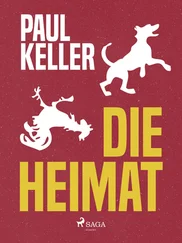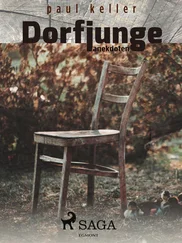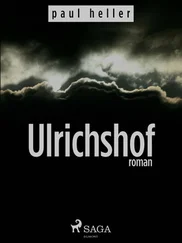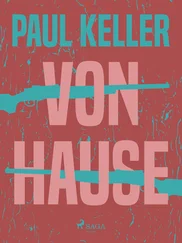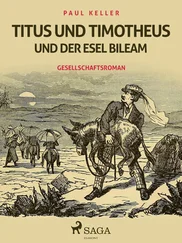Klaus, der Jüngste vom Heinrichshofe, trat in die große Wohnstube und schleuderte die Schultasche aufs Sofa, die Mütze aufs Fensterbrett. Seine Schwester Marie, die am Fenster saß und Wäsche ausbesserte, hob den Kopf und sagte: „Die Schultasche gehört an den Nagel, die Mütze an den Haken!“
„Mach du’s doch!“ brummte der Junge.
Aber sie brauchte ihn nur fest anzusehen. Da hing der Junge die Schultasche an den dafür bestimmten starken Nagel, die Mütze an einen Kleiderrechen neben der Tür.
Nach einer Weile fragte Marie — sie war die Älteste der Heinrich-Kinder und letztes Weihnachten majorenn geworden —:
„Nun, wie war’s heute in der Schule?“
Der Junge schmollte.
„Wenn du so zu mir bist, erzähl’ ich überhaupt nichts.“
Das Mädchen nähte schweigend weiter an einem zerrissenen Sätuch. Der Junge stapfte im Zimmer auf und ab, pfiff, sah zum Fenster hinaus und hätte ja der Marie gar zu gern erzählt, „wie es war“, aber er ärgerte sich zu sehr, daß er ihr wieder einmal hatte folgen müssen. Endlich hielt es sein Temperament nicht länger aus.
„Wie’s war? Na, kurz war’s!“
„Das weiß ich, denn es ist eben erst zehn.“
„Ja, Marie, und riesig feierlich war’s.“
„Riesig feierlich, sagt man nicht“, verwies Marie, „so sprechen nur die Städter; man sagt einfach ‚feierlich‘!“
„Einfach feierlich war’s. Zuerst haben wir gesungen. Und weißt du, was wir gesungen haben, Marie? ‚Es ist bestimmt in Gottes Rat.‘ Wie bei einem Begräbnis.“
Das Mädchen hob verwundert die Augen auf von ihrer Arbeit und sagte:
„Das habt ihr gesungen? Ja, warum denn?“
Der Junge stand vor ihr und sagte:
„Ja, nun paß auf, Marie; jetzt werde ich es dir vormachen.“
Er faltete die Hände über der Brust, senkte ein wenig den Kopf und sagte mit leiser, müder Stimme: „Liebe Kinder! Ihr habt jetzt das schöne Lied gesungen ‚Es ist bestimmt in Gottes Rat, daß man vom Liebsten, was man hat, muß scheiden‘. Seht, ich habe mir für meine Abschiedsfeier dieses Lied ausgebeten. Das Liebste, was ich auf der Welt hatte, war mir die Schule. Und von der muß ich heute scheiden. Die Behörde hat mich pensioniert, nicht, weil ich es wollte, nein, weil halt die Reihe an mir ist. Ich hätte es mir ganz anders gewünscht. Gar nicht weit weg von hier liegt die Stadt Goldberg. Da hat im sechzehnten Jahrhundert ein Lehrer gelebt, unter uns Millionen Lehrern einer der besten und größten. Der hieß Valentin Trotzendorf. Er hatte eine lateinische Schule. Damals sprachen selbst die Knechte und Mägde in Goldberg neben ihrer deutschen Sprache lateinisch. Als nun der Valentin Trotzendorf wieder einmal in alter Frische und Freude am Unterrichten vor seinen schülern stand, da fühlte er plötzlich, daß er jetzt sterben würde. Und da breitete er seine Arme aus und rief: ‚In aliam scholam avocor!“ Und er starb. Seht, Kinder, was der Valentin Trotzendorf da im Sterben sagte, heißt in deutscher Sprache: ‚Ich werde in eine andere Schule abberufen!‘ Valentin Trotzendorf war sechsundsechzig Jahre alt, als er starb. Ich bin fünfundsechzig. Konnte man mir nicht noch ein Jahr in der Schule vergönnen? Vielleicht, daß Gott es gegeben hätte, ich hätte auch so einmal in der Schulstube sagen können: ‚In aliam scholam avocor!‘ So aber bin ich pensioniert.“
„Ach, nun ist es also doch so weit“, entgegnete Marie und hielt mit Nähen inne. Sie liebte ja den alten Lehrer, der heute verabschiedet wurde, wie einen Vater.
Der Junge setzte sich auf die Tischkante, und als er sah, daß seiner Schwester die Nachricht zu Herzen ging, wollte er sie trösten.
„Du, Marie, dann war’s aber auch noch weiter feierlich. Der Pfarrer hat eine Rede gehalten und gesagt: Unser Kantor, der sei einer von den Lehrern, von denen in der Bibel steht: sie werden glänzen wie die Sterne am Himmel. Und der Schulinspektor hat ihm einen Orden angemacht; ich sage dir, einen funkelnden Adler aus Silber.“
„Einen Orden? Was hat er denn dazu gesagt?“
„Ach, gar nichts. Er hat bloß so sachte mit dem Kopfe geschüttelt. Und dann haben wir Schulkinder ihm alle die Hand gegeben, und jedes hat was zum Abschiede gesagt.“
„Was hast denn du gesagt?“
„Ach, ich habe gesagt: ‚Adje, Herr Kantor! Verbindlichsten Dank!‘ “
„Alberner Bengel!“ zürnte sie.
Der Junge sprang vom Tisch herunter und sagte:
„Alberner Bengel? Wieso? So ein schönes Wort wie ‚verbindlich‘ kann sonst im Dorfe kein einziger Mensch.“
„Du bist ein alberner Bengel!“ wiederholte sie. Das nahm er wieder krumm und setzte sich erbost auf das breite Fensterbrett. Etwa nach fünf Minuten fing Marie von neuem an zu reden.
„Klaus, du solltest auch Lehrer werden oder Pfarrer.“
„Weil ich ein alberner Bengel bin?“ höhnte er.
„Nein, weil du dir so zum Staunen alles wortgetreu und leicht behältst, auch solche lateinische Wörter, und weil du alles so ganz richtig wieder hersagen kannst.“
„Da werd’ ich eben Schauspieler werden.“
„Daß du dich unterstehst, mit dieser Gesellschaft in einem Zigeunerwagen herumzufahren.“
„Es gibt ganz andere Schauspieler, Marie, in Liegnitz und in den anderen Hauptstädten der Welt. Die wohnen gar nicht in Zigeunerwagen. Lies nur in der Zeitung!“
Sie gab nichts darauf, sondern kam wieder auf das Hauptthema zurück.
„Da seid ihr wohl danach ganz still und traurig nach Hause gegangen?“
Der Junge hauchte die Fensterscheibe an und kritzelte mit dem Finger darauf. Er tat, als ob er nichts gehört hätte.
„Ob ihr recht still und traurig nach Hause gegangen seid?“ wiederholte die Schwester.
„Ach“, sagte er da, „traurig war’s ja sehr, aber die Sonne hat auch sehr schön geschienen.“
Mit scharfem Verdacht äugte Marie nach dem Jungen hin.
„Bist du etwa barfuß die Chaussee runtergerannt?“
„Nein!“ sagte Klaus mit der Ruhe der Wahrhaftigkeit.
Aber ihr Verdacht war zu groß. Sie sprang auf und faßte den Zappelnden am Bein. Die Strümpfe waren feucht. Marie wußte Bescheid. Der Schuh flog herunter, dann der Strumpf, aus dem der Streusand bröselte. Jetzt bekam Klaus den Strumpf so um die Ohren geschlagen, daß Sankt Georg, der Tagesheilige vom 23. April, an diesem 31. März nur ganz von ferne stehen und lächeln konnte: Achtet mein Datum! „Vor dem 23. April geht man nicht barfuß“, sagte Marie.
Die Mutter trat ins Zimmer, die Bäuerin. Sie war an die fünfzig, breit und behäbig. Trotz ihrer Schwerfälligkeit schaffte diese Frau vom frühen Morgen bis in die späte Nacht. Ihr Leben war einsame Pflichterfüllung. Zehn Kinder hatte sie geboren; vier waren klein gestorben; die zwei ältesten Töchter hatten, als sie eben erwachsen waren und der Mutter hätten eine Stütze sein können, nach auswärtigen Dörfern geheiratet; vier Kinder waren noch zu Hause, Karl, Marie, Bernhard und Klaus. Diese Frau war wie der Oderstrom, geboren zum Schleppen, bestimmt für einsame Wanderung; ihr Lebenslauf war ohne Poesie, kaum, daß sie abends einmal auf der Bank neben dem Rosenbusch vor dem Hause den großen Frieden der Natur empfand. Sie war einmal in ihrem Leben in Breslau gewesen, hatte verwirrt in das bunte, rauschende Treiben hineingeschaut. Aber es war ihr bange geworden, und sie hatte aufgeatmet, als sie wieder daheim war. Ihr Mann war ein frohgemuter Mensch, aber er liebte das Wirtshaus. Noch vor vollendetem fünfundvierzigsten Lebensjahre starb er. Sie mußte dann allein weiterwandern. —
Der Wirtschafter trat in die Stube. Er war zwischen fünfzig und sechzig, ein großer, starker Mann. Er hatte das rotbraune, verwitterte Gesicht der Leute vom Lande, besaß noch ganz volles, kaum angegrautes Haar, war besser gekleidet als andere Bauern, die in schlechtgeflickten Hosen aufs Feld gingen.
Читать дальше