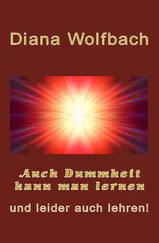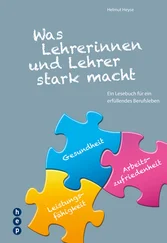Kapitel 8: Psychosoziale Anforderungen im Lehrberuf
Auch in Kapitel 8 (  Kap. 8) steht nicht primär das Lehren und Lernen im Fokus, sondern die Lehrerinnen und Lehrer als Personen. Unterrichten ist eine komplexe Angelegenheit – der Lehrberuf ist somit unbestritten eine sehr vielseitige und abwechslungsreiche Profession; langjähriger Schuldienst kann aber auch anstrengend und unter Umständen belastend sein. Der Autor dieses Kapitels ist selbst langjähriger Lehrer und weiß, wovon er redet. Daher widmen wir ein ganzes Kapitel den psychosozialen Anforderungen, mit denen Lehrpersonen gerade auch am Anfang ihrer Tätigkeit konfrontiert sind. Wir zeigen auf, mit welchen Stressoren man es bei der Berufsausübung zu tun hat und wie sie produktiv bewältigt werden können. Zentrale Faktoren, um dieses Ziel zu erreichen, sind einerseits die Fähigkeit, mit allen am Schulleben Beteiligten in schwierigen Situationen kompetent zu kommunizieren, und andererseits, sich selbst beim Arbeiten so zu regulieren, dass man dem permanenten Handlungsdruck nicht ins Messer läuft.
Kap. 8) steht nicht primär das Lehren und Lernen im Fokus, sondern die Lehrerinnen und Lehrer als Personen. Unterrichten ist eine komplexe Angelegenheit – der Lehrberuf ist somit unbestritten eine sehr vielseitige und abwechslungsreiche Profession; langjähriger Schuldienst kann aber auch anstrengend und unter Umständen belastend sein. Der Autor dieses Kapitels ist selbst langjähriger Lehrer und weiß, wovon er redet. Daher widmen wir ein ganzes Kapitel den psychosozialen Anforderungen, mit denen Lehrpersonen gerade auch am Anfang ihrer Tätigkeit konfrontiert sind. Wir zeigen auf, mit welchen Stressoren man es bei der Berufsausübung zu tun hat und wie sie produktiv bewältigt werden können. Zentrale Faktoren, um dieses Ziel zu erreichen, sind einerseits die Fähigkeit, mit allen am Schulleben Beteiligten in schwierigen Situationen kompetent zu kommunizieren, und andererseits, sich selbst beim Arbeiten so zu regulieren, dass man dem permanenten Handlungsdruck nicht ins Messer läuft.
Kapitel 9: Wissenschaftstheoretischer Hintergrund: Die Methoden der empirischen Lehr- und Lern-Forschung
Lehrpersonen stehen jeden Tag vor einer Vielzahl von Entscheidungen: Was will ich vermitteln? Welche Lernziele sollen erreicht werden? Welche Methode ist dafür geeignet? Wie gehe ich mit den beiden Störenfrieden in der hintersten Reihe um? Usw. Die seit rund 5 Jahrzehnten betriebene Lehr- und Lern-Forschung versucht, auf solche Fragen evidenzbasierte Antworten zu liefern, um damit Lehrpersonen letztlich darin zu unterstützen, Entscheidungen nicht einfach aus dem Bauch heraus, sondern aufgrund von empirisch überprüften Befunden (man nennt dies auch evidenzbasiert) zu treffen. Auf solchen Befunden basieren auch unsere Ausführungen in den Kapiteln 2–8. Doch wodurch ist diese Forschungsrichtung selbst geprägt, welches sind ihre Methoden, wie verlässlich und wie praxisrelevant sind die durch sie hervorgebrachten Resultate? Das letzte Kapitel (  Kap. 9) gibt einen Abriss über dieses faszinierende Forschungsgebiet, zeigt aber auch dessen Probleme und Grenzen auf. So werden interessierte Lehrpersonen in die Lage versetzt, eigenständig Fachartikel (auch kritisch) zu rezipieren und den Wahrheitsgehalt von Medienberichten zu Bildungsthemen einzuschätzen.
Kap. 9) gibt einen Abriss über dieses faszinierende Forschungsgebiet, zeigt aber auch dessen Probleme und Grenzen auf. So werden interessierte Lehrpersonen in die Lage versetzt, eigenständig Fachartikel (auch kritisch) zu rezipieren und den Wahrheitsgehalt von Medienberichten zu Bildungsthemen einzuschätzen.
Es mag sein, dass Sie als Leserin oder Leser im vorliegenden Buch ein Kapitel über die sogenannte »Digitalisierung« vermissen. Natürlich ist es uns auch bewusst, dass dieser Trend unaufhaltsam ist, nicht nur in der Schule. Und natürlich ist gegen den gezielten Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien im schulischen Unterricht nichts einzuwenden, im Gegenteil. Nichtsdestotrotz ist es für uns aus kognitions- und lernpsychologischer Sicht völlig klar: Ob man nun als Hilfsmittel die Wandtafel oder aber ein digitales Gadget nach dem neusten Stand der Technik einsetzt, ist zunächst einmal zweitrangig. Entscheidend ist in jedem Fall, dass etwa die Fachinhalte auf Lernziele heruntergebrochen werden, dass die Lehrperson an das bei den Schülerinnen und Schülern bestehende Vorwissen anknüpft und eine zur Erreichung der Lernziele adäquate Methode auswählt. Wenn diese Arbeit nicht professionell geleistet wird, dann bringt auch der Einsatz noch so elaborierter Technologien keinen Vorteil vor dem traditionellen Unterricht mit Papier und Wandtafel.
1.3 Wie man dieses Buch nutzen kann
Wir haben es im vorangehenden Kapitel schon mehrfach betont: Unterrichten ist ein komplexes Handwerk, das Unterrichtsgeschehen ein von zahlreichen und letztlich wohl niemals ganz überschaubaren Faktoren bestimmter Prozess. Niemand kann in jeder Lektion alle Faktoren berücksichtigen, die perfekte Lektion gibt es nicht. Das heißt aber keinesfalls, dass man als Lehrperson nun resigniert die Segel streichen soll – im Gegenteil! Je differenziertere Kenntnisse man über alle im Schulzimmer auftretenden Phänomene hat, desto größer wird in einer (evtl. auch kritischen) Entscheidungssituation die Zahl an günstigen Handlungsoptionen. Oder wie es der erfolgreiche Harvey Specter in der Anwaltsserie Suits einmal (notabene sinngemäß) zu seinem kongenialen Juniorpartner unnachahmlich sagte:
»Einer hält dir eine Pistole an die Schläfe. Tust du, was er sagt? Falsch! Du nimmst ihm die Pistole weg. Oder du ziehst eine größere Pistole. Oder du sagst, er bluffe nur. Oder du tust eine andere von 146 weiteren Möglichkeiten, die du hast!«
Was heißt das nun für dieses Buch? Jedes Kapitel stellt einen Faktor – oder genauer: ein Bündel von Faktoren – des Unterrichtsgeschehens dar, und zwar in einer weitgehend in sich abgeschlossenen Form. Allerdings ergibt sich erst aus dem Buch als Ganzem ein Gesamtbild, das alle Aspekte des Unterrichtens abdeckt und zueinander in Beziehung setzt. Daher sehen wir auch mehrere Möglichkeiten für die Lektüre.
• Die einzelnen Kapitel können je nach Interesse jedes für sich gelesen werden. (Ihre von der Sache her unvermeidliche Verwobenheit haben wir mit zahlreichen Verweisen wenigstens ansatzweise einzufangen versucht.)
• Angehenden Lehrpersonen, die noch in Ausbildung sind und am Anfang ihrer Berufsbiographie stehen, können und sollten das Buch zunächst einmal als Ganzes lesen. Damit erhalten sie einen Überblick über alle relevanten Aspekte, die ihren beruflichen Alltag prägen werden. Wenn sie dann tatsächlich (etwa bei einer Stellvertretung oder einem ersten Lehrauftrag) in ein Klassenzimmer treten, dürften zunächst einmal die Kapitel 2 (Planung), 3 (Methoden) 7 (Klassenführung) und 8 (Psychosoziale Anforderungen) oberste Priorität haben.
• Bei erfahrenen Lehrpersonen (auch bei uns selber!) sehen wir die berufliche Weiterentwicklung in kleinen Schritten. Man fokussiert auf einen bestimmten Aspekt seines Schulalltags, konsultiert das entsprechende Kapitel – und transferiert das erworbene Wissen auf die eigene konkrete Situation. Das klingt einfach, ist aber anspruchsvoll genug – und gelingt wahrscheinlich auch nicht immer (jedenfalls nicht beim ersten Mal…). Ein Beispiel: Eine Klasse hat sich über die inhaltliche Ausgestaltung und Beurteilung einer Prüfung beschwert. Nun könnte man das abtun als »pubertäres Quengeln« – oder aber man nimmt die Aussagen zunächst einmal ernst, informiert sich anhand von Kapitel 9 darüber, wie man eine valide Prüfung konzipiert – und gestaltet die nächste einmal minutiös nach dem von uns vorgeschlagenen Leitfaden. Und noch ein zweites Beispiel: Seit Wochen »regt man sich über zwei dauernd schwatzende Schülerinnen in der hintersten Reihe auf«. Statt sich weiter aufzuregen, lese man Kapitel 7.3 über die Prävention von Unterrichtsstörungen und setze in den folgenden Lektionen zwei, vielleicht auch drei oder vier Maßnahmen um…
• Für Schulleitungen und Personen aus der Bildungsadministration oder Bildungspolitik kann das Buch oder können zumindest ausgewählte Kapitel dazu beitragen, die Evaluation der Lehrkräfte zu überdenken. Unseres Erachtens sind wir es den Schülerinnen und Schülern schuldig, möglichst lernwirksamen Unterricht zu bieten, der wesentlich auf professionell agierenden Lehrpersonen beruht. Unter diesem Gesichtspunkt bieten die einzelnen Kapitel zahlreiche, evidenzbasierte Handreichungen, um mit den Lehrpersonen zusammen die Qualität des Unterrichts zu reflektieren und gegebenenfalls zu verbessern.
2 Wer lehren will, muss das Lernen verstehen: Die kognitionspsychologischen Grundlagen des menschlichen Lernens
Elsbeth Stern
Читать дальше
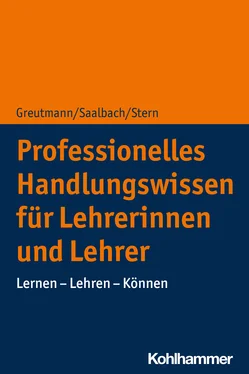
 Kap. 8) steht nicht primär das Lehren und Lernen im Fokus, sondern die Lehrerinnen und Lehrer als Personen. Unterrichten ist eine komplexe Angelegenheit – der Lehrberuf ist somit unbestritten eine sehr vielseitige und abwechslungsreiche Profession; langjähriger Schuldienst kann aber auch anstrengend und unter Umständen belastend sein. Der Autor dieses Kapitels ist selbst langjähriger Lehrer und weiß, wovon er redet. Daher widmen wir ein ganzes Kapitel den psychosozialen Anforderungen, mit denen Lehrpersonen gerade auch am Anfang ihrer Tätigkeit konfrontiert sind. Wir zeigen auf, mit welchen Stressoren man es bei der Berufsausübung zu tun hat und wie sie produktiv bewältigt werden können. Zentrale Faktoren, um dieses Ziel zu erreichen, sind einerseits die Fähigkeit, mit allen am Schulleben Beteiligten in schwierigen Situationen kompetent zu kommunizieren, und andererseits, sich selbst beim Arbeiten so zu regulieren, dass man dem permanenten Handlungsdruck nicht ins Messer läuft.
Kap. 8) steht nicht primär das Lehren und Lernen im Fokus, sondern die Lehrerinnen und Lehrer als Personen. Unterrichten ist eine komplexe Angelegenheit – der Lehrberuf ist somit unbestritten eine sehr vielseitige und abwechslungsreiche Profession; langjähriger Schuldienst kann aber auch anstrengend und unter Umständen belastend sein. Der Autor dieses Kapitels ist selbst langjähriger Lehrer und weiß, wovon er redet. Daher widmen wir ein ganzes Kapitel den psychosozialen Anforderungen, mit denen Lehrpersonen gerade auch am Anfang ihrer Tätigkeit konfrontiert sind. Wir zeigen auf, mit welchen Stressoren man es bei der Berufsausübung zu tun hat und wie sie produktiv bewältigt werden können. Zentrale Faktoren, um dieses Ziel zu erreichen, sind einerseits die Fähigkeit, mit allen am Schulleben Beteiligten in schwierigen Situationen kompetent zu kommunizieren, und andererseits, sich selbst beim Arbeiten so zu regulieren, dass man dem permanenten Handlungsdruck nicht ins Messer läuft.