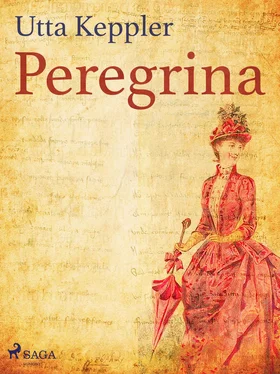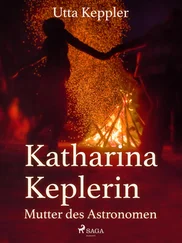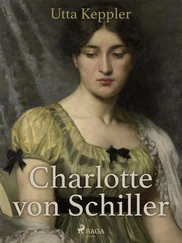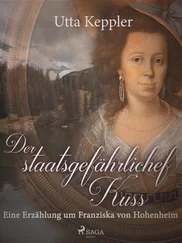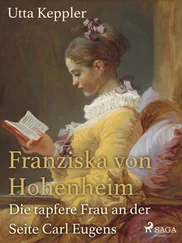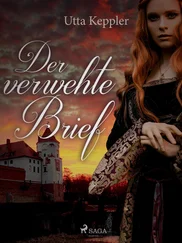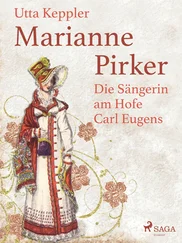Die drei oder vier Jahre, seit Sand tot sei, sagte man, habe sich sein Bild eher verklärt und vergrößert, und es gebe manche Studenten, auch solche, die inzwischen in Amt und Würden oder gar Pfarrherren seien, die noch ein blutgetränktes Taschentuch in einer Schatulle hätten, am Richtstuhl des Sand getränkt …
Das Bild wurde Mörike quälend deutlich: Nach der Tat, als der Sand wie ein Wahnsinniger aus der Wohnung gerast war, hinter sich den Verblutenden mit den schreienden Frauen und Kindern, als er, Sand, sich den zweiten Dolch, den er entworfen und bestellt, in seine eigene Lunge gestoßen hatte – er spürte es kaum, wie er nachher berichtete –, als er draußen vor dem Haus hinfiel, in die Knie brach, vornübergebeugt und blutend sagte: »Gott sei gedankt – ich hab’s vollbracht!« – hatten ihn die Leute aufgehoben und weggetragen. Das wußte Maria von denen, die ihn fanden.
Aber danach lag er wochenlang mit Schmerzen, fiebernd – und da hatte sie ihn besucht: Sie fand ihn halbschlafend und stöhnend, setzte sich aufs Bett, wußte selber kaum mehr, was sie tat, deckte ihn zu und drückte ihren Kopf an ihn – und so, wie in einer Totenhochzeit, blieb sie lang bei ihm, bis die Hausfrau hereinschlich und sie fortschickte.
Mörike wehrte sich dagegen, alles zu glauben, er kannte indessen ihre sonderbaren »Zwischenreiche«, ihre phantastischen Visionen. Aber auch wenn sie sich die Szene bloß ausgedacht hatte, war’s ihm peinlich, es war ihm schrecklich und erschreckend. Er versuchte, sie zu wecken, zurückzuholen in ein beruhigendes friedliches Geviert, in eine ummauerte sichere Heimstatt; er fing an zu erzählen und sprach ihr wie einem Kind zu.
Endlich ließ er sie los und stand auf; er sah, daß sie sich drehte, und merkte endlich, daß sie langsam zu sich kam. Erleichtert nahm er ihre Hand und fragte: »Ist’s vorbei? Das war doch nicht wirklich so?«
Und sie antwortete mit ganz anderer Stimme und lachte dabei:
»Ich hab’ geträumt, Eduard; hab’ ich denn geredet?« Sie war dann ruhig, sogar nüchtern, als sie von fern und im Abstand von den Feiern und dem Wartburgschwur der Burschenschaft sprach, von dem sie in früher Zeit durch Sand gehört habe.
Er nickte bloß, erleichtert, daß sich das Gespräch so ins Vernünftige gewendet, auch wenn er vieles von dem schon gewußt hatte, was sie erzählte.
»Zieht nicht ein Name das Urteil nach sich? Er bannt, umgrenzt, behütet aber auch, ein edler Name schützt, schreckt Böses ab; ein häßlicher macht schaudern, er ekelt einen an; aber das Namenlose ist das Nebulose, unheimlich.«
Maria Meyer brauchte einen Namen – sie war so gegenwärtig und so fern, sie war der Grund – wie eine Tonart im Lied – und lebte in allen Klängen, Farben, Bewegungen und Linien, im Birkengespinst, in den Zirruswolken, im quellenden Gras, zwischen den gegeneinanderwehenden Anemonen, und wo es dunkler wurde, erdig, modernd, verworren, zwischen den Steinplatten am Wald, wo irgendetwas mühselig vielfüßig scharrte und grub, ein Käfer, vielleicht etwas größeres, Maus und Maulwurf, Tiere aus dem unteren Bereich – da war sie auch …
Sie wanderte hier und dort, verschwand und erschien, scheinend, schillernd, und unter ihren Berührungen wurde vieles still und vieles lahm, gelähmt, starr … Mörike versuchte, sie in ein Bild zu fassen, das hatte ihm immer geholfen, das Festlegen, Bannen, Benennen, Umreißen, Einzäumen – das Wesen der Sprache war ja ein Heilbann, der das Unerklärliche ins Licht zwang und zum Stillstehen brachte.
Aber sie zog vorbei, weithin … Einmal sagte er sich vor: Ich habe den Namen gefunden: Peregrina: Die Wandernde, Pilgernde, Schweifende – Peregrina.
Als er ihr das Wort sagte, schwieg sie zuerst, faltete die Hände ineinander, Flechtwerk der schmalen Finger, und summte dann vor sich hin.
»Also heiß’ ich so?«
Sie fragte nach der Bedeutung des Wortes, das sie zuerst nur als Klang und Schwingung aufgenommen hatte, und er erklärte es ihr.
Später, in ihrer Kammer im Wirtshaus unter dem Dach, wo es jetzt heiß war und das Gescharre der Mäuse in den Balken ihr den Schlaf störte, dachte sie darüber nach: Wandernde, Ziehende, und immer unruhig. Warum strolch’ ich so umeinander, dachte sie – und Schaffhausen fiel ihr ein, das immer gegenwärtige, wo man vielleicht doch hätte zur Ruhe kommen können, aber sie merkte gleich, daß sie das nicht einmal wollte: Dahin kann man nicht mehr zurück, wo man verjagt und verspottet worden ist – und wollte es doch.
Sie kamen dann wieder auf ihren Namen zu sprechen, auf den zweiten, dichterischen, auf den »Übernamen«, wie sie es nannte, auf »Peregrina«.
Sie wußte durch die gescheiten Leute, mit denen sie zu tun gehabt, irgendetwas vom Wortstamm und »Abstamm« des Wortes und deutete es in ihrem Sinn: »Peregrina sagst du, und pereat meinst du – als wolltest du mich verderben …«
Entsetzt unterbrach er sie, und hastig versprach sie, nie mehr solche Dinge auch nur zu denken; er sei, sagte er, so rein ehrlich und so offen und so auf’s ewig Bleiben gestellt, wie er nur könnte. Ein reiner Kristall, ein blanker Spiegel sei in ihm, und er halte ihn unbefleckt … das müsse sie wissen und glauben, auch wenn das Mißtrauen von früher, aus einer nicht mehr bewußten alten Zeit, immer wieder in ihr aufsteige.
Die Dunkle, die Wissende, die Geheime, die immer irgendwo war und immer wieder irgendwohin schwand, sie mußte gehalten, gebannt, gebunden werden in einem unerhörten, umgreifenden Bann; und jede Zärtlichkeit, jede Umarmung, mußte sie wandeln und ihm anverwandeln, daß sie nicht mehr zauberisch entschwinden, elfenhaft entschweben konnte.
Er horchte mit dem feinsten Gehör und tastete mit feinhäutigem Gespür nach Anzeichen, und was ihm leise aus dem Freundeskreis und danach, auf sein Drängen, von ihr selber angedeutet wurde, das griff er auf, zuckend verletzt und doch bemüht, es einzuhüllen, ungeprüft wegzuschieben, um nur tiefer in den Traum zu tauchen.
Maria, die Peregrina, quälte ihn, ohne es zu wollen, und doch im Unbewußten ganz zielstrebig: Was in ihr zerstört und verbogen war, weil man das Bild ihrer Mutter verfärbt und verkrüppelt hatte, und was tägliche Demütigungen gebrochen, das hatte ihr Wesen für immer geprägt.
Vielleicht war ihre Anlage nur geschmeidig und einfühlsam, und wenn sie geborgen und vertrauend aufgewachsen wäre, hätte das zu schönem Mitempfinden werden können.
Die verzweifelte Leidenschaft, die wilde Liebe zu Lohbauer und die Erscheinung des armen, krankhaft starren Sand hatten sich als Schreckbilder in ihre Erinnerung eingegraben, der schillernd-eitle Münch, »bildungseitel« und an ihr ungeschickt bildend, der wilde genialische Waiblinger – und was sie von ihnen aufgriff als bereite Zuhörerin, hatte sie willig an- und eingenommen, und jedesmal dann doch erfahren, daß sie keinem ganz trauen konnte.
Nur dieser klare zarte Knabe, der Dichter, rein und im Innersten fromm – der würde halten und helfen, hätte sie nur noch Kraft genug, ihm zu vertrauen; er sah sie so, wie sie hätte sein wollen, und seit sie ihn kannte, hatte sie das Maß verstanden. Wenn er da war, trug er sie mit, was er ihr vorsprach, empfand sie als eigen, und wo er sich selbst abschirmte gegen kaum Gespürtes, das von ihr ausging, schützte er auch sie vor sich selber: „Einem Kristall gleicht meine Seele nun, den noch kein falscher Strahl des Lichts getroffen …“
Aber wie man ein Kind schont, so durfte sie ihm nicht alles erzählen; es hätte ihn zu schwer getroffen, er hätte auch nichts verstanden.
Alexander von Rußland
Im Jahr 1815 sei die »Heilige Allianz« in Weinsberg bei Heilbronn gegründet worden, sagte der heilkundige, halbblinde Arzt und Seher Justinus Kerner einmal zu seinem Sohn Theobald, und der schrieb es auf.
Читать дальше