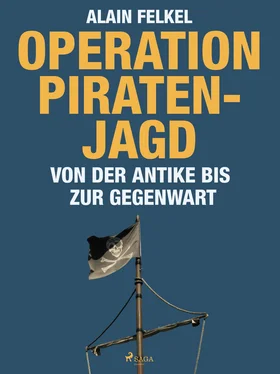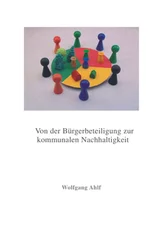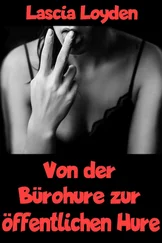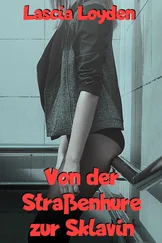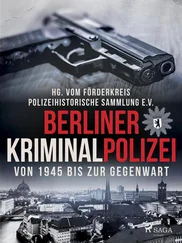Mit der Umsiedlung der Seeräuber bewies Pompeius Weitsicht. Statt sich das Leben leicht zu machen und nur die Symptome der Piraterie zu kurieren, bekämpfte er ihre Ursachen. Dies war neu und für einen Römer höchst ungewöhnlich. Pompeius hatte klar erkannt, dass nicht nur antirömische Ressentiments, sondern auch Armut und Entwurzelung zur epidemischen Ausbreitung des Seeraubs beigetragen hatten.
Dabei war Pompeius alles andere als ein Sozialreformer. Es ist oft behauptet worden, dass Pompeius nur so mild zu den Piraten war, um sich eine loyale Gefolgschaft, eine Klientel, aufzubauen. Mit Sicherheit trifft dies zu, da dies den Gepflogenheiten römischer Staatsmänner entsprach. Trotzdem war seine Politik mutig.
Seine Verfahrensweise verschaffte Pompeius nicht nur Vorteile, sondern trug ihm auch erhebliche Kritik ein. In Rom hießen der Senat und die Ritterschaft die ungewöhnlichen Gnadenakte Pompeius’ nicht gut. Viele Römer forderten eine grausame Bestrafung der Seeräuber und bevorzugten die Methode des Feldherrn Metellus, der seit 68 v. Chr. einen blutigen Krieg gegen Kreter und Kilikier führte.
Metellus hatte schon vor Beginn von Pompeius’ Piratenkrieg ein Imperium erhalten, um die Seeräuber auf Kreta zu bekämpfen. Da die kretischen und kilikischen Piraten von Pompeius’ Milde gegenüber den Seeräubern gehört hatten, beschlossen sie, sich ihm zu unterwerfen. Dies ließ Metellus jedoch nicht zu. Ungeachtet der Intervention Pompeius zugunsten der Kreter setzte sich Metellus durch und unterwarf Kilikier und Kreter durch Schwert und Kreuzigung.
Der Rückschlag auf Kreta tat der Beliebtheit Pompeius’ in Rom allerdings keinen Abbruch.
Als Pompeius im nächsten Jahr weitere Vollmachten forderte, um endlich Mithridates zu vernichten, verabschiedete die Volksversammlung nach feuriger Fürsprache Ciceros das nötige Gesetz. Dies hatte zur Folge, dass Lucullus, der bisherige Feldherr im Kampf gegen Mithridates, durch Pompeius ersetzt wurde.
Damit war der ehrgeizige Feldherr endlich am Ziel seiner Wünsche. Wie schon in Spanien, Italien und im Mittelmeer gelang Pompeius auch in Asien, was so vielen vor ihm verwehrt geblieben war. Nach einem mehrwöchigen Feldzug schlug er Mithridates so entscheidend, dass der Todfeind Roms sich nur durch Flucht nach Pontos retten konnte. Diesmal, nach 40 Jahren Krieg gegen Rom, verließ Mithridates das Glück. Verlassen von allen Getreuen, verraten vom eigenen Sohn, der ihn an Rom ausliefern wollte, ließ er sich von einem Untergebenen mit dem Schwert durchbohren.
Endlich hatte Pompeius erreicht, was er wollte. Als er im Jahr 61 v. Chr. nach Rom zurückkehrte, befand er sich auf der Höhe seiner Laufbahn. Ganz Rom jubelte ihm und seinen zurückkehrenden Legionen zu. Stolz marschierten sie durch die Straßen.
»Für den ganzen Umfang des Triumphes, obwohl er auf zwei Tage verteilt wurde, reichte die Zeit nicht aus, sondern es musste vieles von dem für die Schau Vorbereiteten wegfallen, was als Schmuck und Zierde für noch einen Triumph genügt hätte. Auf vorangetragenen Tafeln waren die Länder und Völker verzeichnet, über die er triumphierte. Es waren die folgenden: Pontos, Armenien, Paphlagonien, Kappadokien, Medien, Kolchis, die Iberer 26, die Albaner 27, Syrien, Kilikien, Mesopotamien, Phoinikien und Palästina, Judäa, Arabien und die Gesamtheit der Seeräuber, die er zu Wasser und zu Lande niedergekämpft hatte. In diesen Ländern waren nicht weniger als tausend feste Burgen und nicht viel weniger als neunhundert Städte erobert worden, die Zahl der genommenen Seeräuberschiffe betrug achthundert, die der neu angelegten Städte neununddreißig.« 28
Das Ausmaß von Pompeius’ Eroberungen war beträchtlich. Seine größte Leistung und sein brillantester Feldzug blieb jedoch der Krieg gegen die kilikischen Piraten.
Die Behauptung, Pompeius habe das Mittelmeer von Piraten gereinigt, trifft nicht zu. Natürlich war die Piraterie mit einem Feldzug allein nicht zu bezwingen. Noch in den 50er-Jahren v.Chr. kam es mehrfach zu Raubzügen von Piraten.
Trotzdem ist die Leistung Pompeius’ unbestritten. Nur ihm war es zu verdanken, dass eine derartige Bedrohungslage wie zur Zeit der Kilikier für die Dauer von 400 Jahren vom Mittelmeer abgewendet wurde und sie nur noch lokal und begrenzt Fuß fassen konnten.
Siege sind vergänglich. 13 Jahre nach Pompeius’ Triumphzug schlug Julius Cäsar bei Pharsalos die Republikaner unter Pompeius derartig vernichtend, dass der einstige Bezwinger der Kilikier panikartig die Flucht ergriff. In seiner Verzweiflung wandte sich Pompeius mit seiner Familie nach Ägypten, um mithilfe prorepublikanischer Einheiten eine neue Armee aufzubauen. Doch das Glück hatte den Feldherren verlassen. Noch bevor Pompeius überhaupt ägyptischen Boden betreten konnte, wurde er hinterrücks erstochen.
Einer der Augenzeugen des Mordes war sein dreizehnjähriger Sohn Sextus. Paradoxerweise war es ihm in den folgenden Wirren des Bürgerkriegs beschieden, der kilikischen Piraterie ein letztes Mal neuen Aufwind zu geben.
In den Jahren 42–36 v. Chr. wiederholte sich noch einmal das Szenario eines Seekriegs. Wieder wurden die Küsten der Römischen Republik verheert und Getreidetransporter gekapert. Trotzdem war der Kaper- und Blockadekrieg von Sextus Pompeius gegen Octavian und Marcus Antonius nicht mit den Kilikierraubzügen zu vergleichen, auch wenn Octavians Propaganda Pompeius’ Sohn zum Piraten stempelte.
Der Krieg zwischen Sextus Pompeius und Octavian war die letzte Phase des römischen Bürgerkriegs und Sextus Pompeius der letzte vom römischen Senat ernannte Flottenpräfekt. Daran ändert auch nichts, dass in seinen Reihen einstige kilikische Piraten wie Menas und Menekratos kämpften, die sogar Admiralsposten bekleideten.
Aber Geschichte wird von den Siegern geschrieben und der Gewinner dieser Auseinandersetzung hieß Octavian. 36 v. Chr. schlug sein Vertrauter Marcus Agrippa die Flotte von Sextus Pompeius derartig vernichtend in der Seeschlacht von Naulochos, dass der Sohn des Piratenbezwingers die Flucht nach Kleinasien ergriff. Dort wurde der letzte Flottenpräfekt der Römischen Republik ergriffen und ohne Prozess im folgenden Jahr hingerichtet. Als Octavian, der sich später Augustus nannte, seine Taten in den berühmten »Res Gestae« verherrlichte, brüstete er sich damit, die Meere von den Seeräubern befreit zu haben. Auch wenn dies im Fall des Sextus Pompeius nicht zutrifft, so macht es doch klar, was für einen Stellenwert die Piratenbekämpfung und damit die Seeherrschaft in Rom erlangt hatte.
Im Gegensatz zum Ärmelkanal, wo die Sachsen im 3. und 4. Jahrhundert so heftige Überfälle verübten, dass die Römer sogar eine Kette von Verteidigungsanlagen – den Litus Saxonicum – zu beiden Seiten des Ärmelkanals in Britannien und Gallien errichteten, blieb das Mittelmeer ein römisches Meer: das »Mare Nostrum«. Es war der Bereich, in dem zur See für weitere 450 Jahre fast ununterbrochener Frieden herrschte.
Einzig im 3. Jahrhundert trübten vereinzelte Raubfahrten von Franken, Skythen und vor allem Goten den ewig anmutenden Frieden des Mittelmeers, wobei ein gotischer Raubzug von 267 n. Chr. besonders hervorstach. Angeblich sollen in diesem Jahr 100 000 Goten in Tausenden von Schiffen die Küsten der Adria verheert haben. Diese Zahl gehört mit Sicherheit ins Reich der Legende, beweist jedoch den Schrecken, den dieser Barbareneinfall zur See unter den römischen Chronisten auslöste.
Nichtsdestoweniger gelang es den Römern im Großen und Ganzen, das Mare Nostrum vor Piratenhorden zu beschützen. Dies änderte sich erst, als das Weströmische Reich im 5. Jahrhundert zusammenbrach und die Vandalen nach langer Wanderung durch Europa erst die Provinz Afrika besetzten und dann Rom angriffen.
II
Europa im Würgegriff der Piratenvölker
Читать дальше