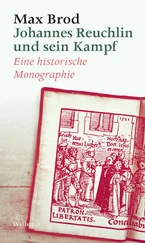Stenzel runzelte die Stirn und stieg in den Wagen. Es mußte in den engen Gassen, deren Pflaster zum Teil aufgerissen war, vorsichtig und mit manchen Umwegen gefahren werden. So kam man nur langsam vorwärts. Stenzel war es recht. Seine Stimmung, eben noch beschwingt und selbstzufrieden, verschlechterte sich schnell. Er schloß die Augen und hatte plötzlich wieder das Bild dieser zitronengelben Hauswand mit den graugrünen und kreidigen Streifen vor sich. War sie nicht ein Gleichnis des Lebens selbst? Man kann noch so sehr auf Ordnung und Sauberkeit bedacht sein: es kommen Dreck und Gemeinheit, und alles wird eine üble Sauce! Aber ist das, was wir dagegen anwenden, so folgerte er, vielleicht eine weniger große Gemeinheit? Vergifteter Weizen! Gasangriffe gegen unschuldige Vögel, nur weil ihr Stoffwechsel uns nicht paßt! Und der unsere? Steht uns ein größeres Recht auf ihn zu? Wenn nun irgendeine höhere Macht uns mit gleicher Münze heimzahlen würde? Will denn nicht alles, was Kreatur heißt, nur leben und wieder leben, um jeden Preis?
Johann Sebastian Stenzel wischte sich mit der Hand über die Stirn. Da war wieder der Stachel, der seit vorgestern sein Hirn marterte. Man konnte ihn für Augenblicke einschläfern, beschwichtigen, betäuben, aber man konnte ihn nicht wegwischen oder auslöschen. Nur noch ein Jahr zu leben! Nein! Nicht einmal das! Zwei Tage weniger als ein Jahr! Vorgestern hatte er den Traum gehabt. Zwei volle Kalendertage waren vorbei! Oder nicht? Mein Gott! Fing er denn an verrückt zu werden? Das drehte sich wie ein Feuerrad um eine glühende Achse! Funken sprühten! Jeder Funke brannte ein kleines, winziges Loch ins Gehirn, bis eine Art von Sieb daraus wurde. Durch jedes Loch dieses Siebs tropfte, sickerte, schwitzte es: Kein Jahr mehr zu leben!
Stenzel trommelte sich mit den Fäusten vor die Stirn. Fort damit! Er befahl es sich, er, Johann Sebastian Stenzel, der sich so viele Jahre tagaus, tagein Befehle gegeben hatte, dies zu tun oder jenes zu unterlassen! Und hatte nicht das Tier in ihm, die Bestie da innen, der Untermensch im Sonnengeflecht, den es zu bändigen galt, noch stets gehorcht? Woher mit einemmal diese Rebellion?
Er schnellte in die Höhe. Haltung! Welch ein Glück, daß er im geschlossenen Wagen fuhr! Wenn jemand wahrgenommen hätte, daß Generalkonsul Stenzel sich mit den Fäusten gegen die Stirnhöhle trommelte! Wie ein Bankrotteur! Das Wort zischte ihm wie eine Peitschenschnur um die Ohren. War er das nicht in der Tat? Ein Bankrotteur des Lebens! Warum nur dieser Esel, dieser Dombrowski, in solchem Leichentrott fuhr? Er schob mit einem heftigen Ruck die Vorderscheibe zurück.
„Tempo, Dombrowski! Tempo! Schlafen Sie denn?“
Dombrowski gehorchte. Der Wagen machte einen Satz. Stenzel flog in die Polster zurück. Tempo! Das Wort tat ihm wohl. Es war die Parole seines Lebens gewesen. Tempo und Arbeit! Arbeit und Tempo! Er fühlte sich plötzlich ruhiger geworden. Was für eine geheime Kraft doch in solch einem Wort steckt! Wie eine Zauberformel hatte das Wörtchen Tempo die bösen Geister der Tiefe beschworen. War es nicht eben das, was ihm schon vorgestern Trost gebracht hatte? Sollte man nicht, was einem an Zeit genommen wird, durch Tempo wieder einbringen können? In einem Jahr zehnfach gelebt, ist das nicht ebensoviel wie zehn Jahre normal gelebt? Zehnmal eins oder einmal zehn: die Summe ist gleich.
„Ein Stenzel hat Haltung zu bewahren!“ murmelte Stenzel, und seine Sehnen strafften sich. Der Schweiß rann ihm von der Stirn. Er merkte es kaum. Jene vielfach gesprenkelte Hauswand tauchte wieder vor ihm auf. Er hatte sie als ein Sinnbild des Lebens empfunden. Erst jetzt begriff er, welch ein Tiefsinn in dem Gedanken steckte. Er lachte so laut, daß Dombrowski vorn sich einen Augenblick umdrehte. Stenzel kümmerte sich nicht darum. Er dachte an den alten Scherz von der Hühnerleiter und dem Leben und worin sie sich gleichen. Er erinnerte sich, daß er in seiner Schülerzeit sehr über den Witz gelacht hatte. Und so gymnasiastenhaft es auch war, er mußte von neuem über die Ideeverbindung lachen, obwohl ihm eine Stimme sagte, daß er im Grunde über sich selbst lache. Dombrowski hörte ihn in sich hineinkichern und kam zu dem Schluß, das längst Erwartete sei endlich eingetreten: der Generalkonsul habe den Verstand verloren.
Stenzels Haus stand unfern der Promenade, die jenseits der Bahngeleise und des ehemaligen Stadtgrabens am Saum der die Stadt überhöhenden Hügelkette als eine Art von Aussichtsterrasse sich ein Stück weit hinzieht. Man erblickt von dem höchsten Punkt dieses einstigen Festungsglacis die türmereiche Stadt, gleichsam zu einer Faust zusammengeballt, die gebieterisch sich aus dem Sumpfboden über Land und See hinausreckt und selbst dem vom Element des Meeres getränkten Himmel zu trotzen scheint. Der Generalkonsul hatte einen Platz unweit dieses Punktes gewählt, als er vor langen Jahren darangegangen war, sich eine Wohnstätte zu erbauen, die seiner würdig wäre. Es war ein Platz zum Hinunterschauen auf alle jene, die in der Tiefe geblieben waren, weil sie sich allzuviel Zeit im Leben gelassen und Arbeit nicht mit jenen drei r geschrieben hatten! Ein Platz in der Fremdenloge gleichsam, wo einem niemand mehr auf die Füße tritt und das ehrerbietige Gemurmel aus dem Stehparterre wie Musik in die Ohren klingt. Von diesem Platz pflegt man den besten Überblick über die Bühne zu haben. Für den Generalkonsul und Hauptinhaber der seegewaltigen Schifffahrtsgesellschaft war die alte, wehrhafte Stadt solch ein Bühnenschauplatz, an dem sein Herz sich stärkte, sooft er hinuntersah. Sie hatte unermüdlich geschafft, gewagt, getrotzt, gepflanzt, gebaut, gearbeitet, diese stachlige Stadt! Ganz wie er selbst! Auch in diesem Sinne gehörten sie beide zusammen, er hier oben in seinem Kontor und sie dort unten mit ihrem Hintergrund von Hafen und See.
Zu diesem Selbstgefühl des merkwürdigen Mannes stand das Haus, das er sich erbaut hatte, in einem absonderlichen Gegensatz. Es wirkte mit seinen engen, niedrigen Zimmern, mit seinen aufs genaueste errechneten Ausmaßen, mit der peinlich eingehaltenen Raumausnützung wie eine in viele kleine Kojen abgeteilte Schiffskajüte. Auf dem Grundstück, zu dem auch ein verwilderter Park gehörte, wäre Platz genug gewesen, um einen Palast für den ungekrönten König der Stadt zu errichten. Aber wie wenig hätte das zu der in allem Selbstbewußtsein sich bekundenden Schlichtheit des Dorfschulmeistersohnes gepaßt! Nichts wäre ihm verdrießlicher gewesen, als wenn man ihm Dünkel, Anmaßung, Überhebung, Emporkömmlingstum vorgeworfen hätte. Mit den herausfordernden Lebensformen des neuen Reichtums, den man allenthalben sich brüsten sah, wünschte ein Johann Sebastian Stenzel in keinen Vergleich zu treten. So kam es, daß die Behausung des Seebeherrschers auf der Höhe über der Promenade eher wie ein Zwergenhäuschen sich ausnahm und angesichts der in der Tiefe daliegenden Stadt sich gleichsam niederzukauern schien.
Dabei gab es im Innern viel Bequemlichkeit, wenn auch in einem schon älteren Zeitgeschmack. Den besonderen Stolz des Generalkonsuls bildeten die zahlreichen Klubsessel, Sofas, Polsterstühle, Ottomanen und türkischen Diwane, die überall in den Zimmerchen oder Kabinen herumstanden und eigentlich zu fortgesetzter Faulenzerei einluden. Auch das gehörte zu den vielen seltsamen Widersprüchen in Stenzeis Charakterbild, so daß Besucher schon gefragt hatten, wie denn eigentlich diese Attribute des Müßigganges sich mit der stadtbekannten Unermüdlichkeit ihres Inhabers vereinbaren ließen. Der kleine, quecksilberne Mann hatte darauf die schon geläufige Antwort, daß alles dies nur für seine Gäste da sei. Ihm selbst fehle es leider für die Benutzung seiner Sofas und Sessel an Zeit.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Читать дальше