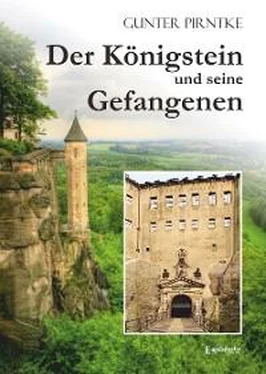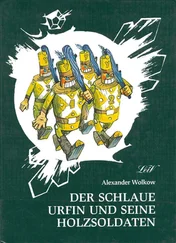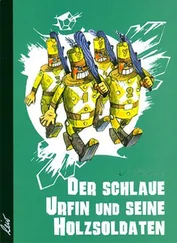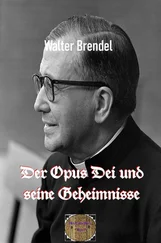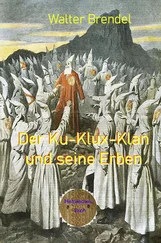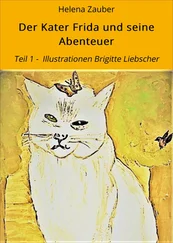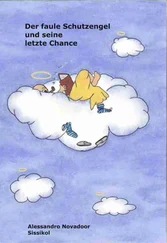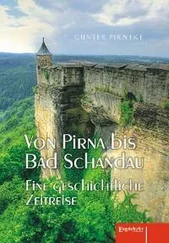Gunter Pirntke
DER KÖNIGSTEIN
UND SEINE GEFANGENEN
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2014
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.deabrufbar.
Copyright (2014) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelfoto © XtravaganT - Fotolia.com
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Cover
Titel Gunter Pirntke DER KÖNIGSTEIN UND SEINE GEFANGENEN Engelsdorfer Verlag Leipzig 2014
Impressum Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. Copyright (2014) Engelsdorfer Verlag Leipzig Alle Rechte beim Autor Titelfoto © XtravaganT - Fotolia.com Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) www.engelsdorfer-verlag.de
Einleitung
Der Adel schlägt zurück
Beichling und Genossen
Der diebische Bürgermeister
Die schwedische Geißel
Ein unbekannter Arrestant mit drei Dienern
Prinzliche Gefangenschaft
Die gefangenen Geheimen Räte
Der goldmachende Baron
Der Schwager der Gräfin Cosel
Der Reichsgraf aus Crostau
Ein Spion bei Brühl
Der Reformator der ersten Verfassung Sachsens
Die Kommunarden um Bakunin auf der Festung
Der sozialdemokratische Hochverräter
Und es saßen ein
Ein General ging stiften
Schlussbemerkungen
Danksagung
Quellenverzeichnis
Bilderverzeichnis
Endnoten
Fußnoten
Weitere Veröffentlichungen
Da die Festung Königstein für uneinnehmbar gehalten wurde, glaubte man, dass auch niemand von hier fliehen könne und nutzte sie als Gefängnis für Staats-, Bau-, Militär, Zivil- und Kriegsgefangene; darunter viele namhafte Persönlichkeiten.
Christian I. (* 29. Oktober 1560 in Dresden; † 25. September 1591 ebenda), welcher seit 1586 Kurfürst von Sachsen war, ließ ab 1589 die Festung nicht nur als uneinnehmbare militärische Anlage ausbauen und als Ort von Vergnügungen aller Art in der wundervollen Landschaft gestalten, sondern bald auch als ein Ort, an dem man unliebsame, in Ungnade gefallene oder Kapitalverbrechen begangene Menschen von allem gesellschaftlichen Umgang isolieren konnte.
Der erste Staatsgefangene, der auf den Königstein gebracht wurde, war Oberhofprediger Dr. Martin Mirus. Er ist im Gefangenverzeichnis noch nicht mit einer Nummer versehen. Dieses Verzeichnis umfasst 933 Einträge und endet mit einem gewissen Emil Eisenberger, der am 3. Juni 1922 auf dem Königstein gebracht wurde. Spätere Inhaftierte wurden dann anderweitig erfasst.
Ein förmliches Staatsgefängnis wurde erst zum Anfang des 17. Jahrhunderts in der Georgenburg angelegt und durch den Oberhofprediger Höe von Höenegg 1619 eingeweiht. Übrigens gibt es auch noch einige unterirdische Gefängnisse für gemeine Verbrecher wie das Mohrenloch und die Türkenkammer. Letzteres hat den Namen von einem Mann namens Türk, welcher den Kommandanten Wolf Friedrich von Beon, der die Festung um Holz und anderen Materialien betrog, indem er die größten Stämme gefällt hat und sie den Kurfürsten verkaufte. Beon wurde dafür am 17. Juni 1610 zwischen der Königsnase und Christiansburg an einem Baum gehängt, Türk aber in jenes unterirdisches Gefängnis geworfen und diejenigen 32 Knechte, welche bei jenen Betrügereien mitgeholfen hatten, kamen zum Festungsbau nach Dresden.
Die Zahl aller Staatsgefangenen vom Jahre 1591 (weiter reichten die Quellen nicht) bis zum September 1804 war 155. Hiervon sollten nur die Bekanntesten erwähnt werden.
Lässt sich auch von vielen, aus Mangel an Quellen, nichts Historisches beibringen, so veranlassen doch die bloßen Namen vielleicht schon manche Kenner der Materie, weiteres beizubringen.
Vollständige Biografien der Gefangenen liegen ohnehin nicht in den Festungsaufzeichnungen vor und auch im Sächsischen Staatsarchiv wird man nicht allzu sehr fündig. Wenn aber aus begreiflichen Ursachen manche Namen nur kurz abgefertigt werden, so ist es nicht dem Verfasser anzulasten. Wie alles in der Welt seine Grenzen hat, so hat es auch die historische Feder.
Doch zurück zu Mirus. Nach dem Tod seines Vaters und der Übernahme der Regierung 1586 zeigte Christian I. wenig Interesse an den Staatsgeschäften und gab sich Vergnügungen, vor allem der Jagd und dem Alkohol hin. Die Auseinandersetzung zwischen lutherischer Orthodoxie und dem an Melanchthon anlehnenden Philippismus (Die Bezeichnung geht auf Philipp Melanchthon zurück, der nach dem Tode Martin Luthers 1546 die Führungsrolle im Protestantismus übernahm und deren Linie bestimmte.), der während der Regierungszeit seiner Eltern geherrscht hatte, war Christian zuwider. Schon 1585 als Mitregent seines Vaters erließ er ein Gesetz gegen das Theologengezänk. Auch die von seinem Vater veranlasste Konkordienformel lehnte er ab.
Mirus begleitete 1575 den Vater des Kurfürsten, Kurfürst August, auf den Immerwährenden Reichstag zu Regensburg und hielt hier sieben scharfe Predigten gegen das Papsttum. Im Auftrag des Kurfürsten beteiligte er sich auch eifrig an der Konkordienformel vom Lichtenburger Konvent am 15. Februar 1576 bis zu dessen Vollendung.
1580 wurde Mirus Mitglied des Oberkonsistoriums in Dresden. Er genoss in hohem Grade das persönliche Vertrauen seines Fürsten und hat bei allen erfreulichen und traurigen Ereignissen in der kurfürstlichen Familie sein Amt als Seelsorger und geistlicher Berater mit großer Gewissenhaftigkeit verwaltet.
Als Mirus dann als Beichtvater von Christian I. den Kurfürsten wegen dessen calvinistischen Bestrebungen zur Rede stellte, wurde er mehrfach vernommen, als Hofprediger entlassen und auf Betreiben von Kanzler Krell am 29. Juli 1588 auf die Festung gebracht. Nachdem er seine Verfehlungen eingestanden hatte, konnte er am 16. November 1588 die Festung verlassen und ging nach Jena. Nach dem Tod von Christian I. 1591 holte ihn die Kurfürstinwitwe Sophie zurück und setzte ihn wieder in seine Ämter ein. Nun war es seinerseits Mirus, der nach dem Sturz von Kanzler Krell dessen Verbringung nach dem Königstein betrieb. Dazu in unserem erstes Kapitel mehr.
Von den insgesamt 993 Festungsgefangenen, die das Häftlingsbuch der Festung zwischen 1591 und 1922 verzeichnet, waren die meisten in der Georgenburg und im alten Zeughaus inhaftiert. Aus dieser großen Zahl sollen nur einige Wenige genannt werden, die wie Kanzler Krell im Bewusstsein der Menschen geblieben sind, die einen festen Platz in der sächsischen Geschichte haben und deren Namen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Da wurde am 27. Oktober 1632, mitten im Dreißigjährigen Krieg, der Prager Jurist Dr. Joachim Kratz auf Befehl von Kurfürst Johann Georg I. von der Burg Hohnstein auf den Königstein verlegt und im Krellturm „über den Gemach, da D. Krell gesessen“, verwahrt. Kratz war auf dem Landtag 1631 in Leipzig, auf dem der Kurfürst mit seinen Landständen über einen Wechsel von der katholischen Liga zu der evangelischen Union beriet, als Spion des Kaisers entlarvt und verhaftet worden. Nach 18 Jahren Haft auf dem Königstein kam er schließlich nach dem Westfälischen Frieden auf Ansuchen Kaiser Ferdinands III. am 15. März 1650 frei.
Als dann der starke August die Regierung übernahm, nahm die Zahl der Staatsgefangenen merklich zu. Es begann sogleich bei Übernahme der Regentschaft 1694 nach dem unerwarteten plötzlichen Tod seines älteren Bruders Johann Georg IV., zu dem er immer nur ein gespanntes Verhältnis hatte. Da wurde die Mutter der Mätresse Johann Georgs, Ursula Margarete von Neitschütz, und der Kammerdirektor Ludwig Gebhard von Hoym verhaftet und als Staatsgefangene auf den Königstein gebracht. Die gegen sie eingeleitete Untersuchung wegen Zauberei, in deren Verlauf sie 1695 mit Daumen schrauben und Schnüren gefoltert worden war, wurde auf Befehl des Kurfürsten, nachdem das Vermögen der Reichsgräfin von Rochlitz an den Fiskus zurückgelangt war, eingestellt. Die „Generalin“ Neitschütz wurde aus der Haft
Читать дальше