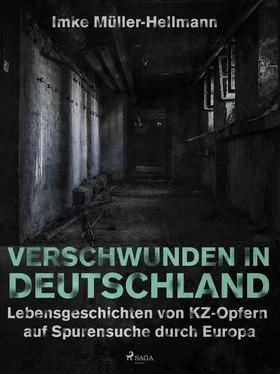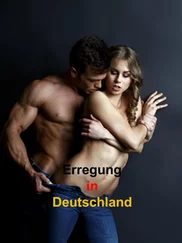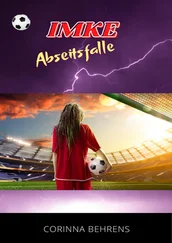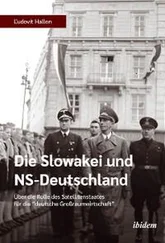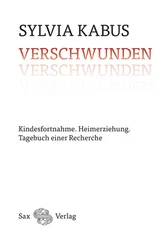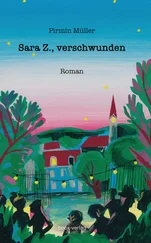187 Tote, schreibt Janßen, seien bekannt. Auf dem Gedenkstein in Engerhafe ist es ein Name mehr. Ich habe die Namen auf einem Zettel in meiner Hosentasche, ich habe sie vorgelesen, auf Lesungen, alle 188 hintereinander, immer war es sehr still im Raum. Nach jedem Vortragen habe ich mich gefragt, was das für Menschen waren, die in Engerhafe ihr Leben ließen, was ihre Lebensgeschichten waren, wer sie vermisste. Die Nachfahren, so dachte ich, müssten doch irgendwo sein, irgendwo ihre Kinder. Ich würde sie gerne treffen und nach ihren Vätern und Großvätern fragen. Doch wo finde ich sie?
Ich verlasse das Ausstellungsgebäude und überquere den Platz. Die Sonne steht tief, Güllegeruch liegt in der Luft, und ich laufe die Straße, auf der auch der Bus gefahren war, ein bis zwei Kilometer hinunter. Sie ist schnurgerade, links trennen Eichen den Asphalt von dem in der Nachmittagssonne liegenden Feld und rechts trennen ein Graben und eine Reihe von Pappeln die Straße vom KZ-Gelände. Ein Wachturm ist erhalten und das alte Klinkerwerk. Auf einer Gedenktafel steht, dass es 106 000 Menschen waren, die das KZ durchliefen, und mindestens 42 900 ließen dabei ihr Leben. Andere Schätzungen sprechen von 55 000. Ein Weg führt zu einer Figur aus Bronze, sie liegt verdreht auf dem Boden, die Rippen schauen hervor und der Kopf liegt auf der Erde. Auf den Knien stützt sie sich ab, ein Arm ist ausgestreckt und die Finger der Hand sind gespreizt. »Der gestürzte Häftling« heißt die Skulptur von Françoise Salmon, eine französische Bildhauerin, die mehrere KZs überlebte. Eine hohe Stele daneben trägt große Lettern: »Euer Leiden, euer Kampf und euer Tod sollen nicht vergebens sein.«
Das Haus des Gedenkens ist ein quadratischer Raum, der eine umlaufende höhere Ebene hat, an deren dunkelrot gestrichenen Wänden meterlange weiße Stoffbahnen hängen. Alle bekannten Namen der Toten sind schwarz und chronologisch nach Todestagen untereinander aufgedruckt. An einigen Stoffen hängen Fotos und Blumen oder Grüße auf Papier. Cinja van Laaten schreibt in Kinderschrift an Johann van Laaten: »Du hast alles richtig gemacht. Ruhe in Frieden. Tod mit 32 Jahren.« Unten im Raum gibt es einen Tisch, auf dem vier in weiß-beiges Leinen gebundene, fotoalbenähnliche, schwere Bücher liegen: Die Totenbücher des KZs Neuengamme. Den Toten I bis IV steht auf den abgegriffenen Einbänden, jedes Buch hat 500 Seiten. Ich ziehe den Zettel aus meiner Hosentasche, ich falte ihn auseinander, setze mich und fange an: Bertulis Veinsberg. Ich finde ihn genauso geschrieben, wie auf dem Stein in Engerhafe, dazu die Information, dass er am 31. August 1903 in Lettland geboren wurde und dass er am 20. Oktober 1944 starb. Der zweite Tote in Engerhafe war Cervil Paul Edjes. Ich finde ihn nicht, vielleicht ein Buchstabendreher, ich überfliege seitenweise Eintragungen mit E, es dauert sehr lange. Edzes, das könnte er sein, Gerrit Paul Edzes, Buchhändler, geboren am 24. Dezember 1913 in Groningen, gestorben am 31. Oktober 1944. Ich notiere alles mit Bleistift auf den Zettel hinter den Namen. Dann der dritte, Chaiw Jorkelski. Ich suche, ich finde ihn nicht, womöglich wieder ein Buchstabendreher, ich überlege, wie man die Buchstaben in welche Richtung verdreht haben könnte, blättere und überfliege, endlich habe ich ihn, Chaim Iskolski, Bäckermeister aus Mir, geboren am 20. Mai 1904. Der Museumsangestellte tippt mir auf die Schulter, es ist Schließzeit. Ich habe drei von 188 Namen gefunden und dafür über eine Stunde gebraucht, ich werde noch Tage an diesen Büchern verbringen. Ich frage ihn: »Gibt es die Namen auch im Netz?« Er schüttelt den Kopf, aber verschwindet in seinem Aufseherhäuschen und kommt mit einer CD-ROM wieder, die ich erwerbe und mit der ich viele Abende zu Hause verbringen werde.
Der Aufseher schließt hinter mir die Tür und ich setze mich auf die Bank in der Bushaltestelle. Die Sonne scheint tief über dem Feld und ein Traktor fährt in der Ferne langsam vor einer Baumreihe entlang. Ich habe die Arme vor der Brust verschränkt, ich sehe der Sonne lang zu, und dann fasse ich einen Entschluss: Ich werde Nachfahren finden, ich werde sie besuchen und sie nach den Lebensgeschichten ihrer Angehörigen fragen.
11 von 188
Pieter van der Weij war Drucker. Er wurde am 25. September 1910 von Klasina van der Weij, ehemals Kuipers, in den Niederlanden geboren und er lebte in Friesland, oben im Norden. Er arbeitete in der Druckerei seines Vaters Tiede und er hatte drei Brüder: Sjouke, Theunis und Klaas. Theunis und Klaas waren Zwillinge. Seine Schwestern waren Feikje und Sjoukje, Feikje war die Älteste der Geschwister und Sjoukje die Jüngste, sie lebt heute noch. Pieter heiratete Jakobje Kollen, gerufen wurde sie Jouk, und Jouk gebar vier Kinder: Greet, Ini, Tiede und Willy.
1940 war Pieter van der Weij 30 Jahre alt und wurde zum dritten Mal Vater, sein Sohn Tiede kam auf die Welt. In diesem Jahr bombardierte Deutschland die Stadt Rotterdam und besetzte die ganze Region. Die Deutschen blieben bis 1945 und ermordeten 112 000 jüdische Niederländer, dazu Sinti und Roma, Kommunisten und andere Menschen, die gegen sie waren. Die anderen Niederländer kooperierten oder taten so, als würden sie kooperieren, während sie Menschen versteckten: Juden und Zwangsarbeitsverweigerer, Deserteure, Kriegsgefangene und vom Himmel heruntergeholte alliierte Soldaten. Viele versteckte Juden waren in die Niederlande geflohen, in Amsterdam saß ein Mädchen aus Frankfurt 25 Monate in einem Versteck im Hinterhaus und schrieb in ein Tagebuch, das war Anne Frank. Als die Deportationen in den Niederlanden begannen, im Februar 1941, organisierten kommunistische Niederländer einen Generalstreik, den »Februaristaking«, zu dem Dirk van Nimwegen aufrief. Der Streik wurde blutig niedergeschlagen.
Pieter van der Weij arbeitete in dieser Zeit mit seinem Vater Tiede und seinen Brüdern Sjouke und Theunis in der familieneigenen Druckerei in Leeuwarden. Klaas nicht. Klaas wollte nicht Drucker sein, er hatte andere Pläne, doch es war Krieg und die Deutschen schickten ihn zur Zwangsarbeit nach Berlin. Der Vater und seine Söhne druckten Zeitungen, Zeitschriften und Bücher für die Deutschen, aber nicht nur, sie druckten auch andere Zeitungen, »Vrij Nederland« (Freie Niederlande) und »Trouw« (Treue), und die Inhalte dieser Blätter stimmten nicht mit den Zielen der deutschen Besatzung überein. Es ist nicht bekannt, ob Tiede und seine Söhne das vorher lange überlegt und abgewogen haben, ob sie mit Klasina in der Küche saßen und diskutierten, ob Tiede das alles allein beschloss oder ob es nichts zu beschließen gab, weil er wusste: Das musst du jetzt tun. Bekannt ist, dass Zeitungen viele Verteiler brauchen, und dass ein Verteiler in die Hände der Deutschen fiel und man ihm versprach, ihn zu verschonen, wenn er den Namen der Drucker verrate. Er verriet sie, doch gerettet hat ihn das nicht.
Pieter fuhr am Morgen des 20. März 1944 zur Arbeit. Er saß auf dem Fahrrad und er hatte ein Brot auf dem Gepäckträger und winkte Jouk zu. Das war das vorletzte Mal, dass sie ihn sah. Sie war schwanger und ihr Sohn Tiede war vier. Das letzte Mal sah Jouk Pieter am Zug, mit dem die Deutschen den Vater und die Brüder verschleppten. Jouk stand auf dem Bahnsteig und schrie. Sie war außer sich. Aus dem Durchgangslager schrieb Pieter Briefe nach Hause, er fragte darin, wie Tiede sich auf dem Dreirad mache.
Die Brüder und der Vater wurden in eins von fünf deutschen KZs innerhalb der Niederlande gebracht, Kamp Vught bei ’s-Hertogenbosch. Dann brachte man sie in das KZ Sachsenhausen, nördlich von Berlin, und dann trennte man sie. Pieter und Theunis kamen nach Neuengamme in Hamburg, Sjouke nach Bergen-Belsen bei Celle, Vater Tiede nach Groß-Rosen in Polen. Tiede starb in Groß-Rosen am 22. Januar 1945, morgens, kurz nach halb sechs. Akute Darmentzündung, Abmagerung und Herzschwäche wurde im Totenbuch von Groß-Rosen notiert.
Читать дальше