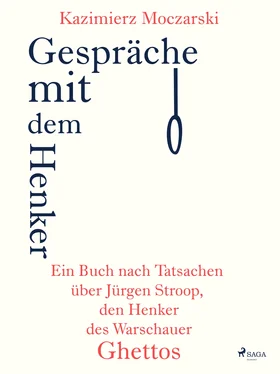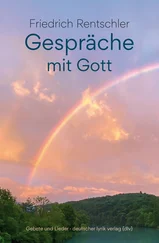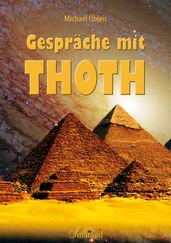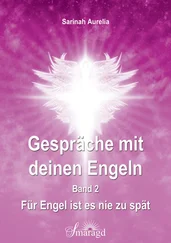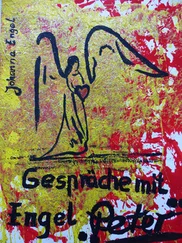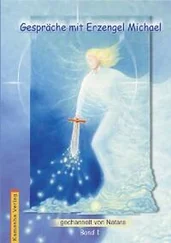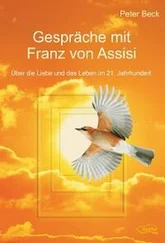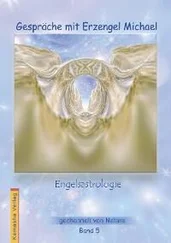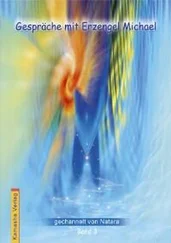Außerdem war ein Teil der Bevölkerung aktiv mit den traditionellen Parteien verbunden. Die einen waren Anhänger der SPD oder KPD. Und andere, Gewerkschaftsfunktionäre, Mitglieder kultureller Verbände oder Sportvereine, widersetzten sich einer Gleichschaltung im Rahmen der Partei des künftigen Diktators. Dadurch war die psychologische Transfusion, von der Hitler (und auch Stroop) träumten, in Lippe nicht ganz widerstandslos durchzuführen. Und in dem Maße, in dem die Agitation immer schärfere Formen annahm, waren immer weniger Bürger bereit, eine weltanschauliche Bluttransfusion an sich vornehmen zu lassen, obwohl die ideologischen Sanitätswagen der Nazis mit laufendem Motor vor der Tür warteten.
In dieser Situation griffen die Nazis zum Mittel der Gewalt und Angst. Stroop gehorchte gern dem Befehl zur »Anwendung des Terrors«. Er hatte stets behauptet, die Partei gehe zu rücksichtsvoll vor, und dass man »die Dummen auch gegen deren anfänglichem Willen glücklich machen müsse« mit Hilfe von Befehlen und durch körperliche Kraft, alles im Namen der »wahren Idee«. Er liebte direkte Aktionen, was er häufig mit dem französischen Ausdruck »action directe« unterstrich.
Die action directe begann. Die Braunhemden und Totenköpfe wurden aktiv. Sie prügelten, brandschatzten, entführten Menschen. In Detmold breitete sich Angst aus, als bekannt wurde, dass die Nazis die Räume der Raiffeisen-Genossenschaft demoliert hatten und dass es zum Kampf zwischen den Hitler-Anhängern und Mitgliedern des »Reichsbanners 10« gekommen war. Es gab fünf Verletzte. Die Nazis zerschlugen Fensterscheiben im Haus der Genossenschaft und in den umliegenden Wohnungen. Sie schossen um sich, prügelten mit
Knüppeln und Schlagringen. Möbel und Akten der Genossenschaft wurden auf die Straße geworfen, die Papiere auf einem großen Holzstoß verbrannt. Sie tobten vor Wut und Freude.
Stroop stand mit seinem SS-Gefolge in der Nähe und beobachtete die SS- und SA-Männer, ob sie auch genügend kräftig zuschlugen und eifrig genug waren.
(Genau so wird er im April 1943 im brennenden Warschauer Ghetto alles genau beobachten.) Und einige Straßen weiter spazierten hohe Nazi-Funktionäre in Zivil durch das romantische Detmold und achteten darauf, dass Stroop und seine Untergebenen alle Befehle bis zum Letzten ausführten. (Im April 1943 werden Himmler, Krüger und andere Stroop pausenlos kontrollieren, ob er die Vernichtungsaktion an der Warschauer Bevölkerung perfekt durchführt.)
Einen Tag nach den Landtagswahlen liest Stroop im »Angriff« einen Artikel von Goebbels unter der Überschrift: »Signal Lippe!«. Goebbels unterstreicht darin die allgemeine Bedeutung der Wahlen, nennt keinerlei Einzelheiten der Aktion und bläst in das Horn des nationalen Triumphes. Dieser Artikel wird zur Ausgangsbasis für den politischen Kampf der folgenden Tage. Die NS-Reichspressestelle gibt bekannt, dass die NSDAP nach Überwindung vorübergehender Schwierigkeiten in eine neue Entwicklungsphase eintritt. Die nazistischen Tageszeitungen folgen den Direktiven Goebbels’ und erheben die Wahlen in Lippe in den Rang eines Volks-Referendums für die Machtübergabe an den Führer. Der »Sieg von Lippe« stärkt die Position Hitlers, Görings und Goebbels’ in den geheimen Verhandlungen mit einflussreichen Kreisen, die auf die NSDAP gesetzt haben. Während seiner Gespräche mit Hindenburg zum Beispiel beruft sich Papen auf die Wahlergebnisse von Lippe und erweckt den Anschein, als hätten sie die Bedeutung eines politischen Tests, wie etwa die Nachtragswahlen in Großbritannien oder den USA.
Der Erfolg der NSDAP ist das Tagesgespräch in Lippe. Auch das Ausland zeigt lebhaftes Interesse und ist über den »taktischen Wahltrick« von Lippe beunruhigt, da der Nationalsozialismus jetzt verkünden kann, dass er siegreich sei und vom deutschen Volk gebilligt werde.
»Manchmal kann ein gewöhnlicher Kirschkern über das Los einer nationalen Politik entscheiden«, schrieb damals eine europäische Zeitung, wobei sie mit dem »Kirschkern« den Freistaat Lippe und dessen Wahlen meinte. Man könnte mit dieser Verallgemeinerung einverstanden sein, unter der Voraussetzung jedoch, dass die Sache mit dem »Kirschkern« kein Zufall war, sondern ein politisches Werkzeug Hitlers darstellte, von seinen Verbündeten und Geldgebern voll akzeptiert. Als Folge wurde eine Scheinwahrheit, jener »Sieg von Lippe«, konstruiert und von der Propaganda verbreitet, wobei eine notwendige Antwort in Form von unverfälschten Informationen ausblieb. Es folgten Schachzüge und politische Machenschaften, wobei das Volk gleichzeitig mit aufregenden Parolen gefüttert wurde. Eine davon war der Ruhm von Lippe, das »den Willen des Volkes« bekundet hatte.
Man verlor keine Zeit mehr; am 30. Januar 1933 war es so weit. An diesem Tag legte der 86-jährige Paul von Hindenburg die Macht im Deutschen Reich legal in die Hände Adolf Hitlers und seiner organisierten Anhänger.
Am Tage der Machtübernahme durch Hitler zählte die SS in ganz Deutschland etwa 52000 nach »Blut und Rasse« ausgewählte Mitglieder. Nicht allzu viel, wenn man an Himmlers spätere Armee denkt. Bald aber wird sie wachsen, das Reich in Besitz nehmen wollen wie einst Preußens Armee Preußen als dessen, wie Mirabeau es ausdrückte, eigentliche »Besitzerin«. Innerhalb der Grenzen des »Kirschkerns« Lippe (es zählte knapp 1215 qkm und etwa 160 000 Einwohner) entfaltete Stroop eine emsige Tätigkeit. Er hatte Anteil an dem Erfolg, dessen Datum – 15. 1. 1933 – sich im Parteikalender der NSDAP wiederfand.
Und wieder ist Stroop im germanischen siebenten Himmel. Seine Verdienste sind bekannt. »Nach erfolgreicher Arbeit« erringt er das Wohlwollen der NSDAP-Spitze, knüpft Kontakte, Beziehungen, seine materielle Lage bessert sich zusehends. Er hat Geld, wird befördert. Am 15. Februar 1933, nachdem er wieder einen Dienstgrad übersprungen hatte, wird er SS-Truppführer. Die Detmolder Bürger grüßen ihn devot. Die Ehefrauen und Töchter bemühen sich über Frau Stroop um Protektion bei ihrem Mann. Er aber fährt immer häufiger über Land, zu den Bauernhöfen und Gutsbesitzern, besucht Schlösser und Feudalsitze; sogar der Fürst zu Lippe persönlich lädt ihn ein. Der Fürst bittet den SS-Truppführer Stroop zu sich, den Sohn eines ehemaligen Chefs der Polizeiwache. Er bietet ihm ein Glas Rheinwein an, und Stroop kehrt genauso strahlend heim wie vor Jahren sein Vater, der alte Oberwachtmeister Konrad.
Stroop besitzt nun schon mehrere Paar Stiefel und Galliffet-Hosen. Er reitet, sooft es ihm seine Zeit erlaubt. Er hat viel zu tun, denn die NSDAP segelt in starkem Aufwind, und befiehlt: handeln, handeln, arbeiten! Dem Feind keine Ruhe gönnen! Die Chance nützen, die Verfolgung verstärken! Marschieren! Zuschlagen, bis die Fetzen fliegen! Für Orden, Prämien und Beförderungen ist jetzt keine Zeit. Denn wir erleben die »große Wende, wie in Kriegszeiten«. Seht also zu, wie ihr fertig werdet, ihr dort am unteren Ende der Parteileiter!
Obwohl sich Stroop in der Zelle zu diesem Thema nie klar geäußert hat, nehme ich doch an, dass der künftige SS-Gruppenführer in jenen Tagen besonders intensiv an sich selbst und an das Wohl seiner Familie gedacht hat.
Anfang März 1933 widerfährt Stroop eine »große Ehre«: Er wird zum Führer der Hilfspolizei des Landes Lippe ernannt.
Knapp 14 Tage zuvor hatte Göring den regulären Polizeitruppen 50 000 SA- und SS-Mitglieder einverleibt, die die Reichshilfspolizei bilden sollten. An die abkommandierten SS- und SA-Leute wurden Waffen ausgegeben, sie erhielten weiße Armbinden und wurden rechtlich der normalen Polizei gleichgestellt, um diese »gesund zu machen«.
Wie wir sehen, nahm Stroop nun auch formellen Anteil an der steigenden Welle von Grausamkeit und Unrecht. Im Grunde war er schon vorher der Anführer der SS-Truppe im Land Lippe gewesen, die mit Gebrüll, mit Ausschreitungen, Terror, Folter und Verbrechen dem Führer und sich selbst einen Weg zu uneingeschränkter Macht gebahnt hatte.
Читать дальше