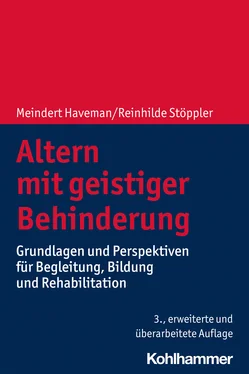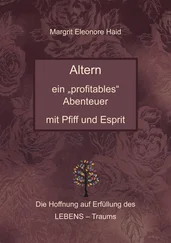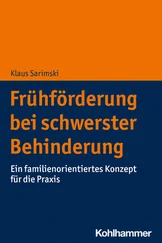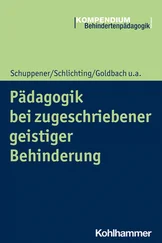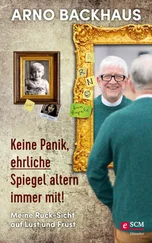So skizziert das erste Kapitel das Thema zunächst die Anfänge der Forschung und des systematischen Gedankenaustausches. In Kapitel 2 werden zentrale und grundlegende Aspekte zum Altersbegriff und Personenkreis erörtert. In Kapitel 3 werden aktuelle relevante Paradigmen der Geistigbehindertenpädagogik fokussiert. Das vierte Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Dimensionen des Alters: Biologische, psychologische und soziologische Aspekte werden unter besonderer Berücksichtigung von Menschen mit geistiger Behinderung beleuchtet. Darauffolgend gibt Kapitel 5 einen umfangreichen und differenzierten Überblick über verschiedene Alterserkrankungen. Eine häufig vorkommende Erkrankung bei Menschen mit Down-Syndrom, die Alzheimer- Erkrankung, wird in Kapitel 6 thematisiert. Es folgt ein weiteres zentrales Thema: der Übergang von der Arbeit in den Ruhestand, der im siebten Kapitel beschrieben wird. In Kapitel 8 geht es um Wohnen und Wohnformen bei älteren Menschen mit geistiger Behinderung. Die Bedeutung von sozialen Beziehungen und den Funktionen sozialer Netzwerke für Menschen mit geistiger Behinderung, insbesondere die Beziehungen zu Angehörigen, Mitbewohnern, Mitarbeitern etc. werden in Kapitel 9 geschildert. Kapitel 10 beschäftigt sich mit Bedeutung und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Eine zentrale Voraussetzung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stellt die Mobilität dar, die in Kapitel 11 mit ihren Einschränkungen bei älteren Menschen dargestellt wird. Als neues Thema wurden in Kapitel 12 assistive (unterstützende) Technologien für ältere Menschen mit geistiger Behinderung in den Blick genommen. In Kapitel 13 folgt die wichtige Thematik des Sterbens und des Todes: Sowohl Trauerverständnis als auch Trauerverhalten und Möglichkeiten der Auseinandersetzung bei Menschen mit geistiger Behinderung werden diskutiert. Abschließend werden in Kapitel 14 die Bedeutung und Möglichkeiten der Bildung bei erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung thematisiert und durch die Beschreibung des neu überarbeiteten Lehrgangs »Selbstbestimmt Älterwerden« konkretisiert.
Die theoretischen Ausführungen der Kapitel 3 bis 13 werden durch pädagogisches Handlungswissen mit vielfältigen wichtigen Hinweisen für die Praxis der Pädagogik und Rehabilitation bei älteren und alten Menschen mit geistiger Behinderung ergänzt.
Das Buch ist evidenzorientiert. Aussprachen und Informationen zu inhaltlichen Aspekten werden anhand der empirischen Fachliteratur dokumentiert. Dies kann für den Lesefluss störend wirken, gibt aber den interessierten und wissenschaftlich orientierten Lesern die Möglichkeit, die Aussagen im Kontext der jeweiligen wissenschaftlichen Quellen weiterzuverfolgen, um die Informationen des Buches für sich zu erweitern.
Aus pragmatischen Gründen wurden im Text oftmals nur die männlichen Formen benutzt, die selbstverständlich immer alle Geschlechtsformen einschließen (weiblich, männlich, divers).
Wir möchten es nicht versäumen, all denen zu danken, die uns bei der Entstehung des Buches unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt Dr. Melanie Knaup für die entspannte und überaus kompetente Unterstützung bei der Korrektur und für die sorgfältige Erstellung des Manuskripts.
Meindert Haveman und Reinhilde Stöppler
August 2020
1 Altern und geistige Behinderung
Das Interesse für das Thema »Altern« bei Menschen mit geistiger Behinderung ist vor allem aus sozio-demographischen Entwicklungen zu erklären, nämlich als Teil der gerontologischen Fachliteratur und der politischen Diskussion rund um die Konsequenzen für die Sozialfürsorge. Das Thema »Altern bei Menschen mit geistiger Behinderung« hat inzwischen einen anerkannten Platz in der Fachliteratur erhalten, aber die Resonanz des politischen Interesses ist noch relativ gering.
Die Bevölkerungsalterung betrifft alle Länder. Der Umfang der Bevölkerung wird weltweit im Jahr 2060 etwas größer sein, während die Altersstruktur viel älter sein wird als das jetzt der Fall ist. Die Bevölkerungsalterung hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesellschaften. Sie beeinflusst z. B. Bildungseinrichtungen, Arbeitsmärkte, soziale Sicherheit, Gesundheitsfürsorge, Langzeitpflege und die Beziehung zwischen den Generationen. Die Lebenserwartung bei der Geburt steigt in allen Teilen der Welt. Es wird erwartet, dass die Lebenserwartung in einem Zeitraum von 45 bis 50 Jahren weltweit um 10% zunehmen wird, mit einem Maximum von 18% für Afrika und 6% für stärker entwickelte (nicht notwendigerweise zivilisiertere) Länder (Haub, 2006). Mit Ausnahme von Japan liegen die 15 nach Bevölkerungsstruktur ältesten Länder der Welt alle in Europa. Japan hat die meisten alten Menschen, aber danach folgen direkt Italien, Deutschland und Griechenland. Die US-Bevölkerung ist im europäischen Vergleich relativ »jung«, weniger als 13% der Einwohner sind 65 Jahre oder älter. In Deutschland wird nach Prognosen die Altersgruppe der 60 bis 80-Jährigen von 21,8 Millionen im Jahre 2010 auf 29,4 Millionen im Jahre 2030 ansteigen. Bei der Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen ist sogar ein Anstieg von 4,5 Millionen (2010) auf 10 Millionen (2050) zu erwarten (Birg, 2011, S. 24f).
Es bestand jedoch relativ wenig Interesse daran, die Konsequenzen des Alterns für Menschen mit geistiger Behinderung zu untersuchen. Bis Anfang der 1980er Jahre war das Altern von Menschen mit geistiger Behinderung kaum ein Thema. In Deutschland und in anderen Ländern wurde in Fachzeitschriften und Büchern, auf Tagungen und Kongressen der Prozess des Altwerdens und die Lebenssituation des älteren Menschen mit geistiger Behinderung nicht oder nur marginal angesprochen. In Praxis, Forschung und Lehre wurde der Personenkreis der älteren Erwachsenen mit geistiger Behinderung kaum beachtet.
Das fehlende Interesse an dieser Zielgruppe vor 30 Jahren kann durch verschiedene Umstände erklärt werden. So war durch eine vergleichsweise geringere Lebenserwartung die Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung, die älter als 50 Jahre waren, relativ klein. Darüber hinaus waren damals ältere Menschen mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft kaum sichtbar, da sie permanent in großen Wohneinrichtungen und psychiatrischen Anstalten (vgl. Haveman, 1982; Haveman & Maaskant, 1992) verblieben. Von wesentlicher Bedeutung war jedoch die damalige Auffassung, dass der Mensch mit geistiger Behinderung ein »permanentes Kind« sei. Sogar der ältere Mensch wurde in seiner Persönlichkeit zu einem Kind mit einem »mentalen Alter« von 0 bis 4 Jahren reduziert, zu einem Kind, das in einer frühen Phase seiner Entwicklung stehengeblieben sei. Die Betrachtung der weiteren Lebensphasen war bei dieser Sichtweise kaum relevant, da diese nicht wesentlich zur weiteren Reifung und Bildung der Persönlichkeit beitragen.
1.1 Altersentwicklung in Deutschland
Die steigende Anzahl alter Menschen in Deutschland ist seit einiger Zeit zu einem der wichtigsten Themen der Sozialpolitik geworden. »Nicht nur der einzelne Mensch, sondern eine ganze Gesellschaft, beziehungsweise ein ganzes Volk altert« (Lehr, 1998, S. 17). Wie in der Einleitung aufgezeigt wurde, wächst die Anzahl älterer Menschen im letzten Jahrhundert kontinuierlich.
Als bedeutendster Grund für diese Entwicklung ist der medizinisch-technische Fortschritt zu nennen, wie z. B. der Einsatz von Medikamenten, Impfstoffen und technischen Hilfsmitteln. Weiter hat es schon fast ein Lebensalter lang keinen Krieg gegeben, in dem viele Soldaten und Zivilisten starben. Die Weltkriege 1914–1918 und 1939–1945 haben das Leben vieler Menschen frühzeitig beendet. Auch die verbesserten Lebensbedingungen, wie gesicherte Ernährung, geregelte Arbeitszeiten, hygienische Maßnahmen sowie wirksame soziale Sicherungen, haben das Phänomen der hohen Lebenserwartung begünstigt (Imhoff, 1997, S. 14). Dieser Anstieg der Lebenserwartung der älteren Menschen hat erhebliche Auswirkungen auf die Altersstruktur und die damit verbundenen sozialen Fragen. Die ältere Generation ist heute zahlenmäßig größer als frühere ältere Generationen; dies bedeutet unter anderem, dass es bei gleichbleibenden Bedingungen potentiell mehr Rentenbezieher gibt und der Ruhestand als Lebensphase länger dauert (Eisenmenger et al., 2006, S. 39).
Читать дальше