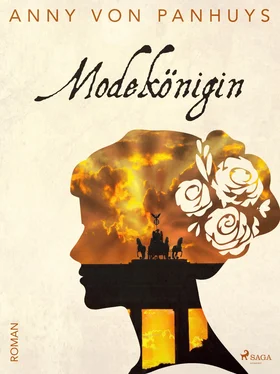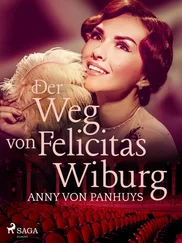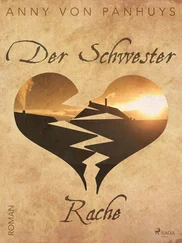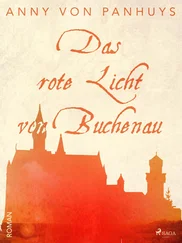Lili blickte die ihr Gegenübersitzende, die jetzt mit dem größten Appetit aß, beinahe entsetzt an.
„Nein, Emma, solche Männer habe ich noch nicht kennengelernt und will ich auch nicht kennenlernen!“
„Na, da kommst du schon noch zu, ob du willst oder nicht“, war die prompte Erwiderung, „die Sorte is dickfellig und es sind eine janze Menge dabei, die einem warmmachen können. Jott, unsereins möchte auch ein bißchen von alledem mitmachen, was bei die feinen Leute Selbstverständlichkeiten sind, und weil wir ahnen und wissen, als verheiratete Frauen kommen wir doch nich da ran, hilft man sich eben vorher. Ich hab jetzt ’nen Apotheker zum Freund. Ich kann den Kerl nicht leiden, er sieht aus wie ‘n Preisboxer und red’t Zeug wie ’ne olle Jungfer aus dem vorigen Jahrhundert. Aber jut is er und jeht mit mir überall hin, wohin ich will. Mußt mal mit uns ausjehen, Liliken, ein paar Jramm Berliner Nachtleben schlucken.“
Elisabeth war es, als sähe sie Heino Staufen vor sich.
Sie wehrte fast heftig ab.
„Nein, Emma, ich gehe da nicht mit.“ Sie sagte leise: „Ich war verlobt und hatte meinen Schatz lieb. Ich kann ihn nicht vergessen und habe gar keine Lust, mich zu amüsieren.“
Emma legte Messer und Gabel hin.
„Richtig verlobt warst du? Ja, warum bist du’s denn nich mehr? Rede doch, ich verrate es ja nich weiter.“
Elisabeth erwiderte hastig: „Ich sollte die Stellung hier bei Frau Weilert nicht antreten, das Wort Modekönigin hat ihn zornig gemacht. Er will nichts mehr von mir wissen und ist fort ins Ausland. Wohin? Ich weiß es nicht.“
„Na, so’n Affe, das is auch ’n Grund, ein schönes Wurm wie dir sitzenzulassen! Wer weiß, was der Junge noch sonst ausjefressen hat“, erregte sich Emma. „Aber weißt du, Liliken, einer, der dir wejen so ’nem Quark abwimmelt, an den hast du nix verloren, den laß ruhig laufen.“ Interessiert schloß sie: „Was war er denn eijentlich? Ich meine, von Beruf?“
Elisabeth gab Auskunft.
Emmas hübsch geschnittenes, volles Gesicht verzog sich ärgerlich.
„Buchhalter war er, weiter nischt? Da braucht er sich aber wirklich nich aufzuplustern wie ’n Fürst. Und den wolltest du heiraten und dir kujonieren lassen?“ Sie zog die Stirn kraus. „Ich jebe dir den Rat, wenn du dir jrämst, in den Spiejel zu kucken, damit du dir darüber klar wirst, was du wert bist. Laß ihn laufen und freue dir auf die Zukunft, die bestimmt noch allerhand mit dir vorhat.“
Elisabeth wußte, Emma meinte es gut mit ihr, aber Hilfe, Rat und Trost vermochte sie ihr auch nicht zu geben.
Sie versuchte das Gespräch auf ein anderes Thema zu bringen und war zufrieden, als es ihr gelang.
Emma begann von ihrem Freund, dem Apotheker, zu erzählen, mit der Figur eines Preisboxers und den Reden einer alten Jungfer aus dem vorigen Jahrhundert.
Sie wiederholte mehrmals lebhaft: „Ich kann den Kerl nich leiden!“
Elisabeth sagte schließlich: „Wenn du ihn nicht leiden kannst, solltest du aber mit ihm brechen!“
Emmas Gesicht drückte Betroffenheit aus und es war, als sinne sie tief nach.
Endlich erwiderte sie in sehr bestimmtem Tone: „Nee, Liliken, das jeht nich, er is so mordsmäßig verknallt in mir un täte mir leid. Das krieje ich nich zustande, dazu is er ein viel zu juter Mensch. Das muß ich ehrlich zujeben, wenn ich ihn auch nich leiden kann.“
Soviel Mitleid überstieg Elisabeths Begriffe.
Sie erklärte: „Wenn ich einen Mann nicht leiden könnte, wäre es mir unmöglich, mit ihm freundlich zu sein.“ Errötend schloß sie: „Und er wird dich doch auch wohl manchmal küssen?“
„Nich zu knapp!“ lachte die Dicke vergnügt. „Küssen und so allerhand is seine Hauptpassion und ohne hätte die janze Jeschichte auch ja keinen Sinn.“
„Aber bedenke, wenn du ihn nicht leiden kannst“, sagte Elisabeth kopfschüttelnd.
„Er tut mir leid, da opfere ich mich“, versicherte Emma ernsthaft.
Elisabeth staunte über soviel Opfersinn, aber fast noch mehr staunte sie darüber, daß Emma an Stelle des ständigen „mir“ das Wörtchen „mich“ angewandt hatte.
Sie konnte sich eine Bemerkung nicht versagen und Emma, die inzwischen beim Nachtisch angelangt war, nickte stolz: „Ich kann auch fein sein! Aber so vor alle Tage is es mit dem „mir“ bequemer. Ich finde, es paßt immer. Unsere Olle ärgert sich über mein „mir“ immer jämmerlich, un wenn ich die elejanten Fummels vorführen muß, wobei mir die reichen Madamkens so blödsinnig anstarren, dann paukt sie mir immer vorher ein: Emma, benimm dich! Nun, un denn benehme ich mir.“
„Benehme ich mich, heißt es doch“, verbesserte Elisabeth unwillkürlich.
„Weiß ich ja“, lächelte Emma und zeigte die hübschen Zähne, „aber jetzt sind wir doch unter uns, warum soll ich mir denn mit das dumme Mich anstrengen.“
Elisabeth mußte hellauf lachen. Sie konnte einfach nicht anders. Und dann lauschte sie förmlich erschreckt dem Klang ihres Lachens nach.
Wie viele, viele Tage hatte sie nicht mehr gelacht!
Emma nickte ihr erfreut zu.
„So is es recht, Liliken, der Mensch muß lachen, sonst wird er öde. Wenn man lachen kann, is man alles halb so schlimm. Lache recht viel, Liliken, damit jagst du den Kummer weg. Lachen is das beste Heilmittel der Welt.“
Elisabeth sah die Ältere dankbar an.
„Du hast recht, Emma, und fortan will ich mir Mühe geben, recht froh zu sein.“ Ihre Stimme zitterte merklich. „Ich muß ihn ja doch vergessen, es bleibt mir weiter nichts anderes übrig. Er hat mir einen Brief hinterlassen, in dem steht, er liebt mich nicht mehr.“
Emma brummte: „Also laß den Patentaffen laufen und paß auf, was ich dir sage: Um dir zu sehen, stehen die Männer noch an wie Sonntags an die Billettschalter nach Treptow oder Potsdam.“
Elisabeth zuckte die Achseln.
„Der Gedanke reizt mich gar nicht! Weil nicht er unter ihnen sein würde, den ich lieb habe.“
Tränen blitzten in ihren Augen.
Emma tröstete: „Laß man jut sein, Liliken, so was jeht auch vorbei, ich kenne das aus Erfahrung. Bei die erste Liebe stellt man sich immer so an, nachher is man nich mehr so empfindlich.“
Elisabeth schwieg. Emma hätte wahrscheinlich doch kein Verständnis, wenn sie sagen würde: Es gibt nur eine einzige wahre und echte Liebe!
Sie selbst war davon felsenfest überzeugt. Sie würde Heino nie vergessen können. Sie mußte ihn liebbehalten, obwohl er ihr geschrieben, er hätte sie nicht mehr lieb.
Ihre Liebe war echt, war groß. Ihre Liebe würde niemals sterben.
In ein ganz kleines Hotelchen der Wilhelminenstraße im Hamburger Stadtteil St. Pauli hatte sich Heino Staufen verkrochen. Er aß, trank und schlief und dachte zuweilen daran, daß er ins Ausland wollte, ohne aber zu wissen wohin.
Ein Tag verging nach dem anderen und er kam nicht weiter. Es war zuviel Unschlüssigkeit in ihm, die ihn zwischen allerlei Zukunftsplänen immer hin- und herriß.
Zuweilen überfiel ihn die Sehnsucht nach Elisabeth so stark, daß sie ihn wie ein Fieber schüttelte, aber er machte sich dann immer wieder klar, Elisabeth hatte ihn nicht wahr und aufrichtig geliebt, sonst hätte sie nicht direkt gegen seinen Wunsch und Willen gehandelt. Die blödsinnige, eitle Hoffnung, sich vielleicht die Krone der Modekönigin aufsetzen zu dürfen, hatte ihre Liebe schon umgeworfen.
Allzu standfest war sie also nicht gewesen.
Hätte sich Elisabeth an jenem unglückseligen Mittag vernünftiger gezeigt, wäre das ganze Unheil nicht geschehen, durch das nun vielleicht seine Zukunft zerstört wurde.
Er besaß kein Zeugnis über seine Arbeitsjahre bei Mosbach, er hatte in Untersuchungshaft gesessen, war dicht am Gefängnis vorbeigestreift und befand sich zwar in Freiheit, aber nur, weil man ihm die Unterschlagung nicht hatte beweisen können, die man ihm zur Last gelegt.
Читать дальше