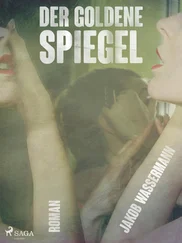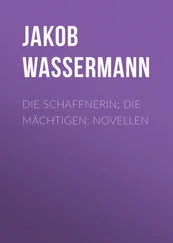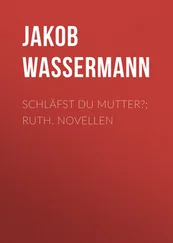Da sie in ihrer dreiundzwanzigjährigen Ehe eine so entschiedene Sprache zum erstenmal führte, schaute Mylius ausserordentlich verwundert empor. Er runzelte die Brauen, sah eine Weile wie suchend herum und murmelte durch die Zähne: „Wenn da nicht wieder das verdammte unruhstiftende Frauenzimmer dahintersteckt, will ich Zwillich heissen. Reden Sie keinen Unsinn, Frau Mylius. Geben Sie lieber acht, dass aus Ihrem Söhnchen kein Taugenichts wird.“
Christine wusste, dass Ulrike die Helferin gewesen war. Der Ausdruck ihres Dankes war nicht frei von Scham. Sie wusste auch von dem Diebstahl der Dose. Ausser sich vor Kummer wie vor Zorn über die grausame Züchtigung hatte Lothar es ihr zugeschrien; sie solle es dem Vater nur sagen, auch das; er fürchte sich nicht; wer ihn so geschlagen, könne ihn auch umbringen, der Unterschied sei nicht gar so gross.
Düster sinnend sagte Christine: „Ein ganz anderer Mensch. Nie hätte er gewagt, so zu mir zu sprechen. Und das Schreckliche ist, dass ich ihm in meinem Innern das Verbrechen nicht einmal so verübeln kann, wie ich müsste. Denn Verbrechen ist es und bleibt es. Da handelt sichs bloss um den ersten Schritt, hernach gibts kein Halten mehr. Ich fürchte, ich komme selber auf die schiefe Bahn; ich weiss schon nicht mehr, wie ich recht tue.“
„Um den Buben haben Sie keine Angst,“ beruhigte sie Ulrike etwas kalt; „der ist von guter Art und man kann ihn lenken. Ich habe mir sagen lassen, dass ganz ehrenwerte Staatsbürger in ihrer Jugend manchmal ein wenig über die Schnur gehauen haben. Das sind so moralische Masern. Seien wir froh, dass der verräterische Lump nichts von der Dose geschwatzt hat. Malen Sie sich aus, was geschehen wäre, wenn Herr Mylius das wüsste! Es graut einem beim blossen Gedanken.“
„Freilich ists ein Glück“, gab Christine zu: „aber was machen wir jetzt mit der verhängnisvollen Dose?“
„Die behalt ich vorläufig als Pfand,“ erklärte Ulrike lachend; „es wird sich schon eine Gelegenheit bieten, sie ihm wieder zuzuschanzen, ohne dass ers merkt. Es kommt ja vor, dass die Höhlenmenschen in ihrer Höhle schlafen.“
Christine stand am Fenster und mit Ulrike nur halb zugekehrtem Gesicht sagte sie traurig: „Wie gering Sie von ihm denken! Ich müsste ihn ja verteidigen. Zwanzig Jahre hab ich ihn vor mir verteidigt und ihm ein Postament gebaut. Wenn ich zulasse, dass Sie hart über ihn urteilen, ist meine Schwäche daran schuld, nichts anderes.“
Ulrike unterdrückte ein zufriedenes Lächeln. „Ich denke durchaus nicht gering von ihm,“ erwiderte sie; „im Gegenteil, ich denke sehr hoch von ihm. Ich halte ihn für einen Riesen an Kraft. Er ist so stark, dass er nicht bloss Sie und Ihre vier Kinder, sondern noch ein paar hundert arme Zwerglein ausserdem in den Sack steckt, ohne mit der Wimper zu zucken. Nicht die Schwäche ists, die Sie verhindert, eine Lanze für ihn zu brechen, o nein; ein Gefühl der Menschen- und Frauenwürde ists, wie ich glaube und hoffe, das jetzt, nicht ganz ohne mein Zutun, in Ihnen erwacht ist. Um was dreht sich denn das alles eigentlich? Nennen wir doch das Ding beim rechten Namen: worum geht denn die beständige Müh und Plage? Um zwei Gulden, um drei Gulden, um fünf Gulden, um dreissig Gulden. Herrgott, dazu sind Sie die Frau nicht, dazu geben Sie sich nur her, weil Sie sich einmal drauf eingeschworen haben; Ihr inneres Gewissen will nichts damit zu schaffen haben.“
Christine sagte hierauf: „Es kann wahr sein, es kann falsch sein, ich wills nicht untersuchen, ich darfs nicht untersuchen. Jawohl, ich hab mich drauf eingeschworen. Und was beschworen ist, muss gehalten werden, einmal für ewig.“
Die letzten Worte hatte Josephe gehört, die eingetreten war. Sie blieb stumm an der Tür stehen, und der Blick, mit dem sie die Mutter anschaute, war von so inniger, so schwingender Liebe erfüllt, dass Ulrike, als wäre sie geblendet davon, unwillkürlich die Augen abwandte.
Sie ging in Lothars Kammer. Er lag angekleidet auf dem Bett und rührte sich nicht, seit Stunden. Das weisse Tuch um die Stirn verlieh den entfärbten Zügen einen Liebreiz, dessen er sich trotz seines Zustandes wahrscheinlich bewusst war. Ulrike berührte seine Hand. Er öffnete die Augen und sah sie an. Der Starrkrampf der Erbitterung löste sich, die Lippen bewegten sich. Ulrike schaute sich vorsichtig um. Es war niemand im Zimmer. Da beugte sie sich herab, küsste ihn auf den Mund, und während sich sein Gesicht mit freudigflammender Röte bedeckte, flüsterte sie: „Ich geh jetzt zu ihm. Ich werde dich rächen. Steh auf. Sei ein Mann.“
Danach huschte sie fort.
Ulrike entringt dem Schatzhüter sein Geheimnis
Es war dreiviertel sieben vorbei, als Ulrike den Myliusschen Laden betrat. Der Angestellte, ein kahlköpfiger, leidend aussehender Mensch mit einer blauen Brille, rüstete sich zum Weggehen. Ein alter Diener trug die Verschlussbretter für die Tür und die Schaufenster hinaus. Im Hintergrund des langen Raumes tauchte spähend Mylius auf. Da die meisten Gasflammen schon verlöscht waren, herrschte unangenehm bleiches Zwielicht. Doch Mylius erkannte sie sogleich, kam mit seinem torkelnden Gang, die Hände in den Taschen, auf sie zu und grüsste verdrossen.
Wenn es ihm recht sei, möchte sie jetzt die Briefe schreiben, sagte sie; früher habe sie leider nicht Zeit gefunden; wie sie sehe, werde aber das Gewölbe geschlossen, es sei also wohl nicht mehr möglich?
Mylius zog die Uhr und überlegte. Ulrike erkannte sehr genau, dass er auf sie gewartet hatte und längst mit sich im reinen war. Sehr freundlich, dass sie sich erinnere, antwortete er; für ihn sei es nicht zu spät, für ihn gebe es keine Feierstunde; ob sie sich in sein Privatbureau bemühen wolle?
Er wies nach hinten und sie folgte ihm. Dem Diener gebot er, die Lichter im Gewölbe brennen zu lassen, den Gasometer werde er selbst zudrehn. Dann ging er noch einmal hinaus und gab ihm mit leiser Stimme einen Befehl. Wieder in dem engen, von zwei grünbeschirmten Lampen erleuchteten Kontor angelangt, entnahm er einer Pultlade ein paar vollbeschriebene Blätter und reichte sie Ulrike. Es waren die deutschen Texte zu den Briefen, die sie übersetzen sollte. Sie liess sich auf einem der beiden Schraubstühle nieder, dem Platz des Bebrillten offenbar, denn Mylius sass auf der gegenüberliegenden Seite des Doppelpultes, und fing an zu lesen. Das eine Schriftstück betraf den Verkauf der Einrichtung aus einem herzoglichen Schloss, das andere die Erwerbung zweier Bilder, eines Watteau und eines Turner. In beiden Fällen handelte es sich um bedeutende Summen. Mylius hatte den Stummel einer ausgebrannten Virginiazigarre im Mund, er rauchte aus Sparsamkeit meist kalt, addierte halblaut Zahlen in einem Heft und schien Ulrikes Anwesenheit vergessen zu haben. Doch entging es ihr nicht, dass er bisweilen einen forschenden Blick auf sie warf.
Sie legte die Blätter weg. Es würde zu lange dauern, wenn sie das heute noch machen sollte, sagte sie; es seien ja ganze Prozessschriften; darauf sei sie nicht gefasst gewesen.
„Fangen Sie heute wenigstens an, morgen ist auch ein Tag,“ antwortete Mylius unzufrieden; „oder haben Sie die Lust schon verloren? Hätte mirs denken können. Junge Damen haben was anderes im Sinn.“
„Stimmt diesmal zufällig,“ sagte Ulrike; „aber es ist nichts Erfreuliches. Erlauben Sie, dass ich ohne Umschweife davon rede. Wollen Sie mir zuhören oder soll ich warten, bis Sie mit dem Zusammenzählen fertig sind?“
Mylius hob den Kopf. „Bitte höflichst, Verehrteste,“ sagte er mit unangenehmem Glitzern im Blick, „was steht zu Diensten?“
„Wüsst ich nur, wie ichs vorbringen soll,“ begann Ulrike mit einem fast salbungsvollen Ton von Bescheidenheit; „ich meine die Geschichte mit Lothar. Unterbrechen Sie mich nicht, begehren Sie nicht auf, es kann mir nicht einfallen, mich in Ihre Erziehungsmassregeln zu mischen. Es war ein leichtsinniger Streich, und der Bub hat die Lehre verdient, die ihm zuteil geworden ist. Wenn einer meiner Brüder so was angestellt hätte, der Vater hätte ihn zu Brei zerschlagen. Ein belgischer Baron Saville, den ich kannte, hat seinen zwanzigjährigen Sohn, weil er sich mit Wucherern eingelassen hatte, vier Monate lang bei Wasser und Brot in das Verliess seiner alten Burg gesperrt; erst die Polizei musste ihn befreien. In London hab ich einmal zugesehn, wie ein Metzger einem verhungerten Köter, der ihm eine frisch-abgeschnittene Hammelrippe vom Hackblock stibitzte, das Beil nachschleuderte und ihm den Schädel zerspaltete. Der Mann war in seinem Recht. Hammelrippen sind heilig, besonders in England, und müssen verteidigt werden. Jeder wehrt sich wie er kann. Hierzulande ist man wehleidiger als anderswo; so eine Mutter hierzulande schreit gleich Zetermordio, wenn man das Söhnchen unsanft beim Schopfe packt. Ich hab was übrig für die Leute à la Saville, und die Köter, die auf Diebstahl ausgehn, sind mir verhasst.“
Читать дальше
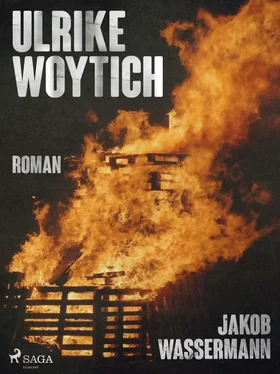
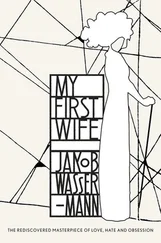
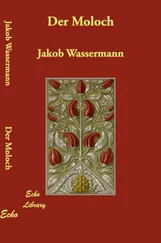
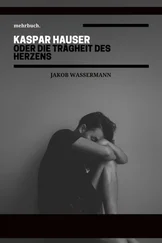
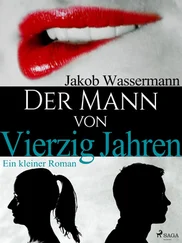
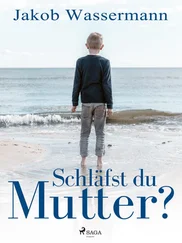
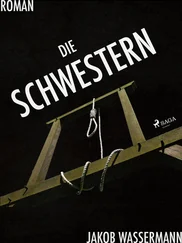
![Jakob Wassermann - Issue Does Not Exist],errors:{](/books/585068/jakob-wassermann-issue-does-not-exist-errors-thumb.webp)