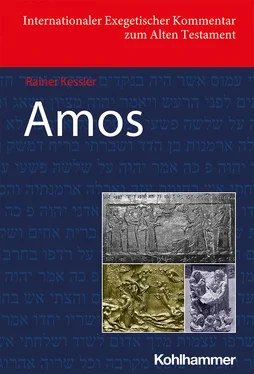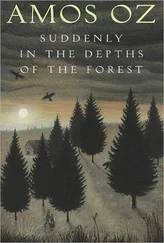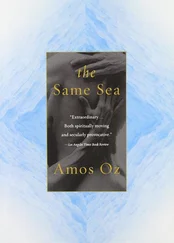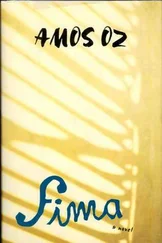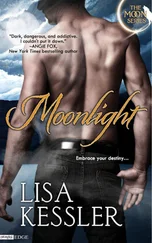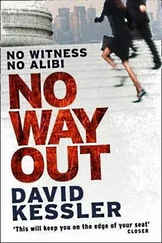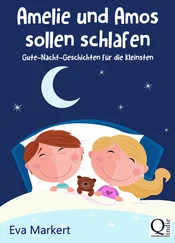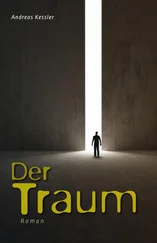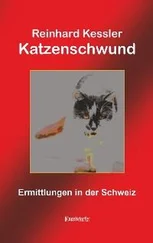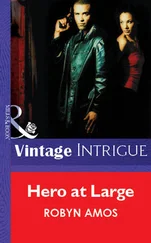9,11–12 – Die Aufrichtung der Hütte Davids
9,13–15 – Wohlstand und Sicherheit für s Volk
Diachrone Analyse
Synthese
Verzeichnisse
Abkürzungen
Literatur
Abbildungen
Register
Verzeichnis hebräischer Wörter
Verzeichnis außerbiblischer Quellen
Schlagwortverzeichnis
Bibelstellenverzeichnis (in Auswahl)
Genesis
Exodus
Levitikus
Numeri
Deuteronomium
Josua
Richter
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Könige
2 Könige
1 Chronik
2 Chronik
Esra
Nehemia
Ester
Hiob
Psalmen
Sprichwörter
Kohelet
Hoheslied
Sirach
Jesaja
Jeremia
Klagelieder
Ezechiel
Daniel
Hosea
Joël
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggai
Sacharja
Maleachi
Apostelgeschichte
Editionsplan
Vorwort der Herausgeberinnen und Herausgeber
Der Internationale Exegetische Kommentar zum Alten Testament (IEKAT) möchte einem breiten internationalen Publikum – Fachleuten, Theologen und interessierten Laien – eine multiperspektivische Interpretation der Bücher des Alten Testaments bieten. Damit will IEKAT einer Tendenz in der gegenwärtigen exegetischen Forschung entgegenwirken: dass verschiedene Diskursgemeinschaften ihre je eigenen Zugänge zur Bibel pflegen, sich aber gegenseitig nur noch partiell wahrnehmen.
IEKAT möchte eine Kommentarreihe von internationalem Rang, in ökumenischer Weite und auf der Höhe der Zeit sein.
Der internationale Charakter kommt schon darin zum Ausdruck, dass alle Kommentarbände kurz nacheinander in englischer und deutscher Sprache erscheinen. Zudem wirken im Kreis der Herausgeber und Autorinnen Fachleute unterschiedlicher exegetischer Prägung aus Nordamerika, Europa und Israel zusammen. (Manche Bände werden übrigens nicht von einzelnen Autoren, sondern von Teams erarbeitet, die in sich bereits multiple methodische Zugänge zu dem betreffenden biblischen Buch verkörpern.)
Die ökumenische Dimension zeigt sich erstens darin, dass unter den Herausgeberinnen und Autoren Personen christlicher wie jüdischer Herkunft sind, und dies wiederum in vielfältiger religiöser und konfessioneller Ausrichtung. Zweitens werden bewusst nicht nur die Bücher der Hebräischen Bibel, sondern die des griechischen Kanons (also unter Einschluss der sog. „deuterokanonischen“ oder „apokryphen“ Schriften) ausgelegt.
Auf der Höhe der Zeit will die Reihe insbesondere darin sein, dass sie zwei große exegetische Strömungen zusammenführt, die oft als schwer oder gar nicht vereinbar gelten. Sie werden gern als „synchron“ und „diachron“ bezeichnet. Forschungsgeschichtlich waren diachrone Arbeitsweisen eher in Europa, synchrone eher in Nordamerika und Israel beheimatet. In neuerer Zeit trifft diese Einteilung immer weniger zu, weil intensive synchrone wie diachrone Forschungen hier wie dort und in verschiedensten Zusammenhängen und Kombinationen betrieben werden. Diese Entwicklung weiterführend werden in IEKAT beide Ansätze engstens miteinander verbunden und aufeinander bezogen.
Da die genannte Begrifflichkeit nicht überall gleich verwendet wird, scheint es angebracht, ihren Gebrauch in IEKAT zu klären. Wir verstehen als „synchron“ solche exegetischen Schritte, die sich mit dem Text auf einer bestimmten Stufe seiner Entstehung befassen, insbesondere auf seiner Endstufe. Dazu gehören nicht-historische, narratologische, leserorientierte oder andere literarische Zugänge ebenso wie die durchaus historisch interessierte Untersuchung bestimmter Textstufen. Im Unterschied dazu wird als „diachron“ die Bemühung um Einsicht in das Werden eines Textes über die Zeiten bezeichnet. Dazu gehört das Studium unterschiedlicher Textzeugen, sofern sie über Vorstufen des Textes Auskunft geben, vor allem aber das Achten auf Hinweise im Text auf seine schrittweise Ausformung wie auch die Frage, ob und wie er im Gespräch steht mit älteren biblischen wie außerbiblischen Texten, Motiven, Traditionen, Themen usw. Die diachrone Fragestellung gilt somit dem, was man die geschichtliche „Tiefendimension“ eines Textes nennen könnte: Wie war sein Weg durch die Zeiten bis hin zu seiner jetzigen Form, inwiefern ist er Teil einer breiteren Traditions-, Motiv- oder Kompositionsgeschichte? Synchrone Analyse konzentriert sich auf eine bestimmte Station (oder Stationen) dieses Weges, besonders auf die letzte(n), kanonisch gewordene(n) Textgestalt(en). Nach unserer Überzeugung sind beide Fragehinsichten unentbehrlich für eine Textinterpretation „auf der Höhe der Zeit“.
Natürlich verlangt jedes biblische Buch nach gesonderter Betrachtung und hat jede Autorin, jeder Autor und jedes Autorenteam eigene Vorstellungen davon, wie die beiden Herangehensweisen im konkreten Fall zu verbinden sind. Darüber wird in den Einführungen zu den einzelnen Bänden Auskunft gegeben. Überdies wird von Buch zu Buch, von Text zu Text zu entscheiden sein, wie weitere, im Konzept von IEKAT vorgesehene hermeneutische Perspektiven zur Anwendung kommen: namentlich die genderkritische, die sozialgeschichtliche, die befreiungstheologische und die wirkungsgeschichtliche.
Das Ergebnis, so hoffen und erwarten wir, wird eine Kommentarreihe sein, in der sich verschiedene exegetische Diskurse und Methoden zu einer innovativen und intensiven Interpretation der Schriften des Alten Testaments verbinden.
Die Herausgeberinnen und Herausgeber
Im Herbst 2012
Im Jahr 1969 kam im Biblischen Kommentar die Auslegung von Joel und Amos aus der Feder von Hans Walter Wolff heraus. Seit dem Sommersemester 1967 durfte ich bei ihm in Heidelberg die Stelle einer studentischen Hilfskraft einnehmen. Im Wintersemester 1967/68 besuchte ich Wolffs Seminar „Tradition und Inspiration bei Amos“. Ab 1969 wurde Wolff der Betreuer meiner Dissertation. Seine Amosauslegung habe ich gleichsam als exegetische Muttermilch zu mir genommen.
Ein Vierteljahrhundert später, im Jahr 1993, trat ich die Professur für Altes Testament in Marburg an. Mein Kollege dort war Jörg Jeremias. Kaum in Marburg angekommen, erschien 1995 dessen Amoskommentar in der Reihe Altes Testament Deutsch.
Ein weiteres Vierteljahrhundert später kommt nun meine eigene Auslegung des Amosbuches im Internationalen Exegetischen Kommentar zum Alten Testament heraus. Angesichts der skizzierten Vorgeschichte in meiner Biografie wird verständlich, dass die beiden Herausgeber Walter Dietrich und Helmut Utzschneider einen hohen argumentativen Aufwand brauchten, um mich von der Übernahme dieser Aufgabe zu überzeugen. Im Nachhinein bin ich ihnen sehr dankbar dafür.
Der Metaphern sind viele: Man tritt in große Fußstapfen, steht auf den Schultern von Riesen oder auch in deren Schatten. Dennoch scheint mir eine erneute Auslegung von Amos in einer neuen Reihe durchaus gerechtfertigt. Denn die Forschung ist im vergangenen halben Jahrhundert nicht stehen geblieben. Dies zeigt sich insbesondere in der Auffassung der Amosvisionen, die für Wolff und Jeremias Urbestand der Amosüberlieferung und Schlüsseltexte für das Gesamtverständnis des Amosbuches sind, während ich sie mit etlichen neueren Studien als spätere Reflexionstexte verstehe. Auch wird der Zugang vom Gesamtbuch her, den Wolff vorbereitet und dem Jeremias zum Durchbruch verholfen hat, noch konsequenter befolgt, begünstigt durch die Anlage des IEKAT, die den synchronen Zugang an die erste Stelle setzt.
Eine neue Kommentierung steht aber nicht unter dem Zwang der Originalität. Wer die Kommentare und sonstigen Arbeiten von Wolff und Jeremias kennt, wird schnell herausfinden, was ich selbst ihnen zu verdanken habe – und natürlich den vielen anderen, die sich mit diesem aufrüttelnden Prophetenbuch befasst haben.
Читать дальше