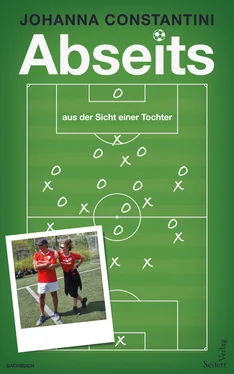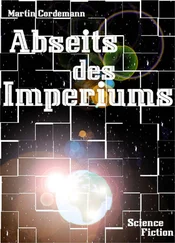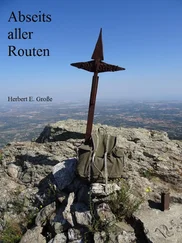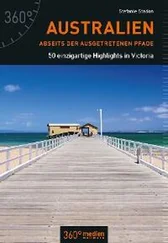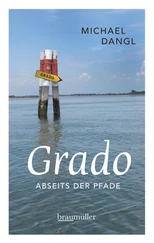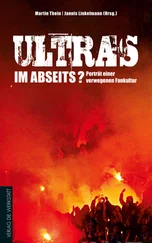Mehrere Motive haben mich zu diesem Buch bewogen. Einerseits dienen meine Zeilen der persönlichen Aufarbeitung familiärer Geschehnisse, wie sie sich zuletzt in meinem Leben zugetragen haben. Dabei spreche ich vor allem von jenem Unfall, den Papa im Juni 2019 als Geisterfahrer verursacht hatte. Und in dessen Folge ihm die Diagnose einer Demenz, im Speziellen die einer Alzheimer-Erkrankung attestiert worden war.
Auch zur Klärung offener Fragen zu jenen Geschehnissen, die das öffentliche Interesse über alle Maßen beschäftigt haben, sollen die folgenden Seiten beitragen. Und nicht zuletzt sollen sie über Demenzerkrankungen aufklären: Ich möchte bewusst Einblicke in Papas Leben wie auch in unsere Familiengeschichte und unseren ganz persönlichen Umgang mit dem Schicksalsschlag gewähren. Einem Schicksalsschlag, wie er viele Menschen ereilt. Menschen, mit denen ich nicht zuletzt in meiner Rolle als Psychologin in Kontakt trete, mit denen ich persönliche Herausforderungen aufarbeite. Schließlich gibt es in beinahe jeder Familie einen oder gar mehrere Fälle psychischer Erkrankungen. Vor allem dementielle Erkrankungen nehmen stetig zu.
Während sich mein Buch sowohl an Betroffene als auch an Angehörige und die Gesellschaft richtet, möchte ich mit meinen Zeilen keinen wissenschaftlichen Ratgeber liefern. Eher als professionelle Expertentipps will ich meine bzw. unsere persönlichen Sichtweisen und Strategien im Umgang mit der Erkrankung preisgeben. An die Öffentlichkeit zu gehen war uns als Familie auch deshalb wichtig, um Vorbild sein zu können.
Dass eine Demenzerkrankung viele Herausforderungen für Betroffene und auch für Angehörige mit sich bringt, ist und bleibt unbestritten. Dass diese Erkrankung aber auch neue Möglichkeiten und Chancen für zahlreiche gemeinsame Momente birgt, möchte ich nicht zuletzt am Beispiel unserer Familie zeigen.
Letztlich ist dieses Buch also der Versuch, persönliche und berufliche Denkanstöße zu vereinen, um demenzkranke Menschen ihre Positionen selbst wählen zu lassen. Sie vor allem nicht ins Abseits zu stellen, ihnen vielmehr so gut wie nur möglich ein Dasein auf dem Spielfeld des Lebens zu erhalten.
Dafür schreibe ich. Als Psychologin. Und als Tochter.
|
1

Der Wald riecht noch frisch. Ein wenig nach Frühling. Obwohl die Sonne für diese frühen Stunden bereits recht hoch steht. So wie Anfang Juni eben üblich. Die warme Jahreszeit hielt bisher noch zögerlich Einzug, sodass der Waldboden in diesem Jahr später als normal sein frisches, sattes Grün zeigt. Doch was ist schon normal? Diese Frage wird mich in meinem Buch, von dem ich heute noch nicht genau weiß, wo es mich hinführen wird, wohl noch einige Male beschäftigen. Der weiche Waldboden trägt mich Meter für Meter durch das vom späten Frühlings- und frühen Sommerlicht durchflutete Dickicht der Tannenbäume. Meter für Meter lasse ich hinter mir, begleitet von meinem vierbeinigen Partner.
Wir laufen, und meine Gedanken schweifen ab. So wie sie es immer tun, wenn ich dieser – einer meiner liebsten sportlichen –
Betätigungen nachgehe. Beim Laufen konnte ich schon immer wunderbar abschalten. Eine Gabe, die mir dieser Tage sehr zugute kommen soll. Ich blicke durch das Geäst, mir fallen die vielen Eichhörnchen auf, die hurtig die Baumstämme hinaufklettern, ihre Augen, und damit auch ihre wachsame Aufmerksamkeit immer wieder auf meinen Vierbeiner und mich gerichtet. Auf unsere kleine Laufgemeinschaft sozusagen.
Trotz ihrer akrobatischen Kunststücke schaffen es die quirligen Baumfüchse jedoch nicht lange, mich in ihren Bann zu ziehen. Im Nachhinein bin ich verwundert, weshalb es einem der unscheinbarsten Waldbewohner gelang, meinen Blick auf sich zu ziehen: Es ist ausgerechnet eine kleine Raupe, die fortan meine ungeteilte Aufmerksamkeit genießt. Obwohl sie nicht mehr tut, als an einem scheinbar seidenen Faden vor mir zu hängen und sich fortwährend nach oben und nach unten zu schlängeln. In einem fahlen Gelb, fast schon Beige erscheint sie in diesem frühen Sonnenlicht eines Dienstags im Juni des Jahres 2019. „Gut, dass sie im Wald leben kann“, denke ich in diesem Moment …

„Ich muss die Raupe rausbringen!“, sagte ich zu meiner Mama, die neben mir saß, und blickte auf den Zipfel meiner Laufhose. Fast alle anderen Sitze in dem Warteraum der Innsbrucker Universitätsklinik waren zu diesem Zeitpunkt leer. Auch der Platz des Portiers war nicht besetzt. Es war kurz vor fünf Uhr Nachmittag an eben jenem Dienstag. Uns gegenüber hatte eine Familie Platz genommen, Mutter, Vater und ein junger Mann, offenbar der Sohn. Der Bruder des jungen Mannes, der wohl auch in den Autounfall von heute Nachmittag verwickelt worden war. In den Unfall, der auch uns schnurstracks in die Notaufnahme geführt hatte. Direkt nach meinem Waldlauf, auf dem mich mein Hund, viele, viele Eichhörnchen und der wohl hartnäckigsten Mitreisende, eine kleine, hellgelbe Raupe, begleitet hatten. Auf dem ich mir erhofft hatte, ein wenig abschalten zu können. Von den letzten Wochen, die sich für mich beruflich wie eine Achterbahnfahrt angefühlt hatten. Ständig hatten sich neue, durchaus spannende und abwechslungsreiche Projekte in meiner psychologischen Arbeit ergeben. Meine Selbstständigkeit hatte zunehmend Fahrt aufgenommen, und ich genoss die vielen neuen Aufgabengebiete. Der Waldlauf und die frische Luft sollten mir guttun.
Und plötzlich – „Notfall“! Eine Whatsapp-Nachricht meiner Mama hatte meine Illusion eines energiespendenden Tagesausklangs jäh beendet. Kaum gelesen, noch mitten im Wald, rief ich meine Mama zurück. „Es ist wohl nicht viel passiert. Es war ein Autounfall. Mehr weiß ich noch nicht. Papa ist auf dem Weg in die Klinik.“
Meine Schritte wurden schneller. In welche Richtung sollte ich nun bloß weiterlaufen? Wieder retour und nach Hause, zu meinem Auto? Geradewegs weiter, immer der Nase nach in Richtung Stadt?
Ich versuchte, meinen Freund zu erreichen, in der Hoffnung, dass er mich abholen würde. Danach ging alles – wie immer, wenn derartige, obwohl meist etwas kleinere Notfälle unsere Familie betreffen – ganz schnell. Ich erinnere mich nur, wie ich in das Auto meines Freundes eingestiegen bin, der es, schneller als vorerst gedacht, durch den Feierabend-Verkehr aus der Stadt bis zum Waldeingang geschafft hatte, um mich dort aufzulesen.
„Ich habe auch was von einem Geisterfahrer-Unfall gehört“, sagte meine Mama, als ich sie auf der Fahrt ins Krankenhaus nochmals nach ihrem genauen Standort fragte. Notaufnahme.
Einen Zusammenhang mit dem Geisterfahrerunfall, der sich laut Verkehrsmeldungen an jenem Nachmittag auf der Brennerautobahn zugetragen hatte, kam uns keine Sekunde in den Sinn, sodass die oberste Devise für uns erst einmal lautete, die Klinik schnellstmöglich zu erreichen. Zumindest das gelang uns in Rekordzeit.
Ich stieg aus und warf mit einem lauten Knall die Autotüre hinter mir zu, dann öffnete sich die Schiebetüre zur Aufnahme akuter Notfälle langsam – in diesem Moment viel zu langsam – vor mir.
Mama? Zahlreiche Menschen, die vor den verschlossenen Behandlungsräumen auf ihre Angehörigen warten mussten, doch keine Spur von einer blonden Frau mit kurzen Haaren, meist bunt und etwas verrückt, jedoch sehr modisch und immer schick gekleidet. Keine Spur von einer der stärksten Frauen, die ich in meinem bisherigen Leben kennengelernt hatte. Keine Spur von einer meiner besten Freundinnen. Keine Spur von meiner geliebten Mama. Die einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, mich ebenfalls zu einer – wie ich von mir behaupten würde – starken Frau zu machen. Schließlich war sie es, die dafür gesorgt hatte, dass wir ein Leben leben durften, wie es sich andere wohl nur träumen konnten. Dabei war unsere Kindheit weder von übermäßigem Luxus noch von hochkarätig besetzten Events geprägt, wie man es sich vielleicht für die Familie eines bekannten Fußballtrainers vorstellen würde. Viel lieber blieben wir unter uns. Zeit, die wir tanzend in unserem Garten, an Gletscherseen oder beim Würstelbraten vor dem Lagerfeuer verbrachten, in der Mama uns in den Stall zu unseren Reitstunden begleitete, in der wir Bäche aufstauten, um Frösche zu fangen, und Kräuter-Bündel banden oder Zwetschgen pflückten, um sie in der Nachbarschaft verkaufen zu können. Ausgerüstet mit einem alten Leiterwagen und voller Zuversicht, ein paar Schillinge unseres eigenen Geldes verdienen zu können. Dass dieses privilegierte Leben keine Selbstverständlichkeit ist, war unseren Eltern immer wichtig zu vermitteln. Vor allem meinem Papa, der gemeinsam mit drei Brüdern aufgewachsen war und sich zwischenzeitlich das einzige Badezimmer der Zwei-Zimmer-Wohnung nicht nur mit Eltern und Brüdern, sondern auch mit einem ständig wechselnden Untermieter teilen musste. Und obwohl auch seinen Eltern Bescheidenheit nicht nur ein großes Anliegen, sondern auch eine Notwendigkeit gewesen ist, so wusste vor allem mein Opa Walter seinen Söhnen trotz geringer finanzieller Möglichkeiten das ein oder andere Abenteuer zu bieten. Opa war zunächst selbstständiger Frächter gewesen, um sich nach einer diabetesbedingten Netzhautablösung und der daraus folgenden einseitigen Erblindung als Platzwart seinen und seiner Familie Lebensunterhalt zu verdienen. Viel weiß ich nicht von ihm – er ist leider noch vor meiner Geburt verstorben –, doch erzählt Papa bis heute gerne von den damals illegalen Brennerfahrten, die ihm, seinem Bruder Germar und seinem Papa nur durch dessen LKW-Fahrer-Freund ermöglicht wurden. Dieser holte die drei wagemutigen Constantinis meist spätnachts aus der Innsbrucker Gumppstraße ab, um sie am frühen Morgen jenseits der Grenze in Italien ein paar Stunden Süden genießen zu lassen. Diese Stunden verbrachte mein Papa mit Opa Walter und seinem Bruder mit tollen Spaziergängen und Wanderungen, bevor die drei meist nach Einbruch der Dunkelheit wieder an einer Straße warten mussten, um – wieder im Laderaum des LKWs – die Rückfahrt nach Innsbruck antreten zu können. „Passt auf, da sind ganz viele Schlangen!“, hatte mein Opa den beiden Buben immer weisgemacht, bevor sie das Feld in Richtung der Hauptstraße überquerten. Worauf Germar und Dietmar, hysterisch hüpfend versuchten, schleunigst wieder Asphalt unter ihren kleinen Füßen zu spüren. Glücklicherweise ohne dabei jemals von den giftigen italienischen Schlangen gebissen worden zu sein.
Читать дальше