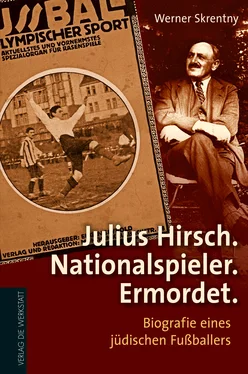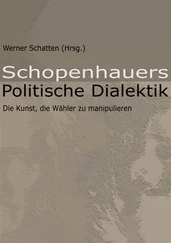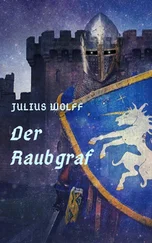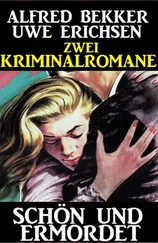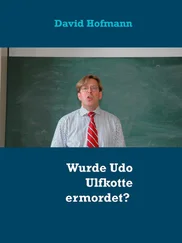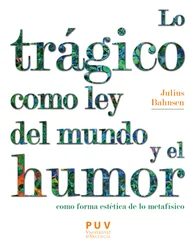„Das Dörfle“ wurde ursprünglich für die beim Schlossbau beschäftigten Handwerker errichtet. Später galt es als Armenviertel der Stadt und Heimat der Tagelöhner. In der NS-Zeit werden von dort die Sinti und Roma deportiert. Seit dem 19. Jahrhundert ist „das Dörfle“ ein Ort der Prostitution, und noch heute beherbergt es am östlichen Ende der Zähringer Straße das kleine Rotlichtviertel der Großstadt.
Die Fuchs verlegten sich auf den Holzhandel – eine ausgezeichnete Entscheidung. Denn nach der Reichsgründung 1871 und der bereits zuvor fortschreitenden Industrialisierung entwickelt sich eine rege Bautätigkeit. Karlsruhe wächst und wächst: 1865 sind es 30.000 Bewohner, ein Vierteljahrhundert später fast 73.500. 1900 werden bei der Volkszählung 97.183 Bewohner registriert, davon sind 67 Prozent zugezogen. Bald darauf ist Karlsruhe die 34. deutsche Großstadt, als es die Grenze von 100.000 Einwohnern überschritten hat.
Wie der Tuchhandel der Brüder Hirsch, so florieren angesichts dieser Entwicklung auch die Geschäfte der Familie Fuchs. Die Fuchs-Söhne gründeten wie erwähnt in sehr jungen Jahren die Holzhandel-Firma H. Fuchs Söhne (HFS; das H steht für den Vater Hirsch Fuchs). Sie expandiert bald von Karlsruhe nach Stuttgart und Straßburg, damals Teil des Deutschen Reiches. Um die Jahrhundertwende ist sie auf 46.000 qm im Karlsruher Rheinhafen ansässig, samt Säge- und Hobelwerk sowie Parkettfabrikation. HFS wird die bedeutendste Holzhandlung Südwestdeutschlands, und 1920 meldet das Karlsruher Adressbuch: „H. Fuchs Söhne, Holzhandlung, Hobel- und Sägewerk, Bureau, Lager und Werk am Rheinhafen, Hansastr. 5, Tel. 9, 57, 909 (Anm.: drei Telefon-Anschlüsse!), Ein- und Ausfuhr ausländischer Hölzer.“
Der „Fußball-Millionär“
Gottfried Fuchs’ Lebensweg ist vorgezeichnet: Geschäfte und noch einmal Geschäfte. In Karlsruhe wird die wohlhabende und weitverzweigte Familie den Beinamen „die Holz-Füchse“ erhalten. Dazu werden auch jene Familienmitglieder gezählt, die gar nichts mit der Holzbranche zu tun haben. Gottfried Fuchs wird auf seine berufliche Laufbahn u. a. in London und Düsseldorf vorbereitet, und in diesen Städten hat er auch das Fußballspiel kennengelernt, das ihn berühmter machen sollte als seine beruflichen Erfolge. Später wird man ihn den „Fußball-Millionär“ nennen. Ob zu Recht oder Unrecht, werden wir in diesem Buch noch hinterfragen müssen. Für sein Können auf dem Rasen ist er allerdings finanziell nie honoriert worden.
Beim Oxford-Spiel für den KFV ist Gottfried Fuchs 17 Jahre jung und hat das fußballerische Knowhow neben dem Engländerplatz nach der Schule in Karlsruhe bereits andernorts erworben. Er hat mit dem Düsseldorfer FC 1899 (heute: Düsseldorfer SC 99) 1906/07 die Meisterschaft von Nordrhein und anschließend die Westmeisterschaft (5:1 gegen BV 04 Dortmund, 3:1 gegen Kölner FC 99, 7:0 gegen Kasseler FV) gewonnen. Danach gastiert er mit den Rheinländern u. a. in Frankfurt/M. und Offenbach: „Gegen Germania Frankfurt schoss unser lieber Fuchs das hundertste Tor in dieser Spielzeit!“ (Vereinschronik 1924). Ungeachtet des einmaligen Auftritts beim KFV gegen Oxford tritt Fuchs für den Düsseldorfer FC bereits am 21. April 1907 in Duisburg wieder an. Es ist sein Debüt in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, und beim 1:8 gegen Viktoria Hamburg (heute SC Victoria) erzielt er den Ehrentreffer. Der DFC hat damals nach dem Feldverweis seines Torhüters nur noch zehn Mann auf dem Platz.
Gottfried Fuchs gehört in Düsseldorf einem Team an, das zur Hälfte aus Engländern besteht: Rapier, Miller, Kirby, Leak und die Brüder Briggs mit Namen. „Wir sind um der Engländer willen seinerzeit stark angefeindet worden“, berichtet die Vereinschronik. „Für die Hebung der Spielstärke unseres Vereins und damit zur Belehrung Anderer war das Mitspielen der Engländer aber von großer Bedeutung.“
Gelernt hat Fuchs von den Briten auch die Fairness: Als beim Stand von 0:0 in einem späteren Punktspiel des Karlsruher FV gegen Wiesbaden ein Strafstoß für seine Mannschaft gegeben wird, bittet er den Unparteiischen, die seiner Ansicht nach falsche Entscheidung zurückzunehmen. Und als man ihm nach einer anderen Begegnung einen Lorbeerkranz verleiht, zupft er die einzelnen Blätter heraus und verteilt sie an die Mitspieler.
Fuchs selbst datiert diese Zeit in einem Brief, den er 1955 an seinen früheren Kölner Gegenspieler Peco Bauwens, den späteren DFB-Präsidenten, schickt, auf 1905 und 1906: „Dies waren die Zeiten, als Düsseldorf sich unter dem Spielführer Leak mit der Engländermannschaft des FC Ratingen vereinigt hatte.“
Im Rahmen seiner beruflichen Ausbildung ist Fuchs dann in London tätig, die Töchter Anita und Natalie bestätigen dies, und vermutlich hat er auch dort Fußball gespielt. 1908 läuft er erneut für Düsseldorf auf: „Mit Hilfe unseres eigens aus London herbeigeeilten Gottfried Fuchs schlagen wir die Hanauer (Anm.: 1. Hanauer FC 1893) mit 3:0, sehr zum Leidwesen der zahlreichen hiesigen Hanauer Kolonie. Eine unvergessliche Kabinettleistung von Fuchs war es, einem Hanauer den Ball vom Fuße wegzuköpfen und dann das erste Tor zu schießen.“ (Vereinschronik des DFC)
Gottfried Fuchs, womöglich fußballerisches Vorbild von Julius Hirsch, wird dessen lebenslanger Freund, der sich auch viele Jahre später an das letzte Wiedersehen der beiden in Paris erinnern wird. Hirsch und Fuchs werden gemeinsam beim Karlsruher FV spielen, sie gehören der süddeutschen Auswahl und der deutschen Nationalelf an.
EXKURS I
Der Karlsruher FV im Jahr 2011: C-Klasse auf dem Nebenplatz \\\ Stadion-Überreste \\\ „Prinz Berthold“, leerstehend
2. April 2011
Es ist einer der angenehmsten Wege, die zu einem deutschen Fußballstadion führen. Wenn man zum Wildparkstadion von Karlsruhe unterwegs ist, lässt man zunächst den Mittelpunkt der Stadt, den Marktplatz und das Schloss, hinter sich, passiert den Schlossgarten und geht hinein in den weiten Hardtwald, das ehemalige Jagdrevier der badischen Großherzöge.
Und das nebenbei: Das Wildparkstadion hat im Gegensatz zu vielen anderen bundesdeutschen Sportstätten glücklicherweise seinen Namen behalten, seit 1955. Wie sehr sei das dem Karlsruher SC und seinem Anhang gegönnt, angesichts von Traditionsnamen und lokalen Bezeichnungen, die dem Mammon zuliebe andernorts verschwunden sind.
Jedoch, wir sind nicht auf dem oft zurückgelegten Weg zu einem Heimspiel des KSC. Diesmal heißt es noch weiter gehen, das Stadion bleibt links liegen, denn der Karlsruher FV spielt im Frühjahr 2011 natürlich nicht im Wildparkstadion, sondern als Untermieter der DJK Ost Karlsruhe.
Seit der Verein im Sommer 2007 wieder auflebte, ist er auf Wanderschaft, denn sein angestammtes Terrain in der Nordweststadt, also das Stadion bei der Telegraphenkaserne, existiert nicht mehr. Der KFV spielte als Gast beim Gehörlosen SV in der Südstadt, beim SV Südwest in Oberreut und nun eben bei der DJK. Es gibt keine 2. Mannschaft und keine Nachwuchsteams, weshalb der Traditionsverein auch keinen Anspruch auf einen festen Platz innerhalb Karlsruhes erheben kann.
Die satte, grüne Rasenfläche vor dem DJK-Vereinsheim liegt an diesem Sonntagnachmittag im April verwaist da. Denn spielen darf der KFV nur auf dem Nebenplatz, auf dem das Gras eher seltener wächst.
Es geht an diesem Sonntagnachmittag gegen die FT Forchheim aus Rheinstetten. Das Kürzel FT steht für Freie Turnerschaft und die Herkunft aus dem 1933 von den Nazis zerschlagenen Arbeitersport. Leider tragen die KFVler nicht die traditionelle schwarz-rote Spielkleidung, sondern orangene Hemden, ebensolche Stutzen und schwarze Hosen.
KFV gegen Forchheim, das ist ein Punktspiel der Kreisklasse C, Staffel 1. Der Fußballkreis Karlsruhe hat fünf C-Klassen, überwiegend treten dort 2. Mannschaften an. Den Eintritt von zwei Euro kassieren zwei junge Frauen, indem sie den Platz umrunden. Mehr könnte man noch für Sitzplätze verlangen, aber die gibt es nicht. Zuschauer dürften es um die 60 gewesen sein.
Читать дальше