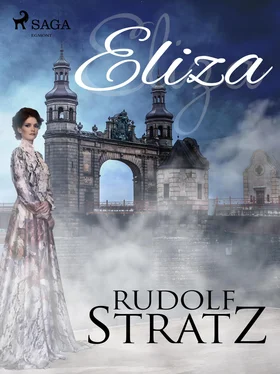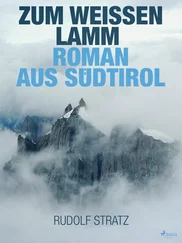„Hier in Ostpreussen hege ich keine Sorge!“ fuhr der Graf Möllenbeck ruhiger fort. „Hier sind wir im Lande und halten die Schwarmgeister im Fass, bis es Zeit ist, den Most auf Flaschen zu füllen. Aber die Fäden dieses Spinnennetzes laufen nach Pommern hinüber! Dort sind wir, von hier aus, ohne Einfluss. Wir, in Amt und Würden, dürfen uns nicht in das von den Franzosen besetzte Gebiet wagen. Wir können nur jetzt eilends, mit dem vollen Schwerklang unserer Namen, eine Warnung an die dortige gräfliche Kreuzspinne mitten im Netz der Missvergnügten schicken! Diese Warnung lässt sich, wo es sich um die Krone handelt, nicht dem Papier anvertrauen. Sie kann nur mündlich durch einen unbedingt zuverlässigen Beauftragten erfolgen!“
„Wann soll ich reisen, Exzellenz? Wann ich wieder bei Kräften bin? Pah! . . heute noch wenn’s not tut!“
„Sagen wir: morgen! Sie können jetzt, nach Friedensschluss, ungefährdet auf dem geraden Weg nach Königsberg und von da zur See!
Und verzagen Sie nicht an Preussen und seinem Volk!“ Der Graf Möllenbeck drückte dem Königsberger Kandidaten die Hand. „Denken Sie an das Wort der Schrift: ,So du frei sein kannst, so gebrauche das doch viel lieber!’ Das ist ein Wort von morgen! Das Wort verstehen Sie heute noch nicht! . . . Herr Sekretarius!“ Er stülpte sich, während der Geheimschreiber aus dem Nebenzimmer eintrat, die gekrämpte Hutröhre über den Haarbeutel und griff nach dem dünnen Bambusstock. „Lasse Er den Herrn Generalmajor Scharnhorst und den Herrn Oberstleutnant Gneisenau durch Boten wissen, dass ich morgen in Memel zu Diensten stehe, und expediere Er diesen Brief an den Herrn Reichsfreiherrn vom Stein in Nassau!“
Also ich täť mich an Eurer Stell’ schäme!“ So rief das eine der beiden jungen Frauenzimmer, das grössere, braune, mit dem feinen, schmalen, vom Schutenhut beschatteten Gesicht. Sie stand zornmütig aufrecht in dem haltenden offenen Reisewägelchen, die Pelz-Wiltschura um die Schultern des ausgeschnittenen, hochgegürteten, weissen Empirefähnchens, im langen blauen Tuchrock. „An uns ist nix zu gaffe — ihr Schote! Hier ist kein Affekaste!“
Um das Fuhrwerk wogten wie Schneegestöber die weissen Waffenröcke der sächsischen Musketiere vom Infanterieregiment Loë. Hundert braungebrannte Gesichter grinsten unter den hohen, blauen Tschakos. Die Sonne brannte heiss auf die grünen Reiser und bläulichen Kochfeuer und gelben Kornschütten der stundenlangen Biwaks der Grossen Armee. Fern flimmerten in der zitternden Luft die Türme von Tilsit.
„Das sind jetzt deutsche Landsleuť, Märtche!“ rief wieder empört die Braune.
„Bettinche — halt doch die Gosch’!“ flüsterte die dralle Blonde. Aber ihre Freundin stemmte die Hände in die Hüften und funkelte furchtlos wie eine gereizte Katze auf die Soldaten hinab.
„. . und statt dass die Herre Sachse zwei schutzlose Mainzer Mädche ungeniert passiere lasse . .“
„Ich mein’, die Jungfern haben Schutz genug!“ schrie ein Korporal. Alles grölte. Vor dem Wagen hielt als Wache ein grüner, Grossherzoglich-Warschauscher Ulan zu Pferde, das weiss-rote polnische Fähnchen an der aufrechten Lanze. Eine andere rot und weiss geflammte Riesen-Tschapka und rot eingesetzte Ulanka schimmerte hinter dem Fuhrwerk. In einer zweiten, unmittelbar folgenden Kutsche raunte ein schwammiger, bleicher Franzose mit tiefschattenden Augen aus den fünf Falklappen seines braunen polnischen Wettermantels heraus zu einem an den Wagenschlag getretenen Offizier:
„Sie sehen in mir den Geheimagenten Bienassis des Herrn Polizeiministers Fouché! Ich eskortiere zwei junge Frauenspersonen, die sich des Hochverrats schuldig gemacht haben, in das Hauptquartier. Es wollen die Demoiselles Dullenkopf und Zipfler, Modeschneiderinnen aus Mainz, sein! Nun — man wird sehen!“
„Wartet nur! Ich sag’s dem Kaiser Napoleon, wie ihr euch hier unmanierlich aufführt!“ schrie drüben die Demoiselle Dullenkopf. Ein wieherndes Gelächter als Echo. Immer mehr sächsische Rheinbundkrieger strömten hinzu, Musketiere von den Infanterieregimentern Aus dem Winckel und Nostiz, Gersdorff-Cheveaulegers, weisse Zezschwitz-Kürassiere. Auch der wachhabende Leutnant amüsierte sich. Er liess den ehemaligen Abbé und Jakobiner Bienassis in seinem Wagen sitzen, schlenderte nach vorn zu den beiden Demoisellen und lüftete ironisch den hohen Dreispitz.
„Der Kaiser der Franzosen hat gerade Zeit für Dämchen eures Kalibers!“ sagte er. „Ausserdem steht Seine Majestät im Begriff, nach der gestrigen Unterzeichnung des Friedens, nach Paris, zurückzukehren. Er wird in kurzem hier durchpassieren . . .“
„Er kommt hier vorbei . .? Heilig und gewiss . .? In einer Stund’ schon?. . .“ Die Demoiselle Dullenkopf liess sich, beglückt aufatmend, steil aufrecht auf das Wagenpolster nieder. Sie faltete die Hände und warf aus ihren braunen Augen einen dankbaren Blick zum Herrn im Himmelsblau empor. „Jetzt wird alles gut!“
„Sie werden sich nicht etwa beifallen lassen, den Kaiser zu belästigen, Mamsell! Dafür wird man sorgen!“
„Ei — warum habt ihr mich denn dann per Schub aus Polen hierhergeschafft?“ frug das braune Fräulein aus Mainz spitzbübisch. „Ich bin euch allen dafür zu herzlichstem Dank obligiert, Messieurs!“
„Sie wird schon etwas angestellt haben! Lache Sie nicht, Sie Gans! Ich sehe Sie schon beim Wollespinnen in St. Lazare!“ Der Sachse blinzelte vielsagend zu dem zweiten Wagen zurück. „Mit der Pariser Polizei ist nicht zu spassen!“
Ein Haufe Offiziere stand jetzt dort an dem Kutschenschlag um Monsieur Bienassis. Aus dem himmelblau leuchtenden Biwak der Bayern nebenan war ein Brigadier der Infanterie herübergestiefelt. Blutrot flammte das Band der Ehrenlegion auf seinem blauen Herzen. Sein rundes Gesicht perlte von Schweiss. Er liess sich von dem Geheimagenten auf französisch Bericht erstatten.
„So einem z’wideren Preissen haben’s Vorschub geleistet — die Madel — die verdächtigen!“ dolmetschte er den um ihn gescharten schwarzen Raupenkämmen über hohen Schirmhelmen. „Aber am End’— jetzt ist Frieden!“
„Hären Sie — ich täť die hibschen Tierchen loofen lassen!“ sprach ein Sachse vom Infanterie-Regiment Lindt. Der dicke, kleine, bayerische Kapitän vom dritten leichten Infanteriebataillon neben ihm nickte gutmütig:
„Die Flintscherln sollen schaug’n, dass ’s weiterkommen!“
„Attention!“ Eine gelle Stimme. Die buntscheckigen Rheinbund-Uniformen spritzten salutierend auseinander. „Le maréchal!“
Der französische Korpsgeneral Lacroux trat rasch, sporenklirrend, den Reitstock wagrecht unter der Achsel, in die Mitte seiner deutschen Untergebenen. Er war ein Mann zu Anfang Dreissig, mit einem bartlosen, barschen, jungen Gesicht voll ungebildeter Bravour. Hinter ihm wimmelte sein Stab von grauköpfigen Colonels und schwarzbärtigen Brigadiers, alle um Jahrzehnte älter als er. Er schüttelte zu dem vertraulichen Getuschel des Geheimagenten ungeduldig den harten Kopf und schnalzte missbilligend mit der Zunge.
„Ah — la — la! Das ist nicht gut! Das ist Senf nach dem Essen, mein Herr! Wir haben den Frieden . . .“
Und schroff, so gedämpft, dass nur der Vertraute des allmächtigen Polizeiministers ihn verstehen konnte:
„Wenn dieser Preusse wirklich mit der Weltgeschichte um die Wette ritt, so hat sie ihn überholt! Der Wiener General Stutterheim ist seit gestern abend in Tilsit und stellt sich, angesichts der vollendeten Tatsache des Friedens, als habe er niemals den Krieg in den Falten seines weissen Mantels getragen! Dem Kaiser ist es recht. Er wünscht jetzt keine nachträglichen Verwicklungen mit Österreich. Er hat in nächster Zeit genug mit Spanien zu tun! Also schicken wir diese schönen Kinder schleunigst dahin, woher Sie gekommen! . . Einverstanden? Sie können sich dem Gewicht meiner Gründe nicht entziehen? Gut!“
Читать дальше