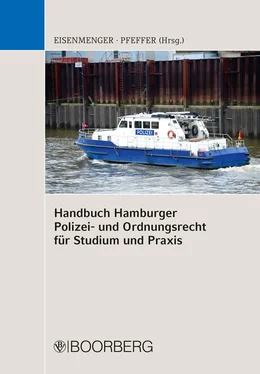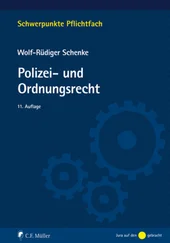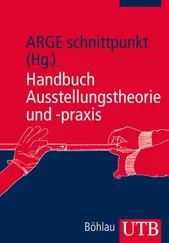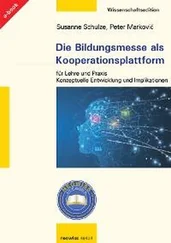– Originäre Leistungsrechte
In diesen Fällen enthalten Grundrechte ausdrückliche Ansprüche gegenüber dem Staat (z. B. Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG mit der Rechtsschutzgarantie oder Art. 103 Abs. 1 GG mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör bei Gericht). Ausnahmsweise abgeleitet aus Art. 1 Abs. 1 GG i. V. m. dem Sozialstaatsprinzip wird auch das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums. 174
– Gleichbehandlungsfunktion
Einige Grundrechte – insbesondere Art. 3 Abs. 1 GG – erfüllen ebenfalls eine Gleichbehandlungsfunktion, an die sich auch derivative Leistungs- und Teilhaberechte anschließen können. 175Hier geht es vor allem um die gleiche Vergabe von Studienplätzen. 176
– Mittelbare Drittwirkung
Ausnahmsweise können Grundrechte auch im Verhältnis zwischen Privaten Wirkkraft entfalten, wenn es im Privatrecht etwa um die Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe wie „Treu und Glauben“ (§ 242 BGB) oder die „guten Sitten“ (§ 138 Abs. 1 BGB) geht, die mithilfe der grundrechtlichen Aussagen konkretisiert werden können. Man spricht insoweit von der mittelbaren Drittwirkung. Ausnahmsweise gelten die Grundrechte auch direkt im Privatrechtsverhältnis im Zusammenhang mit der Koalitionsfreiheit kraft grundgesetzlicher Anordnung (Art. 9 Abs. 3 GG).
– Schutzpflichten
Der Staat hat sich auch schützend vor die Grundrechte zu stellen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 177Aus dem Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG kann man z. B. die Einrichtung einer Polizei zur Gefahrenabwehr herleiten. Zum Teil ist hier auch von Gewährleistungsschutzpflichten 178die Rede. Hierbei besteht ein Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers, wobei der Staat indes ein Mindestmaß an Schutz nicht unterschreiten darf (sog. Untermaßverbot). Dies wäre dann der Fall, wenn kein oder gänzlich ungeeigneter Schutz besteht. 179
– Institutionelle Gewährleistungsfunktion
Auch schützen die Grundrechte einzelne Institute dadurch, dass letztere explizit im GG verankert sind. Zu nennen sind z. B. die Eigentumsgarantie und das Erbrecht in Art. 14 Abs. 1 GG, ferner auch das Berufsbeamtentum in Art. 33 Abs. 5 GG. 180
– Organisations- und Verfahrensrechtsfunktion
Grundrechte beinhalten als „querliegende Funktion“ 181schließlich auch die Pflicht, den organisatorischen Rahmen so zu determinieren, dass Grundrechte adäquat wahrgenommen werden können. Ebenso erwächst aus dieser Funktion die Verpflichtung, Verfahren optimal, z. B. möglichst zügig, durchzuführen. 182
c) Checkliste Grundrechtsprüfung
88
Die Prüfung, ob eine Maßnahme auf dem Gebiet des Gefahrenabwehrrechts (etwa ein Platzverweis oder eine Wohnungsdurchsuchung) mit Grundrechten vereinbar ist, ist Gegenstand der Verhältnismäßigkeitsprüfung in dem praxisrelevanten Rechtmäßigkeitsschema (s. u. B. I.4.b.bb.). Insofern sind die Einzelheiten einer Grundrechtsprüfung zum Verständnis des allgemeinen Rechtmäßigkeitsschemas essenziell. Darüber hinaus sind in Studienarbeiten auch Fragestellungen möglich, die isoliert die Frage der Grundrechtskonformität einer Maßnahme zum Gegenstand haben. Im Rahmen einer solchen Grundrechtsprüfungwerden im Übrigen auch weitere Aspekte der Verfassung berücksichtigt, weshalb es sich zugleich immer auch um eine allgemeine Prüfung der Verfassungskonformität handelt.
89
Die Prüfung, ob ein staatlicher Akt der Gesetzgebung, der Verwaltung oder der Rechtsprechung mit einem Grundrecht vereinbar ist, erfolgt grob gesprochen in drei Stufen. Während in Schritt 1 die Eröffnung des Schutzbereichesdes jeweiligen Grundrechts untersucht wird, also die Frage, ob das Grundrecht sachlich-thematisch auf den Sachverhalt und persönlich auf den Beschwerdeführer anwendbar ist, erfolgt in Schritt 2 die Eingriffsfrage, mithin ob der staatliche Akt als Belastung des Grundrechtsträgers oder lediglich als Bagatelle zu qualifizieren ist. Liegt ein Eingriff vor, ist die Frage zu beantworten, ob dieser Eingriff gerechtfertigt werden kann. Dieser Schritt 3 mit der Rechtfertigungsprüfungist der komplexe Part in der Gesamtprüfung. Hier ist letztlich der Frage nachzugehen, ob der Eingriff – etwa eine einzelne Polizeimaßnahme – auf ein Parlamentsgesetz zurückzuführen ist, welches die Schrankenbestimmungen des GG einhält, ob dieses Gesetz formellen und materiell-inhaltlichen Anforderungen (z. B. Verhältnismäßigkeit) genügt und ob die Entscheidung im Einzelfall ihrerseits verhältnismäßig ist.
90
Im Wesentlichen sind bei allen Fragen rund um die Grundrechtskonformität zwei Prüfungskonstellationen auseinanderzuhalten, und zwar, ob lediglich ein Gesetz als solches überprüft wird (z. B. eine bestimmte gesetzliche Regelungen zur automatischen Kennzeichenerfassung zwecks Abgleich mit dem Fahndungsbestand), oder ob eine konkrete Einzelfallentscheidung der Verwaltung oder eines Gerichts mit Grundrechten vereinbar ist.
91
Im Falle einer Prüfung eines Gesetzesauf Grundrechtskonformität kann wie folgt vorgegangen werden: 183
A. [Grundrecht XX, Art. YY]
Das zu prüfende Gesetz verstößt gegen das Grundrecht XX gem. Art. YY, wenn der Schutzbereich des Grundrechts eröffnet ist (I.), ein Eingriff vorliegt (II.) und der Eingriff nicht gerechtfertigt werden kann (III.).
I. Eröffnung des Schutzbereichs
1. Sachlicher Schutzbereich
Fällt eine gewünschte Verhaltensweise (Tun oder Unterlassen) unter den Schutz des Grundrechts?
2. Persönlicher Schutzbereich
Kann sich der Beschwerdeführer persönlich auf das Grundrecht berufen (Ausländerfragen, juristische Personen, etc.)?
II. Eingriff
Moderner Eingriffsbegriff: Liegt eine Handlung eines Grundrechtsverpflichteten (hier: eine gesetzliche Regelung) vor, die in zurechenbarer Weise zu einer nicht absolut unerheblichen Belastung des Grundrechtsträgers führt? 184
III. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs
1. Grundrechtsschranke: Parlamentsgesetz nötig
Es ist im Fall von Grundrechtseingriffen ein Gesetz nötig, entweder wegen ausdrücklichen einfachen Gesetzesvorbehalteswie in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG oder wegen qualifizierten Gesetzesvorbehaltes, bei dem das GG an das Gesetz bestimmte zusätzliche Anforderungen stellt, z. B. in Art. 11 Abs. 2 GG. In denjenigen Fällen, in denen das GG keine Einschränkbarkeit anspricht (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG), kann eingeschränkt werden aufgrund des Vorbehaltes des Gesetzes gem. Art. 20 Abs. 3 GG (verfassungsimmanente Schranke). 185Im Fall dieser verfassungsimmanenten Schranken wird in aller Regel argumentiert, es könnten nur kollidierende Grundrechte Dritter oder andere mit Verfassungsrang ausgestattete Rechtswerte zur Rechtfertigung herangezogen werden. Es handelt sich indes um eine „Scheineingrenzung“, denn schon die Allgemeine Handlungsfreiheit, Art. 2 Abs. 1 GG, oder das Rechtsstaatsprinzip, Art. 20 Abs. 3 GG, sind so breit angelegt, dass allein hieraus Vieles argumentierbar ist (funktionstüchtige Rechtspflege etc.). 186In den seltenen Fällen der verfassungsunmittelbaren Schranken(z. B. Art. 9 Abs. 2 GG, Art. 13 Abs. 7 HS 1 GG) ist auch ein Gesetz nötig. 187
Dass letztlich in allen o. g. Fällen ein Gesetz des Parlamenteserforderlich ist, ergibt sich auch aus der Wesentlichkeitsgarantie (s. o. A.III.2.), nach der in wesentlichen Bereichen – so gerade im grundrechtsrelevanten Bereich – das Parlament zu entscheiden hat. Dies schließt nicht aus, dass der Gesetzgeber die Exekutive ermächtigt, in Rechtsverordnungen Grundrechtseingriffe zu bestimmen. Die Ermächtigungsgrundlage des Gesetzgebers muss dann aber den Anforderungen des Art. 80 Abs. 1 GG genügen.
Читать дальше