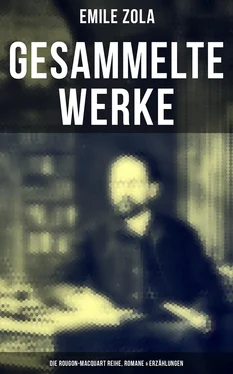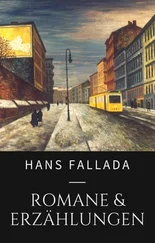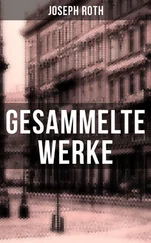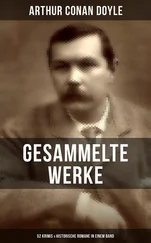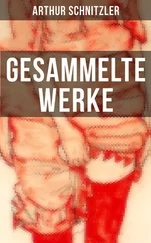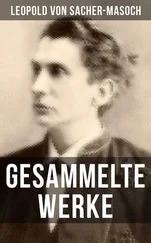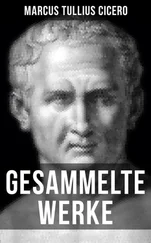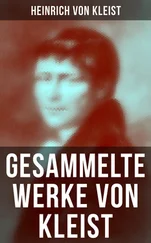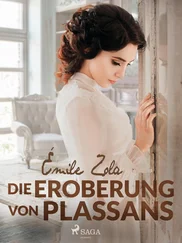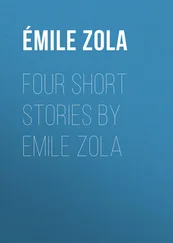Die Bevölkerung von Plassans kann in drei Gruppen eingeteilt werden; so viele Stadtviertel, ebenso viele kleine, abgesonderte Welten. Ausnahmen bilden die Beamten: der Unterpräfekt, der Steuereinnehmer, der Grundbuchführer, der Posthalter, lauter Leute, die aus der Fremde gekommen sind, hier wenig geliebt und sehr beneidet werden und sich daher ihr Leben nach ihrer Behaglichkeit einrichten. Die wirklichen Einwohner von Plassans, die hier geboren und hier zu sterben entschlossen sind, achten zu sehr die überkommenen Gebräuche und die von alters her aufgerichteten Scheidegrenzen, um sich nicht von selbst in einer der gesellschaftlichen Klassen der Stadt einzupferchen.
Die Adligen schließen sich vollständig ab. Seit dem Sturze Karls X. gehen sie kaum mehr aus; und wenn sie ausgehen, schleichen sie furchtsam dahin wie in Feindesland und beeilen sich, in ihre großen, stillen Paläste zurückzukehren. Sie gehen zu niemandem und besuchen sich selbst gegenseitig nicht. In ihren Salons erscheinen höchstens einige Geistliche. Im Sommer bewohnen sie die Schlösser, die sie in der Umgegend besitzen; im Winter bleiben sie am warmen Kamin sitzen. Es sind Tote, die sich durch das Leben hindurch langweilen. In ihrem Stadtviertel herrscht denn auch die dumpfe Stille eines Kirchhofes. Türen und Fenster sind sorgfältig verrammelt. Man glaubt eine Reihe von Klöstern vor sich zu haben, die allem Geräusch der Außenwelt verschlossen sind. Von Zeit zu Zeit sieht man einen Abbé vorbeikommen, dessen leiser Auftritt längs der geschlossenen Häuser die Stille noch zu vertiefen scheint und der dann wie ein Schatten unter einer halb geöffneten Haustür verschwindet.
Der Bürgerstand, d. h. die Kaufleute, die sich von den Geschäften zurückgezogen haben, die Advokaten, die Notare, alle die kleinen Leute, die wohlhabend und voll Ehrgeiz sind, kurz: die Bevölkerung der Neustadt, ist bemüht, Plassans einiges Leben zu verleihen. Sie werden zu den Abendunterhaltungen des Herrn Unterpräfekten eingeladen, und es ist ihr sehnlichster Wunsch, ähnliche Feste zu geben. Sie streben gern nach Volkstümlichkeit, nennen einen Arbeiter: »mein Lieber«, reden mit den Bauern von der Ernte, lesen die Zeitungen und gehen am Sonntag mit ihren Frauen und Töchtern spazieren. Es sind die fortgeschrittenen Geister des Ortes, die einzigen, die einen Witz über die Stadtmauern wagen; sie haben sogar schon wiederholt von der Stadtvertretung die Entfernung dieser »alten Wälle« gefordert, dieser »Überreste einer anderen Zeit«. Das hindert aber nicht, daß die zweifelsüchtigsten unter ihnen von tiefer Freude erfüllt werden, sooft ein Marquis oder ein Graf sie eines leichten Grußes würdigt. Der Traum eines jeden Bürgers der Neustadt geht dahin, in einen Salon der St. Markus-Vorstadt eingeladen zu werden. Sie wissen wohl, daß dieser Traum sich nicht verwirklichen kann, und darum schreien sie nur um so lauter, daß sie Freidenker sind, und sind bereit, bei dem mindesten Grollen des Volkes sich dem erstbesten Retter in die Arme zu werfen.
Die Gruppe, die im alten Stadtviertel arbeitet und ihr Leben fristet, ist nicht so genau zu bestimmen. Das gemeine Volk, die Arbeiter sind da in der Mehrheit; aber es gibt da auch Krämer und sogar einige Großkaufleute. In Wahrheit ist Plassans weit entfernt, ein Handelszentrum zu sein; es wird nur so viel gehandelt, wie nötig ist, um sich der Erzeugnisse der Gegend zu entledigen, die in Öl, Wein, Mandeln bestehen. Was das Gewerbe betrifft, so ist es durch einige Gerbereien vertreten, die mit ihrem Mißdufte eine Straße des alten Quartiers verpesten, dann durch einige Filzhutereien und eine Seifensiederei, welch letztere in einen Winkel der Vorstadt verbannt ist. Diese kleinen Handels- und Gewerbsleute besuchen zwar an hohen Festtagen die Bürger der Neustadt, leben aber zumeist unter den Arbeitern der Altstadt. Kaufleute, Krämer und Arbeiter haben gemeinschaftliche Interessen, die sie zu einer Familie vereinigen. Nur am Sonntag waschen sich die Arbeitgeber die Hände und bleiben dann hübsch unter sich. Die Arbeiter, kaum ein Fünftel der gesamten Bevölkerung, verlieren sich übrigens unter den Müßiggängern der Stadt und ihrer Umgebung.
Solange die schöne Jahreszeit andauert, treffen sich die Bewohner der drei Stadtviertel von Plassans einmal in der Woche. Die ganze Stadt begibt sich am Sonntag nach der Vesper auf die Promenade Sauvaire; selbst die Adeligen wagen sich da einzufinden. Allein in dieser mit zwei Platanenreihen bepflanzten Allee gibt es drei bestimmte Ströme von Spaziergängern. Die Bürger der Neustadt durchschreiten sie nur; sie gehen durch das große Tor hinaus und wenden sich rechts nach der Poststraße, wo sie bis zur sinkenden Nacht auf- und abspazieren. Während dieser Zeit teilen sich der Adel und das Volk in die Promenade Sauvaire. Seit mehr denn hundert Jahren hat der Adel die Südallee gewählt, an der eine Reihe von großen Palästen steht und die zuerst Schatten bekommt; das Volk mußte sich mit der Nordallee begnügen, wo die Kaffeehäuser, die Gastwirtschaften und die Tabakläden stehen. Den ganzen Nachmittag wandeln Volk und Adel auf und nieder, ohne daß es jemals einem einfiele, aus der einen Allee in die andere hinüberzugehen. Eine Entfernung von sechs bis acht Metern bloß trennt sie; aber sie bleiben tausend Meilen weit voneinander, indem sie genau zwei parallel laufenden Linien folgen, als sollten sie in diesem irdischen Jammertal einander gar nie begegnen. Selbst in den aufrührerischen Zeiten ist jede Klasse in ihrer Allee geblieben. Dieser regelmäßige Sonntagsspaziergang und das Schließen der Stadttore am Abend sind zwei Dinge, die derselben Art zu denken entspringen und zur Beurteilung der zehntausend Seelen dieser Stadt genügen.
In dieser eigenartigen Umgebung lebte bis zum Jahre 1848 eine unbedeutende und wenig geachtete Familie, deren Oberhaupt, Pierre Rougon , infolge gewisser Umstände später eine bedeutsame Rolle spielen sollte.
Pierre Rougon war ein Bauernsohn. Die Sippschaft seiner Mutter – die »Fouque«, wie man sie nannte – besaß zu Ende des vorigen Jahrhunderts ein ausgedehntes Grundstück in der Vorstadt hinter dem alten Saint-Mittre-Kirchhofe; dieses Grundstück war später mit dem Jas-Meiffren vereinigt worden. Die Fouque waren die reichsten Gemüsegärtner der Gegend; sie lieferten das Gemüse einem ganzen Stadtviertel von Plassans. Einige Jahre vor der Revolution erlosch der Name dieser Familie. Nur eine Tochter war übrig geblieben, Adelaide mit Namen, geboren im Jahre 1768, die mit achtzehn Jahren verwaist war. Dieses Mädchen, dessen Vater im Irrsinn starb, war ein großes, schmächtiges, bleiches Geschöpf mit scheuen Blicken und einem seltsamen Benehmen, das man für wilde Scheu halten konnte, solange sie klein war. Aber als sie größer ward, betrug sie sich noch seltsamer. Sie beging gewisse Handlungen, die die gescheitesten Köpfe der Vorstadt sich nicht recht erklären konnten. So entstand allmählich das Gerücht, daß sie verrückt sei wie ihr Vater. Seit sechs Monaten kaum stand sie allein im Leben als Besitzerin eines Vermögens, das eine sehr begehrenswerte Erbin aus ihr machte, als man erfuhr, daß sie sich mit einem Gärtnergehilfen namens Rougon verheiratet habe, einem ziemlich plumpen Bauer, der aus dem Lande der Niederalpen eingewandert war. Nach dem Tode des letzten Fouque, der ihn auf einen Sommer gedungen hatte, war dieser Rougon im Dienst der Tochter des Verstorbenen geblieben. Aus einem Lohndiener ward er plötzlich der beneidete Gatte. Diese Heirat war die erste Tatsache, die die öffentliche Meinung in Staunen versetzte; niemand konnte begreifen, weshalb Adelaide diesen armen Teufel, diesen ungeleckten, schwerfälligen Bauer, der kaum der Landessprache kundig war, sovielen jungen Burschen vorzog, Söhnen von wohlhabenden Landwirten, die sich lange Zeit um sie beworben hatten. Und da in der Provinz nichts unaufgeklärt bleiben darf, wollte man hinter dieser Geschichte durchaus irgendein Geheimnis wittern; man behauptete sogar, diese Heirat sei zwischen den beiden jungen Leuten eine unabweisliche Notwendigkeit geworden. Allein die Tatsachen widerlegten all diesen Klatsch. Adelaide gebar erst nach einem Jahre einen Sohn. Darüber war nun die Vorstadt empört; sie konnte nicht zugeben, daß sie sich geirrt habe; sie verlegte sich darauf, das angebliche Geheimnis zu ergründen. Darum machten sich alle Klatschbasen auf, um die Rougons auszuspähen. Sie sollten denn auch bald reichlichen Stoff zu schwatzen finden. Eines Tages nach fünfzehnmonatiger Ehe starb Rougon plötzlich. Ein Sonnenstich, den er sich bei der Arbeit auf einem Möhrenfelde holte, hatte seinem Leben ein jähes Ende gemacht. Seither war kaum ein Jahr verflossen, als die junge Witwe ein unerhörtes Ärgernis hervorrief. An gewissen Anzeichen merkte man, daß sie einen Geliebten habe. Sie schien daraus kein Hehl zu machen; mehrere Leute behaupteten gehört zu haben, wie sie den Nachfolger des armen Rougon öffentlich duzte. Kaum ein Jahr Witwe und schon einen Geliebten! Eine solche Mißachtung aller Rücksichten der Schicklichkeit schien ungeheuer, wider alle gesunde Vernunft.
Читать дальше