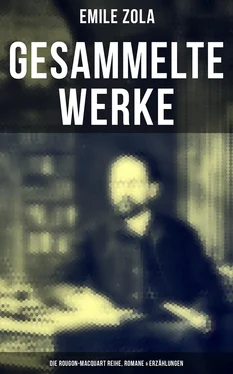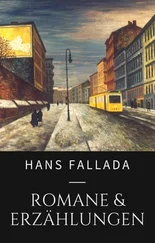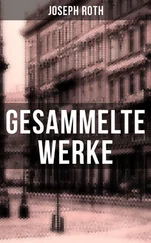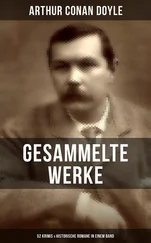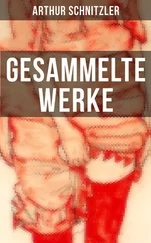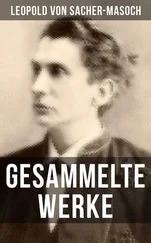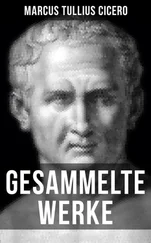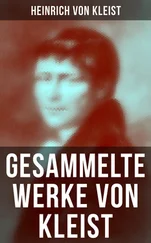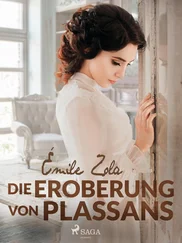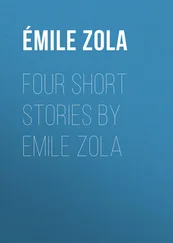Gebt mir die Fahne, ich werde sie tragen.
Die Arbeiter begriffen mit ihrem einfachen Sinn das Kindlich-Erhabene dieses Dankes.
Ja, ja, riefen sie. Die Chantegreil soll die Fahne tragen.
Ein Holzschläger bemerkte, daß sie bald ermüden, nicht weit kommen werde.
Oh, ich bin stark! rief sie, indem sie die Ärmel ihrer Jacke zurückstreifte und ihre Arme zeigte, die schon so stark waren wie die eines erwachsenen Weibes.
Als man ihr die Fahne reichte, sagte sie:
Wartet einen Augenblick!
Sie zog rasch den Mantel aus, wandte die Innenseite nach außen und warf ihn so wieder um ihre Schultern. Sie erschien jetzt im bleichen Lichte des Mondes eingehüllt in einen weiten Purpurmantel, der ihr bis zu den Füßen herabfiel. Die Kapuze, durch den Rand ihres Haarwulstes festgehalten, saß wie eine Art phrygischer Mütze auf ihrem Haupte. Sie ergriff die Fahne, drückte den Schaft an ihre Brust und stand aufrecht da, umwallt von dem roten Banner, das hinter ihr flatterte. In dem halb gen Himmel gerichteten Haupt eines begeisterten Kindes mit dem krausen Haar, mit den großen, feuchten Augen, mit den in einem Lächeln erschlossenen Lippen sprach sich stolze Energie aus. In diesem Augenblicke verkörperte sie die jungfräuliche Wahrheit.
Die Aufständischen jubelten ihr zu. Diese mit einer lebhaften Einbildungskraft begabten Südländer wurden ergriffen und begeistert durch die plötzliche Erscheinung dieses großen, vom Scheitel bis zur Sohle roten Mädchens, das die Fahne krampfhaft an seine Brust drückte. Einzelne Rufe wurden in der Gruppe laut:
Bravo, Chantegreil! Es lebe die Chantegreil! Sie bleibe bei uns! Sie wird uns Glück bringen!
Noch lange hätte man ihr zugejubelt, wenn nicht der Befehl zum Weitermarsch erteilt worden wäre. Und während die Kolonne sich in Bewegung setzte, drückte Miette Silvère, der sich neben sie gestellt hatte, die Hand und flüsterte ihm ins Ohr:
Ich bleibe bei dir, hörst du?
Statt aller Antwort erwiderte Silvère ihren Händedruck. Er nahm ihr Anerbieten an. Er war tief bewegt und überließ sich der nämlichen Begeisterung wie seine Gefährten. Miette war ihm so schön, so groß, so heilig erschienen! Während des ganzen Abstieges sah er sie vor sich, strahlend, in purpurner Herrlichkeit. Jetzt verwechselte er sie mit einer anderen angebeteten Geliebten, mit der Republik. Gern wäre er schon in Plassans angekommen, um seine Flinte schultern zu können. Allein die Aufständischen erstiegen nur langsam den Abhang. Es war der Befehl erteilt worden, so wenig Lärm wie möglich zu machen. Die Kolonne rückte zwischen den Ulmen vor gleich einer Riesenschlange, an der jeder Ring ein eigentümliches Zittern zeigt. Die eisige Dezembernacht war wieder still geworden; die Viorne allein schien etwas lauter zu murmeln.
Sobald die ersten Häuser der Vorstadt erreicht waren, lief Silvère voraus, um seine Flinte vom Saint-Mittre-Feld zu holen, das noch im stillen Mondlichte dalag. Als er wieder zu den Aufständischen stieß, waren sie eben bei dem Römertor angekommen. Miette neigte sich zu ihm und sagte mit einem kindlichen Lächeln:
Mir ist, als wäre ich in der Fronleichnamsprozession und als trüge ich die Fahne der heiligen Muttergottes.
Inhaltsverzeichnis
Plassans ist der Sitz einer Unterpräfektur und zählt beiläufig zehntausend Seelen. Auf der Hochebene erbaut, die die Viorne beherrscht, im Norden an die Hügel von Garrigues, eine der letzten Abzweigungen der Alpen sich lehnend, liegt die Stadt gleichsam in einer Sackgasse. Im Jahre 1851 verkehrte sie mit der Umgegend nur durch zwei Straßen: die Nizzaer Straße, die gen Osten absteigt, und die Straße von Lyon, die gen Westen aufsteigt, die eine die andere fortsetzend in zwei fast parallelen Linien. Seither ist eine Eisenbahn gebaut worden, deren Linie die Stadt im Süden berührt, am Fuße des Abhanges, der von den alten Stadtwällen steil zum Flüßchen abfällt. Wenn man heute aus dem Bahnhofe tritt, der am rechten Ufer der Viorne liegt, sieht man aufblickend die ersten Häuser von Plassans, deren Gärten Terrassen bilden. Man muß eine gute Viertelstunde bergauf klettern, bis man diese Häuser erreicht.
Noch vor zwanzig Jahren hatte – ohne Zweifel infolge des Mangels an Verkehrswegen – keine zweite Stadt so sehr wie Plassans den frommen und aristokratischen Charakter der alten provençalischen Städte bewahrt. Die Stadt besaß und besitzt heute noch ein ganzes Viertel von Herrenhäusern, die unter Ludwig XIV. und Ludwig XV. erbaut wurden, ein Dutzend Kirchen, ein Jesuiten- und ein Kapuziner-Ordenshaus und eine ansehnliche Anzahl von Klöstern. Die Verschiedenheit der Klassen wurde hier lange Zeit durch die Sonderung der Stadtviertel gekennzeichnet. Plassans zählt deren drei, deren jedes für sich gleichsam einen besonderen, vollständigen Stadtteil bildet, der seine eigene Kirche, seinen eigenen Spazierweg, seine besonderen Sitten und Gebräuche, seinen besonderen Gesichtskreis hat.
Das Adelsviertel – auch das St.-Markus-Viertel genannt nach einer der Pfarren, die hier die Seelsorge versehen – ein Klein-Versailles mit engen, grasüberwucherten Gäßchen, deren breite, viereckige Häuser große Gärten verbergen, dehnt sich im Süden, am Rande der Hochebene aus. Manche Herrenhäuser, knapp am Abhange gebaut, haben ein Doppelstockwerk von Terrassen, von denen aus man das ganze Viornetal überschauen kann, – ein herrlicher, in der Gegend vielgerühmter Aussichtspunkt. Das alte Viertel, die »Altstadt«, erhebt sich im Nordwesten mit ihren engen, krummen Gäßchen, die von baufälligen Hütten eingesäumt waren. Hier befinden sich: das Bürgermeisteramt, das Zivilgericht, der Markt, die Gendarmerie. Dieser Teil von Plassans – der volkreichste – ist von Arbeitern, Geschäftsleuten, all dem kleinen Volk der Not und Plage bewohnt. Die Neustadt endlich bildet eine Art Längenviereck im Nordosten; die Bürgerklasse, d. h. die Leute, die Heller für Heller ein Vermögen gesammelt haben, und die einen sogenannten freien Beruf ausüben, wohnen hier in säuberlich aneinander gereihten, hellgelb getünchten Häusern. Dieses Stadtviertel mit der Unterpräfektur – einem häßlichen Bau mit Gipsanwurf und Rosettenschmuck – zählte im Jahre 1851 kaum fünf oder sechs Straßen. Es ist der neueste Stadtteil und der einzige, der seit dem Bau der Eisenbahn einige Entwicklungsfähigkeit zeigt.
Was die Stadt Plassans bis auf den heutigen Tag noch in drei unabhängige, bestimmt abgegrenzte Teile sondert, das ist der Umstand, daß die Stadtviertel durch breite Straßen begrenzt sind. Die Promenade Sauvaire und die Romstraße, welch letztere gleichsam eine engere Fortsetzung der ersteren ist, laufen von West nach Ost, vom großen Tor bis zum Römertor und schneiden so die Stadt in zwei Teile, das Adelsviertel von den zwei anderen Stadtvierteln absondernd. Diese wieder sind durch die Banne-Straße voneinander geschieden; diese Straße, die schönste der Gegend, beginnt am Ende der Promenade Sauvaire, steigt gen Norden hinan und läßt die schwarzen Häusermassen des alten Stadtviertels links, die hellgelben Häuser der Neustadt rechts liegen. Hier, ungefähr in der Mitte der Straße, auf einem kleinen, mit zwerghaften Bäumen bepflanzten Platze, erhebt sich die Unterpräfektur, ein Bau, auf den die Bürger von Plassans sehr stolz sind.
Wie um sich noch mehr zu vereinsamen und zu verschließen, ist die Stadt mit einem Gürtel alter Wälle umgeben, die heute nur mehr dazu dienen, die Stadt noch schwärzer und noch enger erscheinen zu lassen. Mit Gewehrkolbenschlägen könnte man diese lächerlichen Mauern niederwerfen, die von Unkraut zerfressen, von wilden Nelken gekrönt, kaum höher und dicker sind als die Mauern eines Klosters. Sie sind an mehreren Stellen von Toren durchbrochen; die zwei größten sind das Römertor und das große Tor, das erstere geht auf die Nizzaer Straße, das letztere am andern Ende der Stadt auf die Lyoner Straße aus. Bis zum Jahre 1853 waren diese Maueröffnungen mit zweiflügeligen, oben gewölbten Toren von starkem, eisenbeschlagenem Holze versehen. Im Sommer um elf Uhr, im Winter um zehn Uhr abends wurden diese Tore fest verschlossen. Wenn die Stadt einmal die Riegel vorgeschoben hatte wie ein furchtsames Mädchen, dann überließ sie sich ruhig dem Schlafe. Ein Wächter, der eine im innern Winkel des Tores stehende Hütte bewohnte, öffnete den Stadtbewohnern, die sich draußen verspätet hatten. Aber das ging nicht ohne längere Unterhandlungen. Der Torwart ließ die Leute erst ein, wenn er durch eine im Tor angebrachte Klappe mit seiner Laterne ihnen längere Zeit ins Gesicht geleuchtet hatte. Wer ihm nicht gefiel, konnte draußen schlafen. Der ganze Geist dieser Stadt, zusammengesetzt aus Feigheit, Eigennutz, Festhalten am Althergebrachten, aus Haß gegen alles Fremde und aus einem fanatischen Hang zum einsamen, klösterlichen Leben, drückte sich in diesem sorgfältigen, jeden Abend sich wiederholenden Torschluß aus. Wenn Plassans sich gut verriegelt hatte, sagte es: »Ich bin zu Hause« – mit der Zufriedenheit des frommgläubigen Spießbürgers, der ohne Furcht um seinen Säckel, und sicher, daß er durch keinerlei Geräusch geweckt wird, sein Abendgebet verrichtet und froh zu Bett geht. Es gibt, wie mich dünkt, keine zweite Stadt, die so lange eigensinnig an dem Brauche festgehalten hätte, sich einzuschließen wie eine Nonne.
Читать дальше