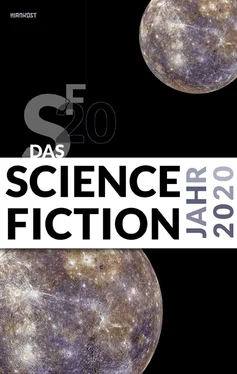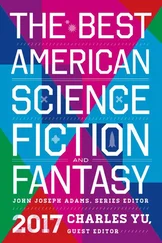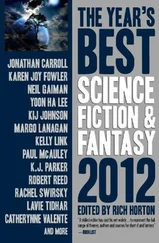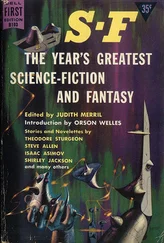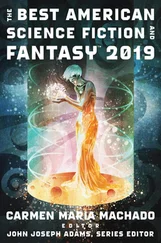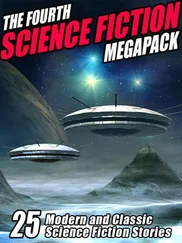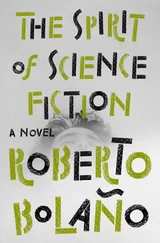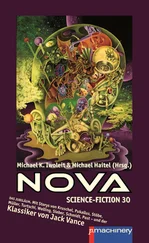Ein anderer Punkt ist Kids Hautfarbe. Auch er wird mit dem Rassismus, der Bellona trotz gegenteiliger Beteuerung der Protagonisten durchzieht, immer wieder konfrontiert.[19] So fragt ihn Joaquim, der die Zeitung verteilt: »[D]u bist nicht farbig, oder? Du bist nämlich ganz schön dunkel, irgendwie ausgeprägt« (S. 95); und die Predigerin Amy Taylor wundert sich: »Als ich Sie neulich sah, dachte ich, Sie wären schwarz. Ich glaube, weil Sie so dunkel sind.« (S. 244)[20] Kids Identität als Indio-Amerikaner bewirkt Irritationen und sorgt für Uneindeutigkeit; einerseits bestätigt sich damit sein Status als Grenzgänger, andererseits läuft er Gefahr, in die rassistisch motivierte Gewalt in Bellona hineingezogen zu werden. Das Attentat vom Dach der Second City Bank, das sowohl vom Zeitpunkt als auch von der Zahl der Opfer her variiert,[21] bei dem aber immer ein Weißer auf Schwarze schießt, wäre ein Beispiel hierfür; ein weiteres ist der »Abend, an dem die Schwarzen revoltierten« (S. 249), auf den ebenfalls fortwährend angespielt wird.
Kids wahrscheinlich markanteste Eigenschaft ist sein Schreiben, das den ganzen Roman durchzieht und dessen Ergebnis Dhalgren möglicherweise zum Teil ist. Zumindest stehen die bereits zitierten Anfangszeilen in jenem zur Hälfte vollgeschriebenen Notizbuch, das Lanya findet, und in dem das Ende des Romans – »die Blitze und die Explosionen« (S. 47) – sowie die Schlusszeilen festgehalten sind.[22] Tatsächlich wird zu Beginn der Handlung die Möglichkeit geäußert, dass Kid zumindest theoretisch »irgendein Typ« sein könnte, den sich »irgendein anderer in seinem verlorengegangenen Notizbuch ausgedacht hat« (S. 10), womit sich der erzählerische Kreis ein weiteres Mal schließt: Die Fiktion (Dhalgren) und die Fiktion innerhalb der Fiktion (das Notizbuch) sind unauflöslich miteinander verzahnt; die Frage, was zuerst da gewesen sein muss, führt ins Leere.
Kid beginnt, das Buch für seine eigenen Texte zu verwenden, wobei er zunächst bescheiden anmerkt: »Ich schreibe einfach so Sachen auf.« (S. 185) Erst anlässlich der Begegnung mit dem Schriftsteller Ernest Newboy bezeichnet er sich als Lyriker, was dieser mit einem Publikationsangebot im Namen von Roger Calkins quittiert. Kurz darauf formuliert Kid sein Ziel: »Ich möchte Dichter sein. Ich möchte ein großer, berühmter, wunderbarer Dichter sein.« (S. 216) Diese Rolle besetzt er rasch, auch wenn er gegenüber Frank – einem weiteren Schriftsteller – zugibt, noch nichts veröffentlicht zu haben und erst kurze Zeit Dichter zu sein; der Zusatz »Seit ich hier bin« (S. 364) verweist auf die spezifische Rolle Bellonas als Katalysator. Kid hat erste Erfolge und träumt von künstlerischem Ruhm, muss jedoch bei einem weiteren Gespräch Newboy gegenüber eingestehen, dass nicht alles im Notizbuch von ihm stammt, was dieser mit »Das ist aber peinlich« (S. 447) kommentiert. Die Frage, was Kid geschrieben hat und was nicht, wird auf der Party diskutiert, die Roger Calkins veranstalten lässt und auf der Frank zunächst die Gedichte als »pompös und überemotional« (S. 791) kritisiert, um dann – »Ich frage mich übrigens, […] ob er sie wirklich selber geschrieben hat« (S. 800) – die Autorschaft anzuzweifeln. Im 7. Kapitel zeigt sich Kid über das Erreichte verunsichert. Einerseits beendet er das Notizbuch, weil es vollgeschrieben ist, andererseits räumt er ein: »Manchmal kann ich nicht sagen, wer was geschrieben hat.« (S. 872) Auch ist die Chronologie der Einträge unklar. Entsprechend häufen sich Selbstzweifel: »Ich bin kein Dichter« (S. 903) und »Ich schreibe nichts« (S. 927) – eine Aussage, die allerdings im Widerspruch zu den neuen Gedichten steht, die am Ende des Romans verbrennen. Der Eindruck, »der Autor habe den Faden verloren« (S. 956), den Kid auf sein Leben bezieht, überträgt sich mehr und mehr auf das Buch, das schließlich in einer Katastrophe endet. Die Stadt wird zerstört, und Kid verlässt Bellona in dem Glauben, keine Dichterpersönlichkeit mehr zu sein. Doch da das Romanende in den Anfang übergeht, wiederholt sich der Zyklus, diesmal womöglich mit einer weiblichen Version von »Kid«, die das vollgeschriebene Notizbuch weiterführt: Es ist ja bereits jetzt in »vier völlig verschiedene[n] Handschriften« (S. 446) gehalten, sodass eine weitere trotz des vollgeschriebenen Zustand denkbar wäre.
6
Dies alles spielt sich in Bellona ab, deren Name nicht zufällig auf die römische Kriegsgöttin verweist. Zum einen wirkt die Stadt im Kontrast zu ihrem Umfeld wie ein abgegrenzter mythologischer Bereich, zum anderen erscheint sie tatsächlich als ein gewalttätiger und anarchistischer Ort. Tak Loufer erklärt Kid, in Bellona wäre er »frei«: »Keine Gesetze; keine, die man erfüllt, keine, die man bricht. Kannst tun, was du willst.« Und: »Sehr schnell, überraschend schnell wirst du […] genau zu dem, der du bist.« (S. 29) Doch Bellona ist keine »Hippie-Stadt« (S. 56), sondern hat eine »komplizierte Sozialstruktur« (S. 851), die Aristokraten, Bettler und Vertreter der Bourgeoisie ebenso einschließt wie Bohemiens – wobei die Richards als Vertreter eine kleinbürgerlichen Mittelschicht negativ gezeichnet werden, auch wenn Madame Brown sie als »normale, gesunde Familie« (S. 971) bezeichnet. In diesem Panorama kann man ein Modell für andere Metropolen in den USA sehen; etwa von New York, mit der der Roman immer wieder in Verbindung gebracht worden ist.
Letztlich aber zeigt sich Bellona als ein schwer bestimmbarer Ort, an dem sich Straßen und Orte unentwegt zu verändern scheinen und selbst die Richtung des Sonnenaufgangs Rätsel aufgibt: »Die ganze Stadt bewegt sich, ändert sich, formt sich um. Immerzu. Und formt uns um …« (S. 50) In ihrer Rolle als Katalysator für Selbstfindungsprozesse ist Bellona genau das, was Kid interessiert, zumal sie auch eine zeitliche Entrückung auszeichnet. Die Protagonisten sind sich bewusst, in einer »ewigen« (S. 624) bzw. »zeitlosen« (S. 825/900) Stadt am »Rand von Wahrheit und Lügen« (S. 604) zu leben, die von der Umwelt »vergessen« (S. 84) wurde und in der selbst Naturgesetze nur bedingt Gültigkeit besitzen; Roger Calkins trägt dieser Tatsache Rechnung, indem er die Bellona Times mit willkürlichen Datumsangaben ausstattet, auf die ebenso wenig Verlass ist wie auf manche der abgedruckten Artikel. Damit unterscheidet sich Bellona fundamental von typischen Katastrophenstädten der Science Fiction, die eindeutig gestaltet sind; in ihrer Rolle als kreativer Impulsgeber erinnert sie allenfalls an die Palm Springs nachempfundene Künstlerkolonie Vermilion Sands in dem gleichnamigen Buch von J. G. Ballard (1971; dt. Die tausend Träume von Stellavista).
Doch Bellona ist mit zwei Himmelsbeobachtungen verbunden: Einer sich aufblähenden Riesensonne, die kurz am Himmel zu sehen ist, und der Tatsache, dass der Erdmond hier einen zweiten und erheblich kleineren Begleiter hat, der nur halb ironisch den Vornamen von George Harrison erhält.[23] Kid – »So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen« (S. 556) – versucht, beide Phänomene mit Captain Michael Kamp zu klären, einem Teilnehmer der fünften erfolgreichen Mondlandung,[24] der damit als wahrheitsstiftende Instanz fungiert; hierzu passt, dass Kid gerne selber »zum Mond gehen« (S. 591) möchte, um eine vergleichbare Position einzunehmen. Aber Kamp kann die beiden Objekte nur als Erscheinungen klassifizieren, die außerhalb von Bellona nicht nachweisbar sind, da sie sonst Gegenstand astronomischer Untersuchungen geworden wären: »Doch niemand hat mir davon berichtet.« (S. 578) Beide Phänomene lassen sich zumindest metaphorisch deuten – die kalte und folgenlos dahinglühende Sonne repräsentiert Kids rasch verblassende literarische Ambitionen (bzw. deren Wirkung in der Öffentlichkeit), während die Mondbenennung im Kontext der schwelenden Rassenkonflikte gesehen werden kann – nicht ein (weißer) Mond bestimmt die Szenerie, es müssen derer zwei sein. Dies klingt auch in Amy Taylors Predigt an: »Ihr habt also den Mond gesehen! Ihr habt also den George gesehen – den rechten und linken Hoden Gottes, so schwer am Morgen, daß sie durch die Schleier brachen und nackt über uns baumelten?« (S. 604) Die Darstellung ist – zumal im Rahmen einer Predigt – polemisch, bestätigt den Einheitsgedanken jedoch indirekt.
Читать дальше