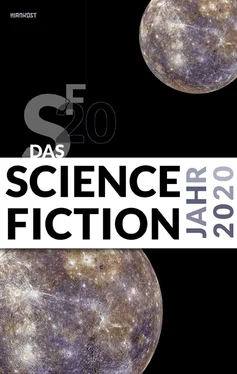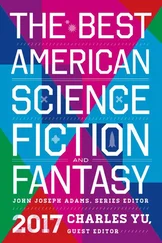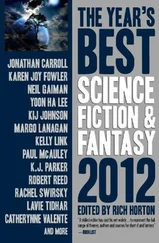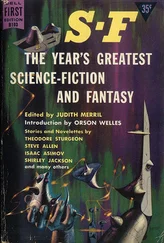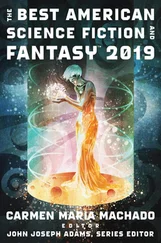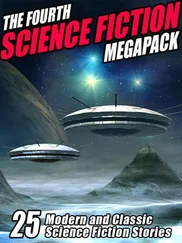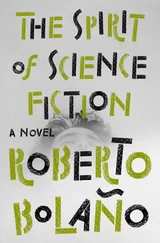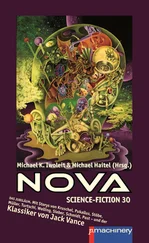Ich persönlich gehe damit übrigens recht entspannt um. Wenn ich dann mal Barbara bin, bemühen sich die meisten Leute, mich korrekt anzusprechen, aber hin und wieder rutscht ihnen doch mal ein »Bernhard« oder ein »er« heraus. Vielleicht weil sie mich ursprünglich so kennengelernt haben, oder weil sie in diesem Moment eher meine männliche Seite wahrnehmen. Andererseits haben sich einige meiner Freunde und Freundinnen angewöhnt, mich fast immer »Barbara« oder »Babsi« zu nennen, auch wenn ich gerade männlich konnotierte Kleidung trage. Ich selbst weiß manchmal nicht so genau, wie ich mich gerade fühle, also kann ich wohl kaum erwarten, von anderen Personen stets korrekt gegendert zu werden. Ich finde es eher interessant zu beobachten, wie ich in bestimmten Momenten auf meine Mitmenschen wirke. – Das ist allerdings, wie gesagt, meine ganz persönliche Einstellung. Andere Transmenschen, die vielleicht einen völlig anderen Hintergrund haben als ich, sehen das eventuell auch völlig anders.
Die Science Fiction hat viel zur Genderdebatte beigetragen und bereits sehr unterschiedliche Möglichkeiten durchdekliniert. Konkrete Prognosen sind naturgemäß schwierig, da sich heute noch gar nicht abschätzen lässt, auf welche Weise die Biotechnologie das Geschlechterspektrum verändern oder erweitern könnte und welche gesellschaftlichen und sprachlichen Folgen sich daraus ergeben würden. Der Idealfall wäre ohnehin eine Utopie, in der physische oder psychische Geschlechtsmerkmale gar keinen Einfluss mehr auf die Art des zwischenmenschlichen Umgangs miteinander hätten.
Quellen
Ich bin dann mal Barbara (D/CH/BR 2013), Kurzfilm, 13 min., Regie: Antoine Guerreiro do Divino Amor, https://vimeo.com/83859734
Peter David, Captain Calhoun. Die neue Grenze 1 (München: Heyne, 2000); Nachdruck: Kartenhaus (Ludwigsburg: Cross-Cult, 2011) [Star Trek – New Frontier: House of Cards & Into the Void, 1997]
Greg Egan, Qual (München: Heyne, 1999) [Distress, 1995]
Greg Egan, Teranesia (München: Heyne, 2001) [Teranesia, 1999]
Ann Leckie, Die Maschinen (München: Heyne, 2015) [Ancillary Justice, 2013]
Ann Leckie, Die Mission (München: Heyne, 2016) [Ancillary Sword, 2014]
Ann Leckie, Das Imperium (München: Heyne, 2017) [Ancillary Mercy, 2015]
Ian McDonald, Cyberabad (München: Heyne, 2012) [River of Gods, 2004]
John Scalzi, Das Syndrom (München: Heyne, 2015) [Lock In, 2015]
John Scalzi, Frontal (Frankfurt am Main: Fischer Tor, 2018) [Head On, 2018]
John Scalzi, Kollaps – Das Imperium der Ströme 1 (Frankfurt am Main: Fischer Tor, 2017) [The Collapsing Empire, 2017]
John Scalzi, Verrat – Das Imperium der Ströme 2 (Frankfurt am Main: Fischer Tor, 2019) [The Consuming Fire, 2019]
John Scalzi, Das Imperium der Ströme 3 (im Erscheinen) [The Last Emperox, 2020]
Kai U. Jürgens
»Ich könnte diese vage, verschwommene Stadt verlassen …«
Zum 40. Geburtstag der Übersetzung von Samuel R. Delanys Roman Dhalgren
Mein Leben hier ähnelt mehr und mehr einem Buch,
dessen Anfangskapitel, ja auch dessen Titel Rätsel
beinhalten, die erst am Ende enthüllt werden.
Dhalgren, S. 956[1]
1
Jede Literatur hat ihre Großromane: Bücher, die bereits dem Umfang nach Herausforderungen darstellen und mit dem respektgebietenden Nimbus versehen sind, ihre Themen auf innovative, komplexe und bisweilen schwer verständliche Weise abzuhandeln. Mitunter geht von diesen erratisch wirkenden Ungetümen eine erstaunliche Aura aus, die sie nicht nur zu erfolgreichen »Longsellern«, sondern auch zu Kultbüchern macht. Ulysses (1922) von James Joyce wäre so ein Fall oder Zettel’s Traum (1970) von Arno Schmidt; ein Zehnkiloobjekt, das seinen Ruf als Überbuch in immer neuen Auflagen (und zwei Raubdrucken) verteidigt.
Im Bereich der Science Fiction kommt dieser Status Dhalgren von Samuel R. Delany zu, ein im Original »voluminös verstörender«[2] 800-Seiten-Roman, der 1975 erstveröffentlicht wurde und trotz ambivalenter Kritiken – sowohl Harlan Ellison als auch Philip K. Dick lehnten das Buch ab – zum erfolgreichsten Titel des Autors wurde; die Gesamtauflage soll eine Million Exemplare schon länger überschritten haben. Acht verschiedene Ausgaben sind über die Jahre erschienen; dazu kommen noch eine Version als E-Book und eine limitierte Auflage für Sammler. Und das, obwohl offenbar kein Verlag bislang die den Autorenintentionen entsprechende Fassung einzurichten vermochte, wie eine von Delany autorisierte und umfängliche Korrekturliste aus dem Jahr 2012 belegt.[3]
In Deutschland erschien Dhalgren im September 1980 als »SF-Special« bei Bastei Lübbe, wobei Michael Görden als Herausgeber fungierte und Michael Kubiak das Lektorat besorgte. Annette Charpentier[4] hat bei Dhalgren »wochen-, ja monatelang an der Übersetzung herumgetüftelt« und schreibt rückblickend: »Ich weiß noch, wie ich mich völlig in den Text versenkt habe, sozusagen von innen heraus übersetzt, und manche Szenen sind mir noch lebhaft im Gedächtnis.«[5] Die Leistung ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass kein Kontakt zum Autor bestand.[6] Dhalgren eröffnete eine Art Werkausgabe, in deren Verlauf der Verlag Bastei Lübbe bis 1988 die meisten Delany-Texte mit Genrebezug veröffentlichen konnte. Dieser weitreichende Schritt dürfte auf das gestiegene Publikumsinteresse in der Nachfolge des Welterfolgs Star Wars (George Lucas; USA 1977) zurückzuführen sein, der den etablierten Science-Fiction-Reihen und ihren Herausgebern neue Spielräume ermöglichte. Dass diese nicht von Dauer sein sollten, zeigt sich schon daran, dass Bastei Lübbe den NEVÈRYON-Zyklus unabgeschlossen ließ, da der vierte Band The Bridge of Lost Desire (1987) dort nicht erscheinen konnte. Dies mag auch damit zu tun gehabt haben, dass Delany in einem Verlag erschien, der vom Feuilleton nicht wahrgenommen wurde, sodass ein literarisch erfahreneres Publikum dort nicht einzuspringen vermochte, wo Genreenthusiasten zunehmend mit Ratlosigkeit und Desinteresse reagierten. Dhalgren konnte zwar im November 1981 noch eine zweite Auflage erreichen, doch die offensichtlichen Ambitionen wurden dem Roman selbst in Reclams Science Fiction Führer zum Vorwurf gemacht – er wäre keine SF, daher an Hochliteratur zu messen und im Hinblick auf Thomas Pynchons Meisterwerk Gravity’s Rainbow (1973; dt. Die Enden der Parabel) »arm an Aussagen und Originalität«.[7] Nachfolgend sollte es dann nur sehr vereinzelt zu einer weiteren Beschäftigung mit Delany im deutschsprachigen Raum kommen. Kein Wunder also, wenn Dhalgren unterdessen weitgehend vergessen ist; ein Schicksal, das das Buch mit seinem Autoren teilt: Die 2012 begonnene Neuedition von Delanys Werken durch den Golkonda Verlag ist trotz aller Sorgfalt bereits drei Jahre später ins Stocken geraten; eine Weiterführung erscheint fraglich. Annette Charpentier: »Für Dhalgren war auch eine überarbeitete Neuausgabe geplant, bei Golkonda, wiederum unter Michael Görden, aber das Projekt wurde nach den sehr mäßigen Verkaufszahlen der Neuauflage der Nimmèrÿa-Geschichten nicht realisiert.«[8]
Bedenkt man, welche Rolle Delany im literarischen Betrieb der USA spielt, dann trägt diese Entwicklung zumindest erstaunliche Züge. Der Autor ist dort nämlich längst keine Genrefigur mehr, sondern wird schon lange als »Schüsselautor der Postmoderne«[9] gewürdigt; er gilt als »writer and thinker whose work had an enormous influence across a startling range of literary and paraliterary genres, including science fiction, autobiography, pornography, historical fiction, comic books, literary criticism, queer theory, and more«.[10] Doch selbst wenn man sich auf seine Anfänge als reiner Science-Fiction-Autor beschränkt, liegt die Messlatte hoch: »Unbestritten war [Delany] zusammen mit Roger Zelazny das Ereignis in der amerikanischen Science Fiction der sechziger Jahre und hat, wie kaum ein zweiter, die Gestalt und die Ausdrucksfähigkeit der Gattung auf ein neues, in diesem Genre nicht zu vermutendes Niveau gehoben.«[11] Dass für Delany hierzulande weder in- noch außerhalb der SF Platz sein soll, bleibt eine irritierende Tatsache. Dies gilt umso mehr, wenn man berücksichtigt, welche Akzeptanz die Bücher von Philip K. Dick oder William Gibson unterdessen genießen.
Читать дальше