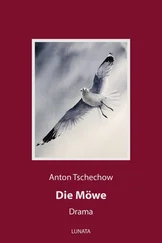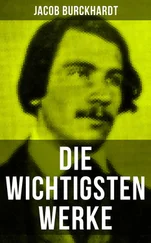»Und wo ist Kleopatra?« fragte Aksinja leise, in großer Hast, den Atem zurückhaltend. »Und wo ist deine Mütze, Väterchen? Und deine Frau ist, wie man sagt, nach Petersburg verreist?«
Sie war schon bei meiner Mutter im Dienst gewesen und pflegte einst uns, mich und Kleopatra in einem Holztrog zu baden; auch jetzt noch betrachtete sie uns als Kinder, die sie zu erziehen hatte. In einer Viertelstunde hatte sie mir alle Erwägungen ausgekramt, die sie, seit wir uns nicht gesehen, in der Stille der Küche mit der Umsicht einer alten Magd aufgespeichert hatte. Sie sagte, daß man den Doktor zwingen könne, Kleopatra zu heiraten, – man müsse ihm nur ordentlich Angst machen und eine Bittschrift an den Bischof aufsetzen, damit er seine erste Ehe auflöse; dann wäre es gut, Dubetschnja hinter dem Rücken meiner Frau zu verkaufen und das Geld auf meinen Namen in die Bank zu tun; und wenn meine Schwester und ich unseren Vater kniefällig bitten wollten, so würde er uns vielleicht verzeihen; wir sollten auch eine Messe der Himmelskönigin lesen lassen ....
»Nun, geh doch, Väterchen, sprich mit ihm,« sagte sie, als man meinen Vater husten hörte. »Geh hin, sprich mit ihm und verbeuge dich vor ihm, der Kopf wird dir davon nicht abfallen.«
Ich ging. Der Vater saß schon am Tisch und zeichnete den Plan zu einer Villa mit gotischen Fenstern und einem dicken Turm, der wie ein Feuerwehrturm aussah, – es war furchtbar talentlos und trocken. Als ich in sein Zimmer trat, blieb ich so stehen, daß ich den Plan sehen konnte. Ich wußte nicht, weshalb ich zum Vater gekommen war, aber ich erinnere mich, daß ich beim Anblick seines mageren Gesichts, seines roten Halses und seines Schattens an der Wand ihm um den Hals fallen und mich vor ihm, wie mir Aksinja geraten, bis zum Boden verneigen wollte. Aber der Plan mit den gotischen Fenstern und dem dicken Turm hielt mich davon ab.
»Guten Abend,« sagte ich.
Er blickte mich an und senkte die Augen sofort wieder auf die Zeichnung.
»Was willst du?« fragte er nach einer Weile.
»Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, daß meine Schwester schwer krank ist. Sie wird bald sterben,« fügte ich mit dumpfer Stimme hinzu.
»Was soll ich dazu sagen?« seufzte ter Vater. Dann nahm er die Brille ab und legte sie auf den Tisch. »Was man sät, das erntet man. Was man sät,« wiederholte er, vom Tische aufstehend, »das erntet man. Ich bitte dich, erinnere dich nur, wie du vor zwei Jahren zu mir kamst und wie ich dich hier auf dieser selben Stelle gebeten habe, deine Verirrungen zu bereuen, und zu dir von deiner Schuldigkeit, von der Ehre und von den Pflichten gegen deine Ahnen gesprochen habe, deren Traditionen wir heilig halten müssen. Hast du auf mich gehört? Du hast meine Ratschläge verachtet und hast an deinen falschen Anschauungen hartnäckig festgehalten; und noch mehr als das: du hast auch deine Schwester in deine Verirrungen hineingezogen und sie gezwungen, Moral und Scham aufzugeben. Nun geht es euch beiden schlecht. Was soll ich dazu sagen? Was man sät, das erntet man!«
Als er das sagte, ging er in seinem Zimmer auf und ab. Wahrscheinlich glaubte er, ich sei zu ihm gekommen, um meine Schuld zu bekennen; wahrscheinlich erwartete er, ich würde für mich und für meine Schwester bitten. Mich fröstelte, ich zitterte wie im Fieber, und ich sagte heiser mit großer Mühe:
»Auch ich bitte Sie, sich daran zu erinnern, daß ich Sie an dieser selben Stelle angefleht habe, mich zu verstehen, sich in mich einzufühlen und zusammen mit mir die Frage zu untersuchen, wie und wofür wir leben sollen; als Antwort brachten Sie aber die Rede auf die Ahnen und auf den Großvater, der Verse geschrieben hat. Jetzt erzählt ich Ihnen, daß Ihre einzige Tochter sterben muß, und Sie reden wieder von Ahnen und Traditionen. Wie leichtsinnig ist das doch in Ihrem Alter, wo der Tod nicht mehr fern ist, wo Sie nur noch fünf, höchstens zehn Jahre zu leben haben!«
»Wozu bist du hergekommen?« fragte mein Vater streng. Er fühlte sich offenbar dadurch verletzt, daß ich ihm Leichtsinn vorgeworfen hatte.
»Ich weiß es nicht. Ich liebe Sie, es tut mir unaussprechlich leid, daß wir uns so fremd sind, – darum bin ich gekommen. Ich liebe Sie noch, aber meine Schwester hat sich von Ihnen endgültig losgerissen. Sie verzeiht nicht und wird es Ihnen nie verzeihen. Schon Ihr Namen allein weckt in ihr einen Ekel vor der Vergangenheit, vor dem Leben.«
»Und wer ist schuld?« schrie der Vater. »Du bist selbst schuld, du Taugenichts!«
»Gut, nehmen wir an, daß ich schuld bin,« sagte ich. »Ich bekenne es, ich bin an vielem schuld; warum ist aber Ihr Leben, das Sie auch uns aufdrängen wollen, so furchtbar langweilig, so geschmacklos, warum gibt es in allen den Häusern, die Sie in den dreißig Jahren erbaut haben, keinen Menschen, von dem ich lernen könnte, wie man leben soll, ohne Schuld auf sich zu laden? In der ganzen Stadt gibt es keinen einzigen ehrlichen Menschen! Alle Ihre Häuser sind verfluchte Nester, in denen die Mutter und die Töchter langsam hingemordet und die Kinder gequält werden ... Meine arme Mutter!« fuhr ich verzweifelt fort. »Meine arme Schwester! Man muß sich ja mit Schnaps, Kartenspiel und Klatschereien betäuben, man muß heucheln und lügen oder jahrzehntelang Pläne zeichnen, um das Grauen nicht zu sehen, das in diesen Häusern wohnt. Unsere Stadt existiert schon seit Jahrhunderten und hat bisher dem Vaterlande noch keinen nützlichen Menschen geliefert, – keinen einzigen! Sie haben alles Lebensfähige, alles Originelle im Keime erstickt! Es ist eine Stadt der Krämer, der Schenker, der Kanzlisten, der Heuchler, eine unnütze, zwecklose Stadt, die keine Seele bedauern würde, wenn sie plötzlich in die Erde versänke.«
»Ich will dir nicht weiter zuhören, du Taugenichts!« sagte mein Vater und nahm ein Lineal vom Tisch. »Du bist betrunken. Unterstehe dich nicht, in solchem Zustande vor deinen Vater zu treten! Ich sage es dir zum letztenmal, und das sollst du auch deiner sittenlosen Schwester mitteilen, daß ihr von mir nichts bekommen werdet. Die widerspenstigen Kinde habe ich mir aus dem Herzen gerissen, und wenn sie unter ihrer Widerspenstigkeit leiden, so tun sie mir nicht leid. Du kannst gehen, woher du gekommen bist. Gott wollte mich durch euch strafen, und ich trage diese Prüfung in Demut und finde gleich Hiob Trost in meinen Leiden und in der Arbeit. Du darfst nicht über meine Schwelle treten, ehe du dich gebessert hast. Ich bin gerecht, alles, was ich sage, ist nützlich, und wenn du dir selbst Gutes willst, so mußt du dein Leben lang daran denken, was ich dir gesagt habe und jetzt sage.«
Ich winkte mit der Hand und ging hinaus. Was ich in der Nacht und am anderen Tage getrieben habe, weiß ich nicht mehr.
Man sagt, ich sei ohne Mütze, taumelnd und laut singend, durch die Straßen gelaufen, von Jungen verfolgt, die mir nachgeschrien hätten:
»Kleiner Nutzen! Kleiner Nutzen!«
Inhaltsverzeichnis
Wenn ich Lust hätte, mir einen Ring zu bestellen, so würde ich mir die Inschrift wählen: »Nichts vergeht«. Ich glaube, daß nichts spurlos vergeht und daß jeder kleinste Schritt eine Bedeutung für das gegenwärtige und für das zukünftige Leben hat.
Alles, was ich erlebt hatte, ging an mir nicht umsonst vorüber. Meine großen Leiden und meine Geduld haben die Herzen der Bürger gerührt und heute nennt mich niemand mehr »Kleiner Nutzen«, niemand lacht über mich, und, wenn ich durch den Markt gehe, begießt man mich nicht mehr mit Wasser. Alle haben sich schon daran gewöhnt, daß ich Arbeiter geworden bin und sehen nichts Merkwürdiges darin, daß ich, ein geborener Edelmann, Eimer mit Farbe herumschleppe und Scheiben einsetze; im Gegenteil, man gibt mir gerne Aufträge und hält mich für einen guten Meister und für den besten Unternehmer neben Rettich, der zwar gesund geworden ist und nach wie vor die Kirchenkuppeln ohne Gerüst anstreicht, aber nicht mehr die Kraft hat, mit seinen Gehilfen fertig zu werden; an seiner Stelle laufe ich jetzt auf der Suche nach Aufträgen herum, nehme Gesellen auf und entlasse sie wieder und leihe mir Geld gegen hohe Zinsen. Jetzt, wo ich selbst Unternehmer bin, kann ich es sehr gut begreifen, wie man wegen eines kleinen Auftrages drei Tage lang in der Stadt herumläuft, um Dachdecker zu suchen. Man behandelt mich höflich, sagt »Sie« zu mir und traktiert mich in den Häusern, wo ich arbeite, mit Tee oder läßt mich fragen, ob ich nicht zu Mittag mitessen möchte. Die Kinder und die jungen Mädchen kommen oft zu mir herein und schauen neugierig zu, wie ich arbeite.
Читать дальше