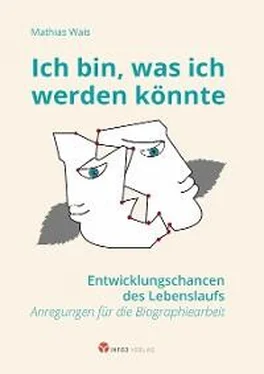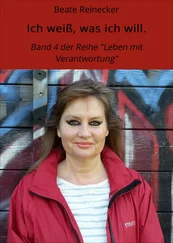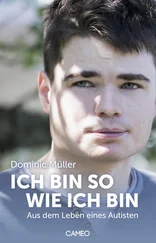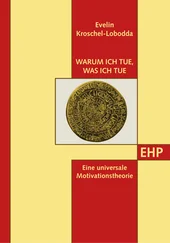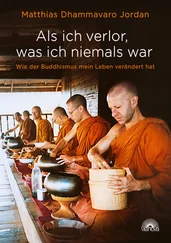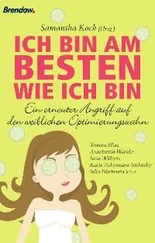6
Die vierfache Ich-Frage – zur biographischen Bedeutung der Pubertät
Viermal im Lebensgang steht der Mensch vor der aus dem Innern erwachsenden Frage: Wer bin ich eigentlich?
In stiller Art prägt diese Frage zum ersten Mal das Erleben des fünfjährigen Kindes. Im fünften Lebensjahr entsteht dem Kind ein Bewusstsein von der Polarität der Geschlechter. In sein Erleben tritt die Tatsache, dass die elterliche Hülle aus zwei verschiedenen Menschen besteht, die polar aufeinander bezogen sind. Es wächst ein feines Empfinden dafür, dass, was bisher als einheitliche elterliche Hülle erlebt wurde, einen leichten Riss, eine Aufspaltung in ein weibliches und ein männliches Element zeigt. Natürlich weiß das Kind schon zuvor, dass es Männer und Frauen gibt, aber Geschlechtsunterschied und Geschlechtspolarität treten noch nicht in sein Erleben. Das vierjährige Kind kann die Oma noch fragen: Oma, bist du ein Junge, oder bist du ein Mädchen? Das sechsjährige nicht mehr.
Als Folge dieses leisen Verlustes der Ureinheit und Wahrnehmung einer grundsätzlichen Spaltung der Menschen in männliche und weibliche tritt die Frage auf: Und was bin dann ich? Bin ich männlich oder bin ich weiblich? – Selbstverständlich weiß das Kind die Antwort. Aber dieses Wissen tangiert noch nicht das Bild, das es von sich selbst hat. Noch der knapp fünfjährige Knabe kann nach einem Marktbesuch zu Hause verkünden: Wenn ich groß bin, werde ich Marktfrau! – Der Junge, der über diese erste Identitätsfrage hinaus ist, will jetzt Obstverkäufer werden. Und er wird dann immer, wenn er auf den Markt zum Einkaufen mitgenommen wird, genau beobachten, was die Männer und was die Frauen auf dem Markt tun.
Damit ist also im fünften Lebensjahr – in der Psychoanalyse als ödipale Phase bekannt – ein erster Schritt zur Bestimmung der eigenen Identität getan. Ich bin ein Junge. Ich bin ein Mädchen.
Im neunten Lebensjahr ist das Kind wieder, jetzt aber mit anderem Akzent, vor die Frage nach der eigenen Identität gestellt. Jetzt beschäftigt es sich mit der Frage, inwieweit es eine Verlängerung oder Fortsetzung der Eltern ist und inwieweit eine eigenständige Person. Das nimmt häufig die Form der Findelkindphantasie an: »Eigentlich stamme ich aus einem Königshaus. Meine Eltern, Könige in einem fernen Land, mussten mich aussetzen. Die Leute, die vorgeben, meine Eltern zu sein, haben mich gefunden und großgezogen. Ich muss herausfinden, wo meine eigentliche Heimat und was, demzufolge, meine eigentliche Aufgabe ist, worin mein eigener Lebensweg liegt.«
Dahinter steht die Wahrnehmung eines Widerspruchs: Ich stamme zwar angeblich leiblich von meinen Eltern ab, aber im Kern meiner Person bin ich ein ganz eigener. Woher kommt mein Ich? Mein Ich kann nicht einfach eine Fortsetzung meiner Eltern sein. – Diese sich oft nur unterschwellig abspielenden Überlegungen wirken sich vorübergehend im Bewusstsein des Kindes so aus, dass es etwas auf Distanz von seinen Eltern geht. Diese werden jetzt kritisch betrachtet. Das Kind hat Einsamkeitserlebnisse. Manche Kinder beschäftigen sich nun mit der Möglichkeit des Todes und stellen sich vor, wie es wohl wäre, wenn sie allein leben würden, ohne die Eltern.
Auch hier geht die Frage »Wer bin ich?« von einem Verlusterlebnis aus: Eltern, Familie, die häuslichen Abläufe, das täglich Erlebte – all das wird nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie zuvor gesehen. Das neunjährige Kind tritt seiner Welt gegenüber. Bislang hat es darin gestanden. Ich und die Welt sind zweierlei. Es gibt einen Riss, einen Spalt zwischen mir und der Welt – konkret: den Eltern und Lehrern. Wer in diesem Zusammenhang bin ich? Ich bin offenbar ein eigenes Individuum, bin letztlich nur auf mich gestellt.
Das Kind beantwortet die Identitätsfrage jetzt aber noch nicht inhaltlich. Noch will es sich nicht selbst inhaltlich bestimmen. Vielmehr geht es um das Urerlebnis, dass ich überhaupt ein Ich bin, und zwar ein anderes als alle anderen. – Die Identitätsfrage versinkt dann wieder. Was aber zurückbleibt, ist ein Spielen und Experimentieren mit dem Unterschied von Innen und Außen, von Ich und Welt. Mein Ich ist innen, die Welt ist außen. Man kann also Geheimnisse haben, kann lügen und sich verstellen. Darin bekräftigt sich und wird handhabbar das elementare Trennungserlebnis, das das Ich der Welt gegenüber hat.
Sodann setzt mit zwölf Jahren die inhaltliche Frage nach der eigenen Individualität mit einem Paukenschlag ein: Alles, was bisher vertraut war, nicht nur Eltern, Lehrer und familiäre Gewohnheiten, auch der eigene Körper, wird fremd. Nichts mehr ist selbstverständlich. Eine tiefe Kluft trennt auf einmal von allem, was bisher getragen hat, selbst von der eigenen Leiblichkeit. Wer bin ich also? Wer bin ich, wenn sich mein Ich offenbar nicht von meiner Familie, nicht von meinen Lehrern, nicht einmal von meinem Leib her bestimmt und trägt, so wie bisher? Mein Ich ist offenbar nur äußerlich und allenfalls in einer für die Vergangenheit gültigen Weise an Familie, Schule und Leib gebunden. Was kann also stattdessen und eigentlich meine Individualität werden?
Es ist charakteristisch, dass der junge Mensch diese Frage nicht aus der Vergangenheit beantworten will, sondern radikal aus der Zukunft. Das jetzt erst in sein eigenes Bewusstsein eintretende Ich sieht betont ab von der Vergangenheit – mein Elternhaus ist verstaubt und verknöchert, meine Schule ist muffig, und in meinem Leib bahnen sich ungeahnte Dinge an – und will sich ganz in die Zukunft hinein orientieren. Jetzt erst beginnt ein eigenes Schicksalswollen, und von nun an sucht der Mensch bewusst Schicksals- und Beziehungsgestaltung aus eigenem Vermögen. Vorher waren Schicksal und Beziehungen vorfindlich. Jetzt kann man sie wollen und – vor allem – nicht wollen. Bislang hat man mit den Kindern gespielt, die in der Nachbarschaft wohnten. Jetzt will man sich seine Freundschaften aussuchen. Bislang hat man weitgehend desinteressiert und tatenlos zugesehen, wenn die Eltern das Kinderzimmer renoviert und neu eingerichtet haben. Jetzt will man das selbst machen, jetzt hat man dazu eigene Vorstellungen. Bislang hat die Mutter mich eingekleidet, und mir war nur wichtig, ob es zweckmäßig war. Jetzt stelle ich mir meine Kleidung selbst zusammen.
Natürlich ist es aus der Sicht des Erwachsenen eher amüsant, manchmal nervenaufreibend, dass der junge Mensch seine Individualität nun über Kleidung und Bilder an der Wand finden will. Es ist eben ein Anfang, unbeholfen, aber deshalb nicht ungültig. Die vehemente Art, mit der sich der pubertierende Mensch oft gegen alles stellt, was Vergangenheit ist – und deren Repräsentanten sind in erster Linie die Eltern –, enthält einen richtigen Kern. Ich weiß zwar noch nicht genau, wer ich bin, aber ich weiß, dass ich nicht das bin, was bisher selbstverständlich so erschien, auch wenn es von meinen Eltern so geprägt worden war. Ich bin Zukunft.
So kann man die Pubertät als den eigentlichen Beginn der bewussten Biographie betrachten. Erste, unbeholfene, oft unrealistische Lebensentwürfe tauchen auf. Erste biographisch bedeutsame Entscheidungen werden getroffen – man möchte bald aus der Schule gehen, um Handwerker zu werden, man möchte den und den Vereinssport betreiben. Das Individuum fängt an, sein Leben selbst zu leben. »Fängt an« heißt, es ist wie beim Laufenlernen: Man fällt tausendmal hin, bevor man wirklich laufen kann. Aber anders kann man nicht laufen lernen. Der junge Mensch tut sicher viel Unbedachtes und Unausgegorenes, setzt sich Gefährdungen aus, radikalen Tendenzen, wechselt täglich seine jeweils absolut richtige Meinung. Aber anders kann der bewusste Griff nach dem eigenen Schicksal nicht ruhig und sicher werden.
In dieser Phase tauchen auch die Ideale auf. Der junge Mensch sucht Ideale – nicht als abstraktes Gedankengut und bloß Gepredigtes. Vielmehr hat er die Sehnsucht, dass es Menschen geben möge, die für sie angefeindet werden und schließlich mit ihnen obsiegen. Das Ich sucht sich in der Pubertät im Idealischen. Das äußerlich sperrig Auffallende ist oft nur das Geheimzeichen für etwas Idealisches. Die Lederstiefel stehen für Freiheit, der Lippenstift für Hingabebereitschaft, die Rockmusik für Gelassenheit im Sturm und der kurze Haarschnitt für Autonomie, zum Beispiel. – Es ist eine tiefe Tragik, dass der Erwachsene den Pubertierenden so wenig ernst nimmt. Eltern, Lehrer und die Tante aus dem Fränkischen sind nur entrüstet über das Aussehen des bis dahin so adretten Kindes. Und sie betrachten die Pubertät als eine Art vorübergehende Krankheitserscheinung. Danach ist, hoffentlich, alles wieder gut. Würde man ansprechen, bestätigen und aufgreifen, was der junge Mensch an Idealen sucht, wie er konkret-sinnlichen Anschluss daran sucht, wie er Schicksalsentwürfe ausprobiert, so könnte mancher biographische Umweg, manche Einengung des Lebenshorizonts, manche Klischeefixiertheit in den Lebensabläufen vermieden werden. Selbst der Erwachsene noch nimmt sich in der Erinnerung daran nicht ernst. Die eigene Pubertät wird teils verschämt, teils belustigt als eine Art verlängerte Faschingszeit angesehen. Dann erst wurde es ernst.
Читать дальше