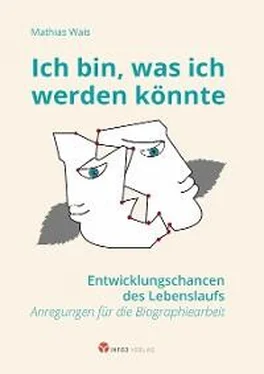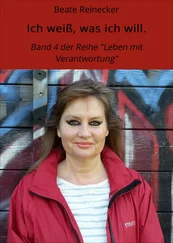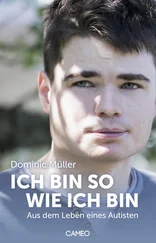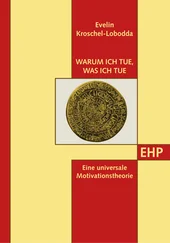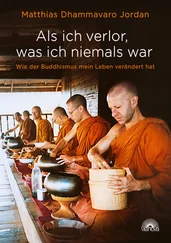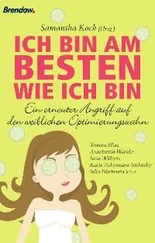Dieser Entschluss zum Überpersönlichen, der auf Erden zur Lebensmitte ansteht, antwortet auf den Entschluss, den man einst in der geistigen Welt gefasst hat, als man dort dem »großen Hüter der Schwelle« begegnete. Die Lebensmittekrise ist insofern eine Antwort auf den Entschluss, zur Erde zu kommen. Nach diesem Entschluss hatte man angefangen, sich den irdischen Verhältnissen wieder zu nähern. Dann lebte man sich zunehmend ein auf Erden. Gleichzeitig verlor man aber immer mehr den Anschluss an die geistige Welt. Und jetzt, in der Lebensmitte, in der weitesten Entfernung von der geistigen Sphäre, da entschließt man sich erneut zur Erde, und zwar wiederum zu ihrem überpersönlichen Aspekt, und gewinnt wieder Anschluss an die geistige Dimension.
Es ist aber nicht so, dass der Fall damit erledigt wäre, dass man, mehr oder weniger bewusst, solche Einsichten hat oder Entschlüsse fasst. Der »kleine Hüter« weicht nun nicht mehr von der Seite, das heißt, ab jetzt ist der Hüter immer dabei, was auch immer man tut und lässt. Ich blicke von nun an, bei allem, was ich tue, auch immer auf das, was ich noch nicht kann, was mir nur unzureichend gelingt, wo ich mich weiterentwickeln muss, um wirken zu können. Und das wird anstrengend. – Auch das Element, Entschlüsse fassen zu müssen, bleibt bestehen. Während sich nämlich in der ersten Lebenshälfte die Dinge meistens noch von selbst ergeben, Freundschaften, berufliche Werdegänge, Interessen, so muss ich das jetzt alles bewusst und mit Willen angehen. Zum Beispiel ergeben sich neue Freundschaften nach der Lebensmitte meist nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie zuvor. Jetzt entsteht Freundschaft eigentlich nur noch, wenn ich das will und bewusst herbeiführe. Ich muss jetzt bewusster auf andere Menschen zugehen. War ich früher noch wie getragen von den Umständen, so muss ich mich jetzt selbst tragen, sonst resigniere ich über die Kümmerlichkeit des Daseins. Der junge Mensch kann immer noch die Hoffnung haben, dass es besser wird. Jetzt muss ich es selbst besser machen, damit es besser wird. Insofern bin ich Herr meines Schicksals geworden. Es liegt jetzt in meiner Hand, worauf es mit mir hinausläuft. Man muss sich jetzt gezielt Gedanken machen, aus welchen Quellen man seine Zukunft gestalten will.
Das ist bis ins Körperliche festzustellen. Liegen nicht besondere Krankheiten vor, so erlebt man vor der Lebensmitte seinen Körper nicht. Jetzt aber lastet er zunehmend schwer. Mit etwa achtundzwanzig Jahren fängt der rein physische Abbau an – übrigens fängt er im Gehirn an –, und jetzt muss bewusst etwas für den Erhalt des Körpers, für Gesundheit und Beweglichkeit getan werden, sonst wird der Körper schnell zur Last und schränkt ein. Und seelisch ist das eben auch so. In den Jahren nach achtundzwanzig kann ein seelischer Abbau im Sinne einer um sich greifenden Perspektivlosigkeit beginnen, wenn nicht aktiv Perspektiven erarbeitet werden – und zwar solche, die über das hinausführen, was die eigene konkrete Person belangt.
Wie der Körper ab der Lebensmitte eine Sklerotisierungstendenz zeigt, eine Tendenz zu versteifen und zu verhärten, so ist es auch im Seelischen. Man muss etwas für seine seelische Beweglichkeit tun, aber eben nicht nur während der Lebensmittekrise, sondern ab jetzt immer. Und die Grundgeste dieser Beweglichkeit ist es, über sich selbst hinauszugehen, ein herzliches Interesse für all das zu entwickeln, was nicht Ich ist. Es geht jetzt um eine kontinuierliche Selbsterziehung.
Hier hat auch seinen eigentlichen Platz, was in den letzten Jahren als Biographieberatung bekannt geworden ist. Biographieberatung geht, wie bereits erläutert, nicht von der Frage aus: Wie hätten Sie Ihr Leben denn gerne? Vielmehr: Wie ist Ihr Leben geworden, und wie können Sie es jetzt sinnhaft weiterführen? Wie können Sie innerhalb des Rahmens, der in der ersten Lebenshälfte entstanden ist, so an sich arbeiten, dass Sie Anschluss an die Dimension des Geistigen, des Sinnhaften gewinnen? Biographieberatung kann eine solche Anleitung zur Selbsterziehung, zum übenden Umgang mit sich selbst sein, so wie das ab der Lebensmitte angebracht ist.
Einige einfache Beispiele für solch einen Übungsweg seien hier angedeutet: Man kann sich etwa vier Wochen lang jeden Abend kurz darauf besinnen, wenn man den Tag abschließt, was heute wesentlich und was heute nicht so wesentlich gewesen ist. Man kann sich das jeden Abend mit ein paar Stichworten aufschreiben. Macht man diese Übung, kommt man zu einem überraschenden Ergebnis: Es gibt nichts Unwesentliches. Was mir zunächst unwesentlich erschienen ist, erweist sich bei näherer Betrachtung eigentlich als ein kleines Versäumnis meinerseits.
Da ist er also schon wieder, der kleine Hüter. Dass ich heute morgen über den Staubsauger meiner Putzfrau gestolpert bin, scheint zunächst ein unwesentliches Ereignis zu sein. Aber wenn ich es genau betrachte, sagt es mir, dass ich die Arbeit der Putzfrau nicht ernst nehme und herumlaufe, als wäre sie gar nicht da. Ich habe kein Bewusstsein dafür, dass sie anwesend ist. Also nächste Woche, wenn sie wiederkommt, werde ich sie ansprechen und versuchen, ihre Arbeit bewusst wahrzunehmen.
So banal ist das mit der übergeordneten Dimension. Es geht nicht darum, in der Lebensmitte große Fahnen aufzurollen und aus dem Fenster zu hängen, sondern darum, da, wo man steht – oder, wie in dem Beispiel, wo man stolpert –, sich ganz auf das einzulassen, was vorliegt. Dadurch wird, was da ist, erst vollständig, erfüllt sich und gewinnt geistige Substanz.
Eine andere Übung könnte sein, das Alte neu zu tun. Statt also in der Lebensmittekrise alles hinzuwerfen und das Ticket nach Australien zu kaufen, könnte man sich systematisch damit beschäftigen, all das neu anzusehen und neu zu greifen, was man schon immer tut. Dazu ist es sinnvoll, kleine Gewohnheiten, die sich über Jahre eingeschlichen haben, probeweise einmal für vierzehn Tage zu ändern. Man könnte das Bild im Büro einmal an eine andere Wand hängen, nur für zwei Wochen; und sehen, wie das wirkt. Wenn es dann nach vierzehn Tagen wieder an seinem alten Platz hängt, wird man es neu sehen; und vielleicht sieht man auch sein Büro neu. – Oder man könnte einmal, nur für vierzehn Tage, statt morgens beim Frühstück den Kopf in die Zeitung zu stecken, die eigenen Kinder fragen, wie es denn in der Schule so geht. Danach liest man die Zeitung ganz anders. – Oder man könnte einmal, nur probeweise, den grünen Pulli anziehen, den einst die Schwiegermutter geschenkt hat und der nun seit fünf Jahren im Schrank hängt. Nur einmal zwei Wochen lang. Vielleicht sieht man dann nicht nur den Pulli anders.
Die Lebensmittekrise hat also ihren Sinn darin, auf die Entschlüsse zu antworten, mit denen wir einst auf die Erde gekommen sind. Sie hat nicht den Sinn, jetzt das Irdisch-Materielle zu verachten. Im Gegenteil, sie soll der Ausgangspunkt dafür sein, dass wir dem Irdisch-Materiellen Sinn geben können, dass wir es vervollständigen, dass wir es zu sich selbst führen, indem wir über das hinausgehen, was wir von uns gewohnt sind.
Nun gibt es aber Ausnahmen: Es gibt Menschen, die schon in sehr jungen Jahren konkret an der Verwirklichung ihrer Ideale arbeiten, offenbar aus einer mitgebrachten Selbstlosigkeit heraus. Und es gibt ältere Menschen, die nach überhaupt nichts streben, die keine Lust haben, sich um irgend etwas Übergeordnetes zu bemühen. – Wir können annehmen, dass wir beide Male Menschen vor uns haben, die ein besonderes Opfer bringen. Letztere führen den Materialismus und die Selbstbezogenheit auf die Spitze und führen ihren Mitmenschen damit vor, welche Trostlosigkeit in einem nicht-strebenden Leben entsteht. Und sie können möglicherweise eben dadurch wirken: Sie können Ansporn und Anlass sein für die anderen, sich selbst zu befragen, was Materialismus und Selbstbezogenheit betrifft. Es ist insofern nicht richtig, Menschen zu verurteilen, die über die Lebensmitte hinaus eine materialistische Gesinnung leben, die also nicht aufgreifen, worauf in diesem Kapitel hingewiesen wurde. Sie erfüllen vielleicht auch, indem sie so leben, eine große Aufgabe. Aber es hängt von uns ab, ob wir das so aufgreifen, als Ansporn, als Anlass. Erst dann haben diese Menschen ihre Aufgabe erfüllt, auch ohne dass sie sich dessen bewusst sind.
Читать дальше