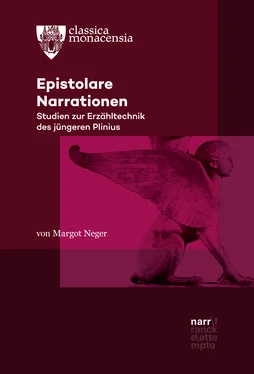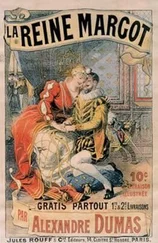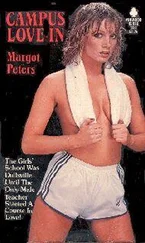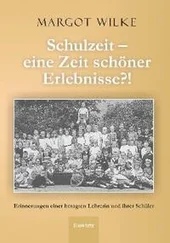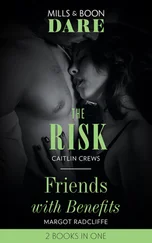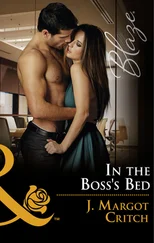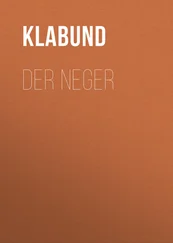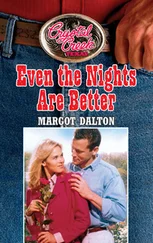Nachdem Plinius in Epist . 2,14 seinem Unmut über die unerfahrenen jungen Leute, die voller Selbstvertrauen im Zentumviralgericht agieren,80 Luft gemacht (2) und die althergebrachte Praxis des tirocinium fori dagegengehalten hat (3‒4: ante memoriam meam…nunc ), geht er dazu über, in Manier eines Satirikers bzw. Scheltredners das zeitgenössische Claqueur-Wesen zu kritisieren (4‒13). Zunächst vergleicht er im Ton der Entrüstung (3: at hercule ) das Eindringen der jungen Redner ins Zentumviralgericht mit dem Aufbrechen von Schranken (4: nunc refractis pudoris et reverentiae claustris omnia patent omnibus, nec inducuntur, sed inrumpunt ),81 bevor er anschließend in einen knapperem Stil wechselt, wenn er das Gebaren der Claqueure skizziert (4): sequuntur auditores actoribus similes, conducti et redempti . Im Rahmen dieser chiastischen s- und a-Alliteration werden die auditores mit Schauspielern ( actores ) verglichen, da sie sich mieten lassen und den Applaus nur vorspielen,82 was auch durch den schleppenden Rhythmus in der Junktur conducti et redempti unterstrichen wird. Theatrale Elemente prägen auch die weitere Charakterisierung dieser Leute:83 Man bezeichne sie non inurbane als Σοφοκλεῖςbzw. als Laudiceni (5), ein Wortspiel, das auf ihr Bestreben, für Applaus zum Essen geladen zu werden, anspielt.84 Für die Choreographie des Beifalls ist ein mesochorus zuständig85, der den Claqueuren mit einem Zeichen den Einsatz des Applauses signalisiert (6) – die Ignoranz der Claqueure (7: non intelligentes ) steht in deutlichem Kontrast zu der gebildeten Zuhörerschaft, die sich Plinius in Epist . 2,19Plinius der JüngereEpist. 2.19.9 wünscht (9: adhibituri sumus eruditissimum quemque ).
Wie sehr sich die Zustände in der zeitgenössischen Beredsamkeit verschlechtert haben, illustriert PliniusPlinius der JüngereEpist. 2.14 mit einer Anekdote, die einen Vorfall des Vortags behandelt (6): here duo nomenclatores mei (habent sane aetatem eorum, qui nuper togas sumpserint) ternis denariis ad laudandum trahebantur . Für drei Denare, die man etwa fünfzehnjährigen Jünglingen bezahlt, könne man bereits als disertissimus gelten. Plinius beschließt den Abschnitt über die gegenwärtige Krise mit der pointierten Formulierung scito eum pessime dicere, qui laudabitur maxime (8), bevor er zu einer Art aitiologischen Erzählung von den Anfängen dieser Unsitte übergeht (9‒11). Als primus inventor wird Larcius Licinus, ein Redner aus der julisch-claudischen Epoche,86 überliefert, so hat es Plinius zumindest von seinem Lehrer Quintilian gehört (9). Diesen lässt der Epistolograph sodann als intradiegetischen Erzähler ersten Grades auftreten87 und von einem Erlebnis mit seinem Mentor Domitius Afer88 berichten (10‒11):
narrabat ille: ‘adsectabar Domitium Afrum. cum apud centumviros diceret graviter et lente (hoc enim illi actionis genus erat), audit ex proximo immodicum insolitumque clamorem. admiratus reticuit; ubi silentium factum est, repetit, quod abruperat. iterum clamor, iterum reticuit, et post silentium coepit. idem tertio. novissime quis diceret quaesiit. Responsum est: “Licinus.” tum intermissa causa “centumviri”, inquit, “hoc artificium periit”’.
Das hier entworfene Bild von Quintilian, der Domitius Afer ins Zentumviralgericht begleitet, greift die zuvor von PliniusPlinius der JüngereEpist. 2.14 geschilderte altehrwürdige Praxis des tirocinium fori (3: ante memoriam meam )89 wieder auf. In der Basilica Iulia, wo die centumviri tagten, konnten vier verschiedene Verhandlungen gleichzeitig stattfinden, sodass offenbar auch die Geräuschkulisse entsprechend laut war.90 QuintilianQuintilianInst. 12.5.6 selbst berichtet in Inst . 12,5,6 von einem Vorfall, in den der über eine besonders imposante Stimme verfügende Redner Trachalus involviert gewesen sein soll:91
certe cum in basilica Iulia diceret primo tribunali, quattuor autem iudicia, ut moris est, cogerentur, atque omnia clamoribus fremerent, et auditum eum et intellectum et, quod agentibus ceteris contumeliosissimum fuit, laudatum quoque ex quattuor tribunalibus memini .
Ähnlich wie Plinius in seinem Brief liefert auch Quintilian eine Ekphrasis der Akustik in der Basilica Iulia (vgl. clamoribus – clamorem…clamor ; auditum – audisse…audit )92 und erinnert sich hier an eine Szene, die er dort offenbar selbst miterlebt hat ( memini ); Plinius wiederum erinnert sich ( memini ) an eine Erzählung seines Lehrers, wobei das Hören in diesem Kontext eine besonders wichtige Rolle zu spielen scheint: Plinius hat von Quintilian gehört (9: audisse ), was der Redner Domitius Afer im Zentumviralgericht gehört hat (10: audit ).
Die Erzählung Quintilians in Epist . 2,14Plinius der JüngereEpist. 2.14 weist folgende Struktur auf: Eine kurze Exposition (10: adsectabar Domitium Afrum ) leitet zum ersten Akt des kleinen Dramas vor Gericht über ( cum apud centumviros…repetit, quod abruperat ), in dem von Afers Rede, ihrer ersten Unterbrechung durch benachbartes Lärmen und ihrer Wiederaufnahme erzählt wird. Der zweite Akt, in dem sich die Handlung des ersten wiederholt, zeichnet sich durch gesteigerte Kürze der Narration aus ( iterum…coepit ), die im dritten Akt sogar noch überboten wird (11: idem tertio ).93 Zum Schluss fragt Afer als interner Sprecher zweiten Grades, wer der andere Redner sei, bricht sein Plädoyer ab, nachdem er die Antwort vernommen hat, und konstatiert in direkter Rede, dass es nun vorbei sei mit der Kunst der Beredsamkeit. Mit Afers Worten endet auch die Erzählung Quintilians.
In der Zeit Afers habe, so fährt Plinius fort, der Verfall der Beredsamkeit eigentlich erst eingesetzt (12: perire incipiebat ), jetzt hingegen sei der Tiefpunkt erreicht ( nunc vero prope funditus exstinctum et eversum est )94 – diesen Befund malt Plinius in satirischer Anschaulichkeit aus, wenn er die fracta pronuntiatio der jungen Redner, die teneri clamores ihrer Zuhörer (12) sowie das verweichlichte und theatrale Gebaren verspottet (13): plausus tantum ac potius sola cymbala et tympana illis canticis desunt; ululatus quidem (neque enim alio vocabulo potest exprimi theatris quoque indecora laudatio) large supersunt . Die Wortwahl an dieser Stelle legt nahe, dass Plinius Ovids Darstellung der Mänaden, die den Gesang des Orpheus mit ihrem Lärmen übertönen, evozieren will ( Met . 11,15‒22)OvidMet. 11.15‒22:95
| cunctaque tela forent cantu mollita, sed ingens clamor et infracto Berecyntia tibia cornu tympanaque et plausus et Bacchei ululatus obstrepuere sono citharae… |
|
[…] |
| innumeras volucres anguesque agmenque ferarum maenades Orphei titulum rapuere theatri . |
Von den mythischen Wäldern Thrakiens, die das Theater für Orpheus’ Gesang bilden,96 hat sich das bacchantische Treiben bei Plinius in die Basilica Iulia verlagert, die mittlerweile den Schauplatz bietet für ein Verhalten, das sogar im Theater unangemessen wäre.97
Der indignierte Ton, mit dem Plinius die jungen Redner seiner Zeit sowie deren Gefolge verspottet, steht in auffälligem Kontrast zum Enkomion auf den Redner Isaeus in Epist . 2,3Plinius der JüngereEpist. 2.3. Die beiden Briefe sind. m.E. aufeinander bezogen,98 da sie sich auch in ihrer Struktur stark ähneln: In Epist . 2,14Plinius der JüngereEpist. 2.14 kritisiert Plinius zunächst die adulescentuli obscuri (2‒4a) und dann ihr gemietetes Publikum, das nur für Geld applaudiert (4b‒13); eine Anekdote über Larcius Licinus und Domitius Afer (9‒11) soll die Argumentation veranschaulichen. Demgegenüber steht in Epist . 2,3 das Enkomion auf Isaeus (1‒7), der sich an großem Ruhm erfreut (1: magna fama ), bereits sechzig Jahre alt ist (5) und dessen sermo Atticus (1) sich von dem asianischen Gebaren abhebt, das Redner und Zuhörer in Epist . 2,14 an den Tag legen. Im zweiten Teil des Briefes 2,3 steht dann das Motiv des Zuhörens im Zentrum, wenn Plinius seinen Adressaten Nepos99 dazu bewegen will, nach Rom zu kommen und Isaeus „live“ zu erleben (8‒11). Auch hier werden zwei Anekdoten eingestreut: Zunächst eine über einen Mann aus Gades, der nach Rom kam, nur um Livius zu sehen, und danach gleich wieder zurückkehrte (8),100 sowie die zuvor schon betrachtete Geschichte über Aischines und Demosthenes. Die beiden Briefe 2,3 und 2,14Plinius der JüngereEpist. 2.14 transformieren somit das rhetorische genus epideiktikon bzw. demonstrativum , das der antiken Theorie entsprechend aus Lob oder Tadel besteht,101 in einen epistolaren Kontext. Sie haben rhetorisches Können bzw. Unvermögen zum Inhalt und stellen ihrerseits als Texte das rhetorische Können ihres Verfassers zur Schau.Plinius der JüngereEpist. 2.14
Читать дальше