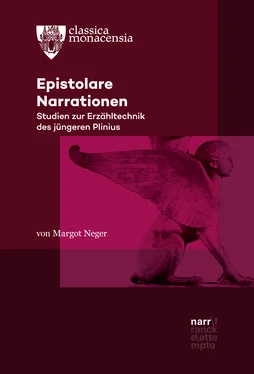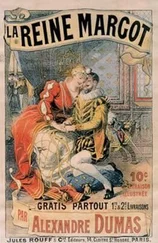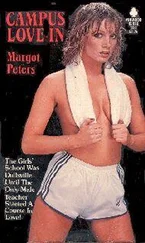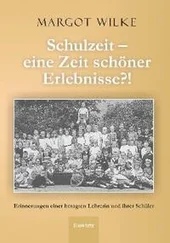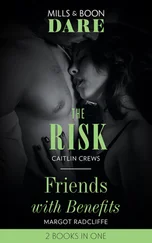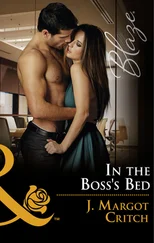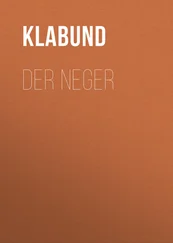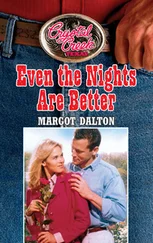Wie schon zuvor erwähnt, geht Plinius in Epist . 2,11Plinius der JüngereEpist. 2.11/12 mit keinem Wort auf den Charakter seiner Rede ein, wohingegen der Redestil des Tacitus sowie der gegnerischen Anwälte zumindest kurz umrissen wird (2,11,17‒18). Erst die Lektüre des Briefes 2,19Plinius der JüngereEpist. 2.19, in dem Plinius von einer Rede, die er in einem Repetundenprozess gehalten hat (8), berichtet, suggeriert dem Leser einen Zusammenhang mit Epist . 2,11.57 Der Brief 2,19 ist an einen Cerialis gerichtet, bei dem es sich um den in 2,11,9 erwähnten Konsular Tuccius Cerialis handeln könnte58, sodass auch über den Adressatennamen ein Rückbezug zu dieser Epistel bestünde. Cerialis hatte Plinius aufgefordert, eine Rede vor Freunden zu rezitieren (1: hortaris, ut orationem amicis pluribus recitem ), was den Epistolographen dazu veranlasst, den Unterschied zwischen vor Gericht gehaltenen und im Rezitationssaal vorgetragenen Reden zu erörtern59 und auf die Beschaffenheit seiner Gerichtsrede näher einzugehen. Der Brief steht innerhalb des Buches an vorletzter Stelle und behandelt zum ersten Mal innerhalb des Korpus Plinius’ Rolle als Rezitator seiner eigenen Reden,60 was wohl nicht zufällig wenige Briefe nach der Schilderung des spektakulären Priscus-Prozesses erfolgt. Zudem verweist das Brief-Incipit hortaris ut verbal zurück auf den Beginn der ersten EpistelPlinius der JüngereEpist. 1.1.1 (1,1,1: frequenter hortatus es, ut ), sodass Buch 1 und 2 durch das Motiv des Aufforderns zum Publizieren bzw. Rezitieren gerahmt sind.61 Auch der Anfang von Epist . 2,5Plinius der JüngereEpist. 2.5 wird aufgegriffen (1: actionem et a te frequenter efflagitatam et a me saepe promissam exhibui tibi ), wo Plinius als Lobredner auf seine Heimat Comum in Erscheinung tritt und seinen Adressaten Lupercus um Emendation dieser Rede bittet.62 Das Briefpaar 2,11‒12Plinius der JüngereEpist. 2.11/12 über den Priscus-Prozess wird also von zwei jeweils durch fünf bzw. sechs Briefe getrennten Episteln über theoretische Fragen zu Stil, Lektüre und Rezitation von Reden eingerahmt.
In Epist . 2,19Plinius der JüngereEpist. 2.19 legt Plinius dar, dass sich eine vor Gericht gehaltene Rede durch folgende Faktoren gegenüber einer vorgelesenen auszeichne (2):
iudicum consessus, celebritas advocatorum, exspectatio eventus, fama non unius actoris diductumque in partes audientium studium, ad hoc dicentis gestus, incessus, discursus etiam, omnibusque motibus animi consentaneus vigor corporis .
Neben den hier aufgezählten63 Rahmenbedingungen, die eine bestimmte Atmosphäre im Gerichtssaal erzeugen (Versammlung der Richter, große Zahl der Anwälte, Neugierde auf den Ausgang, Berühmtheit der Redner, geteilte Sympathien der Zuhörer) sind es vor allem der Körperausdruck und die Bewegungen des Redners, die den Unterschied zu einer im Sitzen vorgetragenen Rede (3) ausmachen.64 Bei letzterer seien die wichtigsten Hilfsmittel des Redners, seine Augen und Hände, stark eingeschränkt (4). Ähnliche Ausführungen zur stärkeren Wirkung einer gehaltenen bzw. gehörten Rede gegenüber einer gelesenen oder vorgetragenen hatte Plinius in Epist . 2,3Plinius der JüngereEpist. 2.3 im Rahmen des Porträts vom Redner Isaeus65 gemacht (9): altius tamen in animo sedent, quae pronuntiatio, vultus, habitus, gestus etiam dicentis adfigit . Um dies zu exemplifizieren, bringt Plinius im selben Brief die berühmte Anekdote von AischinesAischinesOr. 3.167, der bei den Rhodiern unter großer Bewunderung die Kranzrede des Demosthenes vorgelesen hatte66 und dann zugestehen musste (10): τίδέ, εἰ αὐτοῦ τοῦ θηρίουἠκούσατε; et erat Aeschines si Demostheni credimus λαμπροφωνότατος. Dieselbe Episode lesen wir bei CiceroCiceroDe orat. 3.213 in De orat . 3,213, wo das Apophthegma des Aischines allerdings auf Latein zitiert wird: quanto…magis miraremini, si audissetis ipsum !67 Indem Plinius Aischines auf Griechisch sprechen lässt, scheint er insinuieren zu wollen, dass seine VersionPlinius der JüngereEpist. 2.3 höhere Authentizität besitzt.68 Die Ausführungen des Epistolographen über den stärkeren Effekt der actio gegenüber der recitatio in Epist . 2,19Plinius der JüngereEpist. 2.19 lassen den linearen Leser somit an den Anfang des zweiten Briefbuches zurückdenken und eine Parallele zwischen den Reden des Plinius und denjenigen des Demosthenes herstellen.
Nach den theoretischen Überlegungen zu actio und recitatio äußert sich Plinius zur stilistischen Ausgestaltung seiner Rede: sie sei pugnax et quasi contentiosa (5) sowie austera et pressa (6), was dem Geschmack des Publikums einer Rezitation, das dulcia et sonantia (6) vorziehe, nicht entgegenkomme.69 Ungeachtet dieser Schwierigkeiten, so fährt Plinius fort, können seine Rede vielleicht durch ihre Neuartigkeit bei den Römern (7: novitas apud nostros ) Gefallen finden, da er hier in umgekehrter Analogie (7: quamvis ex diverso, non tamen omnino dissimile ) eine Strategie aus der griechischen Gerichtspraxis adaptiert habe: Dort sei es üblich gewesen, Gesetze, die mit älteren Gesetzen im Widerspruch standen, durch Vergleich mit anderen Gesetzen zu widerlegen ‒ eine Anspielung auf die γραφὴ παρανόμων, wie sie etwa im Prozess zwischen Demosthenes und Aischines um den von Ktesiphon für Demosthenes vorgeschlagenen Kranz im Zentrum steht;70 DemosthenesDemosthenesOr. 18 argumentiert in seiner Verteidigungsrede für Ktesiphon u.a. durch den Verweis auf Präzedenzfälle, dass der Angeklagte den Kranz für ihn nicht gesetzeswidrig beantragt habe.71 In Anlehnung an diese griechische Praxis habe PliniusPlinius der JüngereEpist. 2.19 nachzuweisen versucht, dass seine Anklage nicht nur durch das Repetundengesetz, sondern auch andere Gesetze gestützt würde (8).72 Eine Anklage wie diejenige gegen Marius Priscus wird somit zu einem Fall stilisiert, wie ihn die großen attischen Redner hätten behandeln können. Plinius’ Vorgehensweise, so erfahren wir, stelle innerhalb des römischen Gerichtswesens eine Neuheit dar, wie sie nur von wahren Kennern der Materie (8: apud doctos ) goutiert werden könne. Neben den intradiegetischen Zuhörern, die Plinius für seine Rezitation vorschweben, dürfte auch der allgemeine lector doctus der Briefsammlung gemeint sein, der – hinreichende Bildung in griechischer Rhetorik vorausgesetzt – die Anspielung auf Rechtsfälle wie denjenigen um Ktesiphon zu erkennen und einen Bezug zu der in Epist . 2,3Plinius der JüngereEpist. 2.3 erzählten Demosthenes-Anekdote herzustellen vermag.Plinius der JüngereEpist. 2.19
Als Kontrastbild zur Senatsverhandlung des Priscus-Falles, die Plinius zufolge dem Ideal der antiquitas entsprechend abgehalten wurde, begegnen wir einer Szene im Zentumviralgericht, von der wir in Epist . 2,14Plinius der JüngereEpist. 2.14 lesen.73 Nur durch einen Brief – 2,13Plinius der JüngereEpist. 2.13 an einen Priscus (!)74 – sind die beiden völlig unterschiedlichen Schilderungen zeitgenössischer Gerichtspraxis getrennt. Wurde in Epist . 2,11–12Plinius der JüngereEpist. 2.11/12 von einem „Highlight“ aus Plinius’ juristischer Karriere erzählt, zeichnet der Brief 2,14 an Maximus75 ein Porträt vom tristen Alltag.76 Anders als der Aufsehen erregende Priscus-Fall (2,11,1: actum…personae claritate famosum, severitate exempli salubre, rei magnitudine aeternum ), spielt sich im Zentumviralgericht nichts Spannendes ab (2,14,1): Die meisten Fälle ( causae ) seien parvae et exiles; raro incidit vel personarum claritate vel negotii magnitudine insignis ; deutlich sind hier die Anklänge an den Beginn von Epist . 2,11. Durfte Plinius die Anklage gegen Priscus zusammen mit einem Redner wie Tacitus bestreiten, so gibt es im Zentumviralgericht kaum mehr Kollegen, mit denen er plädieren will (2: ad hoc pauci, cum quibus iuvet dicere ). Die Anordnung der Briefe im Buch suggeriert dem Leser somit eine zeitliche Progression bzw. vermittelt den Eindruck von einer Art Verfall der Redekunst. Die in Epist . 2,14Plinius der JüngereEpist. 2.14 geschilderten Verhandlungen dürften jedoch vor dem Priscus-Fall anzusetzen sein: In Epist . 10,3aPlinius der JüngereEpist. 10.3a lesen wir, dass Plinius die praefectura aerarii Saturni übernommen hat und für die Zeit seiner Amtsausübung – diese wird von Sherwin-White (1966: 75‒8) auf Januar 98 bis Ende August 100 n. Chr. datiert ‒ auf Tätigkeiten als Advokat verzichtet;77 lediglich für die Anklage gegen Marius Priscus bittet Plinius um eine Ausnahme beim Kaiser. In Brief 2,14 wiederum sagt Plinius von sich, dass er von Prozessen im Zentumviralgericht stark beansprucht werde (1: distringor centumviralibus causis ), was sich dann eigentlich auf die Zeit vor der praefectura aerarii Saturni beziehen müsste.78 Die Platzierung dieses Briefes innerhalb des Buchkontextes suggeriert dem linearen Leser jedoch eine Antiklimax in Plinius’ Tätigkeit als Anwalt, wozu auch der lange otium -Brief 2,17Plinius der JüngereEpist. 2.17 sowie das negative Charakterporträt des Regulus in 2,20Plinius der JüngereEpist. 2.20 beitragen.79
Читать дальше