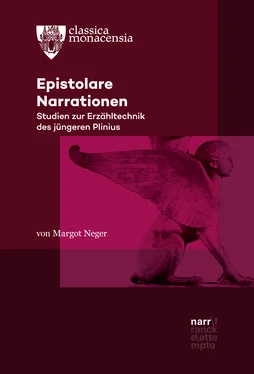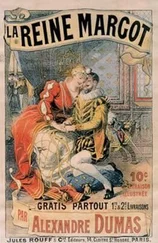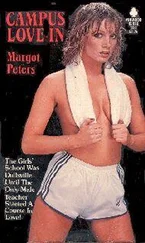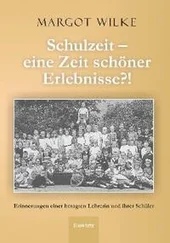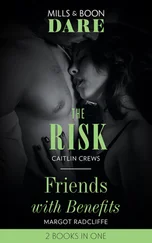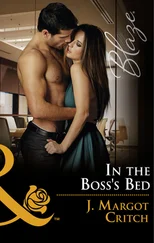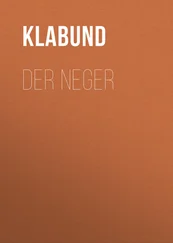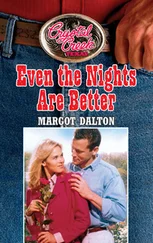Der epistolare Rahmen der Briefsammlung bringt es mit sich, dass wir mehrere Ebenen der Kommunikation zwischen Autor bzw. Erzähler und Rezipient unterscheiden können: Zunächst einmal ist da ein Autor namens C. Plinius Caecilius Secundus, der ein Briefkorpus publiziert hat, um damit einen größeren Leserkreis anzusprechen. Das Briefkorpus insgesamt dürfte nicht zuletzt auf die positive Selbstdarstellung dieses Plinius vor seinen Zeitgenossen sowie der Nachwelt abzielen.1 Auf einer zweiten Ebene finden wir dann sozusagen das epistolographische Ich bzw. die persona dieses Plinius, d.h. den Schreiber, der auch Sprecher der einzelnen Briefe ist, die an unterschiedliche Adressaten gerichtet sind.2 Wenngleich die Einzelbriefe verschiedene Themen behandeln und sich auch durch unterschiedliche Sprechhaltungen der persona des Briefschreibers auszeichnen,3 fällt dennoch auf, dass diese persona über die gesamte Briefsammlung hinweg relativ einheitlich charakterisiert ist.4 Dies trägt zur Kohärenz des Gesamtkorpus bei und animiert den Leser außerdem, aus den Briefen eine Biographie des Sprechers zu rekonstruieren. Da es sich hier auch um die Stimme handelt, die das Briefkorpus dominiert, können wir sie mit dem „primary narrator“ einer Erzählung wie in Epos, Roman oder Geschichtswerk vergleichen.5 Das epistolographische Ich bzw. der „primary narrator“ ist zugleich auch ein „internal narrator“ oder gar autodiegetischer Erzähler, da seine Person im Zentrum steht und er in zahlreichen Briefen als handelnde Figur auftritt,6 die auf intradiegetischer Ebene immer wieder mit anderen handelnden Figuren kommuniziert – dies geschieht allerdings zumeist mündlich, sodass wir in die schriftliche Korrespondenz auf der Ebene des „primary narrator“ häufig eine mündliche Kommunikation zwischen einem „secondary narrator“ und „secondary narratee“ eingebettet haben. Im Rahmen der Briefsammlung hat der „internal primary narrator“ mit den verschiedenen Briefadressaten zahlreiche korrespondierende „internal primary narratees“, an die er seine Ausführungen richtet; zugleich werden diese Kommunikationsakte vom allgemeinen Leser als „external narratee“ mitverfolgt,7 der die einzelnen Briefe in eine größere Narration von Pliniusʼ Biographie einzuordnen und sein soziales Netzwerk zu überblicken versucht.
Einen besonderen Status in diesem kommunikativen Geflecht nimmt der bereits oben diskutierte Brief 1,1Plinius der JüngereEpist. 1.1 ein, mit dem Plinius seine Sammlung eröffnet und in dem er sich zur Publikation der Briefe äußert.8 Zwar ist dieser Brief, der zugleich die Funktion einer praefatio hat, nicht explizit an den allgemeinen Leser, sondern an Septicius Clarus gerichtet, doch lassen die meta-epistolaren Aussagen den Rezipienten glauben, hier den realen Autor des gesamten Korpus sprechen zu hören, nicht nur den Verfasser einzelner Briefe. Die Konstellation ist hier mit derjenigen vergleichbar, die Pausch (2011) am Geschichtswerk des Livius beobachtet hat: Ihm zufolge lassen sich in Ab urbe condita zwei Stimmen des Livius unterscheiden, nämlich die des Erzählers, der aus einer allwissenden Perspektive von der römischen Geschichte handelt, und die des Autors, der sich in den praefationes zur Genese seiner Historie äußert oder im Zuge der Narration verschiedene Überlieferungsvarianten diskutiert.9 Bei Plinius können wir möglicherweise sogar drei verschiedene Stimmen unterscheiden: Die des Autors Plinius, der sich zur Genese seiner Briefbücher10 sowie zu den Konventionen seiner Gattung11 äußert, die des Verfassers einzelner Briefe an einzelne Adressaten sowie die des Plinius als handelnde Figur in einzelnen Erzählungen. Der Rezipient freilich bezieht all diese Stimmen auf dieselbe Person, sodass wir im Fall der Briefe eine ähnliche narrative Identität vorliegen haben, wie sie Genette zufolge für die Autobiographie typisch ist: Autor (A) = Erzähler (N) = Person (P).12
Wie oben ausgeführt wurde, dominiert in der Briefsammlung diejenige Stimme, die sich an verschiedene Adressaten zu verschiedenen Themen und mit unterschiedlicher Sprechhaltung richtet, wohingegen die Stimme des Autors des gesamten Briefkorpus lediglich einmal an programmatischer Stelle in Epist . 1,1, durchscheint. Will man die den Makrotext beherrschende Stimme des Verfassers einzelner Briefe mit derjenigen eines homo- bzw. autodiegetischen Erzählers oder „internal primary narrator“ gleichsetzen, dann fällt als erstes ins Auge, dass wir es nur selten mit einem distanzierten bzw. allwissenden Erzähler zu tun haben, viel häufiger jedoch mit einem Sprecher, der seine Adressaten (sowie den allgemeinen Leser) an seiner Wahrnehmung der Dinge sowie an seinen Gedanken, Zweifeln und Emotionen teilhaben lässt. Die Gattung Brief setzt also von vornherein einen gewissen Grad an Perspektivierung und Fokalisierung voraus, und dies umso mehr, als man in der antiken Theorie den Brief bekanntlich als „Spiegel der Seele“ sowie als Zeugnis für den Charakter des Verfassers betrachtete.13 Man kann also sagen, dass mehr oder weniger jeder Brief einen Akt der Fokalisierung darstellt, indem sich der Sprecher abwechselnd freudig, besorgt, traurig, wütend, zweifelnd, nachdenklich, neugierig, selbstsicher, stolz usw. oder auch relativ neutral bzw. distanziert präsentiert. Häufig finden sich schon am Anfang des betreffenden Briefes Hinweise auf die Gemütslage des Sprechers, wie etwa in Epist . 1,15Plinius der JüngereEpist. 1.15.1 an Septicius Clarus, der einer Einladung zum Abendessen nicht nachgekommen ist: Mit dem Ausruf heus tu! und der Frage promittis ad cenam nec venis? (1) bringt Plinius (scherzhaft) seine Empörung zum Ausdruck. In anderen Briefen wiederum begegnen wir ihm in besorgter oder gar angstvoller Stimmung, etwa wenn es um den Gesundheitszustand von Freunden geht (1,22,1Plinius der JüngereEpist. 1.22.1: perturbat me longa et pertinax valetudo Titi Aristonis ; 7,1,1Plinius der JüngereEpist. 7.1.1: terret me haec tua tam pertinax valetudo ; 7,19,1Plinius der JüngereEpist. 7.19.1: angit me Fanniae valetudo ), oder in Trauer über den Tod verschiedener Personen (1,12,1Plinius der JüngereEpist. 1.12.1: iacturam gravissimam feci…decessit Corellius Rufus…quod dolorem meum exulcerat ; 7,30,1Plinius der JüngereEpist. 7.30.1: torqueor, quod discipulum…amisisti ; 8,23,1Plinius der JüngereEpist. 8.23.1: …dolor, quem ex morte Iuni Aviti gravissimum cepi ). Erfreut zeigt sich Plinius etwa über die Freundschaft zwischen Saturninus und Priscus (7,7,1Plinius der JüngereEpist. 7.7.1: …est enim mihi periucundum ; 7,8,1Plinius der JüngereEpist. 7.8.1: exprimere non possum, quam iucundum est mihi ), von Sehnsucht gequält präsentiert er sich in einem Brief an seine Gattin Calpurnia, die in Kampanien weilt (7,5,1Plinius der JüngereEpist. 7.5.1: incredibile est, quanto desiderio tui tenear ). Eine Art Schadenfreude scheint der Sprecher in Epist . 1,5 gegenüber Regulus zu empfinden, der sich nach dem Tod Domitians ängstlich und kriecherisch verhält (1,5,1Plinius der JüngereEpist. 1.5.1: vidistine quemquam M. Regulo timidiorem, humiliorem post Domitiani mortem? ). Verächtlich und zugleich verärgert zeigt sich Plinius, als er über die Ehreninschrift für Pallas, den Freigelassenen des Kaisers Claudius, berichtet (7,29,1Plinius der JüngereEpist. 7.29.1: ridebis, deinde indignaberis, deinde ridebis ; vgl. 8,6).
In denjenigen Briefen, die stärker dem Prinzip des narrare verpflichtet sind und in denen handelnde Figuren auftreten, wird mitunter auf die Perspektive dieser Figuren fokalisiert – sei es, dass Plinius selbst als handelnde Person in Erscheinung tritt, sei es, dass andere Figuren betroffen sind. So schildert Plinius etwa in Epist . 2,11Plinius der JüngereEpist. 2.11.11 seinePlinius der JüngereEpist. 2.11.11 Aufregung vor seinem Auftritt als Redner vor Kaiser und Senat im Prozess gegen Marius Priscus (11): imaginare, quae sollicitudo nobis, qui metus…tunc me tamen ut nova omnia novo metu permovebant .14 In Epist . 9,13Plinius der JüngereEpist. 9.13 gewinnen wir Einblick in die Gedanken des Plinius vor der Anklage des Publicius Certus im Senat.15 Ein schlechter Traum sucht den jungen Plinius in Epist . 1,18Plinius der JüngereEpist. 1.18 vor einem Prozess heim, in dem er einen gewissen Iunius Pastor vertritt. In Epist . 1,5Plinius der JüngereEpist. 1.5 wird die Furcht des M. Aquilius Regulus vor Plinius nach dem Tode Domitians durch direkte und indirekte Rede zum Ausdruck gebracht.16 Der Brief 2,20Plinius der JüngereEpist. 2.20 wiederum charakterisiert Regulus als üblen Erbschleicher und gibt in diesem Zusammenhang dessen Gedanken und Überredungsversuche wieder. Epist . 6,16Plinius der JüngereEpist. 6.16 schildert die Beweggründe des älteren Plinius, den Vesuvausbruch näher zu untersuchen, zum Teil aus dessen Perspektive.17
Читать дальше