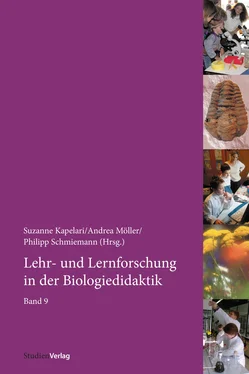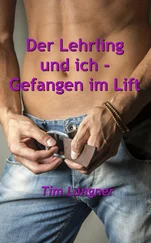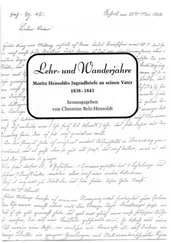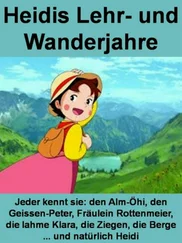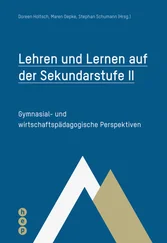Im Folgenden werden nun zwei Theorien dargestellt, die für die Erhebung und Analyse von Vorstellungen und ebenso für ein Verständnis der Fachlichen Klärung zentral sind.
2.1 Die konstruktivistische Sicht auf Fachinhalte und Lernen
Aus erkenntnistheoretischer Sicht sind alle Vorstellungen individuell konstruiert (z.B. Duit, 1995). Fachwissenschaftliche Erkenntnisse sind somit genauso konstruiert wie Alltagsvorstellungen, mit dem Unterschied, dass wissenschaftliche Vorstellungen einer breiteren, systematischen Erfahrungsbasis entstammen und ihnen daher eine (zumindest zeitweise) operationale Gültigkeit und Erklärungsmacht zugesprochen wird (Duit et al., 2012), d.h. sie sind viabel. In der Fachliteratur sind daher keine ‚wahren‘ Sachstrukturen zu finden, sondern begutachtete individuelle Darstellungsweisen fachwissenschaftlicher Inhalte eines Themas, die auf einem Konsens einer WissenschaftlerInnengemeinschaft beruhen. Dies kann fachlich adäquat, aber auch missverständlich repräsentiert werden. Fachliteratur ist für eine bestimmte Zielgruppe, i.d.R. ExpertInnen geschrieben. Als Konsequenz kann eine fachwissenschaftliche Sachstruktur nicht direkt als eine Sachstruktur für den Unterricht übernommen werden, sondern ist von Lehrpersonen für ihre Lernenden fachlich zu klären und didaktisch zu rekonstruieren – Unterrichtsinhalte sind ebenfalls Konstrukte.
Auch wenn Lernende üblicher Weise über eine weniger differenzierte Erfahrungsbasis als WissenschaftlerInnen verfügen, sind sie eigenständige Konstrukteure ihrer Vorstellungen. Folglich ist es aus konstruktivistischer Sicht mit Blick auf Lehr-Lernprozesse eine „Illusion, daß Sprache an und für sich die Fähigkeit habe, Begriffe und somit Wissen von einer Person zu einer anderen zu übermitteln“ (Glasersfeld, 1995). Wissen oder Vorstellungen können nicht direkt an andere Personen weitergegeben werden. Dennoch ist Sprache ein wichtiges Werkzeug für fachliches, fachdidaktisches und verstehendes Lernen (Gropengießer, 2010). Sprache kann Vorstellungen bezeichnen und ähnliche Vorstellungen hervorrufen.
2.2 Erfahrungsbasiertes Verstehen
Die Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens (kurz: TeV) beschreibt den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken sowie die Entstehung unseres kognitiven Systems aus unseren Erfahrungen mit der Umwelt (Gropengießer, 2007). Unsere Erfahrungen bewirken die Bildung der grundlegenden Strukturen unserer Kognition, die für uns direkt verständlich sind. Diese sogenannten verkörperten Vorstellungen nutzen wir dann, um abstrakte Sachverhalte imaginativ zu verstehen (Lakoff & Johnson, 1980). Imagination meint dabei die Übertragung der Struktur von Basisbegriffen und Schemata auf den zu verstehenden Zielbereich. Dies ermöglicht das Verstehen abstrakter Bereiche mit Hilfe der kognitiven Strukturen eines konkreten Bereiches. Daher können sprachliche Äußerungen untersucht werden, um auf Vorstellungen und Metaphern zu schließen. Wichtig ist hierbei zwischen der Ebene der Sprache und der Ebene der Vorstellungen zu unterscheiden.
Insgesamt ist der Forschungsstand zu Vorstellungen über die inhaltliche Unterrichtsplanung von Lehramtsstudierenden der Biologie eher fragmentiert. Es gibt jedoch empirische Befunde, die zeigen, dass die Auseinandersetzung mit Fachinhalt in Vermittlungsabsicht für Lehramtsstudierende diverser Fächer eine Herausforderung darstellt. Die nachfolgende Tabelle 1gibt einen Überblick über Vorgehensweisen bei der inhaltlichen Planung von Lehramtsstudierenden und listet die empirischen Studien, die dies jeweils zeigen.
Tabelle 1: Übersicht über Vorgehensweisen von Lehramtsstudierenden diverser Fächer beim inhaltlichen Planen und über empirische Studien, die den jeweiligen Befund zeigen.
| Vorgehensweisen von Lehramtsstudierenden beim inhaltlichen Planen |
Empirische Studien |
| Als Kern der inhaltlichen Planung erfolgen kurze und knappe Sachanalysen. |
Gassmann (2013) |
| Übernehmen von – aus studentischer Sicht – korrekten Fachinhalten als Unterrichtsinhalte. |
Dannemann (2018); Hunger (2013) |
| Curriculare Planungsrichtlinien werden wörtlich als Zielvorgaben des inhaltlichen Planens verstanden. |
Weingarten (2019); Tänzer (2011); Westermann (1991) |
| Schülervorstellungen werden beim inhaltlichen Planen kaum oder nicht berücksichtigt. |
Weitzel & Blank (2019) |
| Im Vordergrund der inhaltlichen Planung steht die geplante Lehrtätigkeit (Lehrerzentrierung). |
Weingarten (2019); Dannemann (2018); John (1991) |
| Primärer Fokus liegt auf der Auswahl und teils Entwicklung von Unterrichtsmaterialien. |
Weitzel & Blank (2019); Tänzer (2011); Nilssen (2010); John (1991) |
Die Befunde in der Tabelle 1kennzeichnen Vorgehensweisen, die der Komplexität der Aufgabe nicht gerecht werden. Die Erarbeitung und Gestaltung von fachspezifischen Inhalten für den Unterricht stellt somit eine Herausforderung für Lehramtsstudierende diverser Fächer dar. Unterrichtinhalte werden primär aus dem Curriculum abgeleitet, aus gängiger Literatur übernommen und dabei kaum auf Schülervorstellungen bezogen (s. Tabelle 1). Es werden kurze und knappe Sachanalysen erstellt, jedoch liegt der Fokus innerhalb der Unterrichtsplanung vielmehr auf Überlegungen zur Auswahl von Unterrichtsmaterialien und -methoden (z.B. Weitzel & Blank, 2019). Anstatt fachwissenschaftliche Inhalte für den Unterricht fachlich zu klären und didaktisch zu rekonstruieren, werden inhaltliche Überlegungen insgesamt vernachlässigt (Nilssen, 2010). Die Planungen erfolgen zudem meistens lehrerzentriert, d.h. Überlegungen zur eigenen Lehrtätigkeit stehen im Fokus des Planens.
Lehramtsstudierende der Fächer Mathematik, Geografie, Sachunterricht, Musik, Politik und Sport zeigen insgesamt ähnliche Vorgehensweisen. Für das Schulfach Biologie gibt es vergleichsweise jedoch wenige bis keine empirischen Befunde zur inhaltlichen Unterrichtsplanung von Lehramtsstudierenden und auch die gymnasiale Schulform wird in bisherigen Studien meistens vernachlässigt. Hier besteht ein Desiderat.
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Theorien, der DR und des Standes der Forschung ergibt sich das Erkenntnisinteresse dieser Teilstudie. Für die inhaltliche Unterrichtsplanung mit der DR kommt der Fachlichen Klärung eine Schlüsselrolle zu (Duit et al., 2012). Folgende Fragestellungen [F] sind zu untersuchen:
[F1] Über welche Vorstellungen zur Fachlichen Klärung als Teil der inhaltlichen Unterrichtsplanung verfügen Biologie-Lehramtsstudierende des gymnasialen Lehramts?
[F2] Welche Lernschwierigkeiten sind anhand der Ergebnisse vorauszusehen?
5 Untersuchungsdesign und Methodik
Die DR gibt das Forschungsprogramm dieser Studie vor und zielt „auf eine Verbesserung von Unterrichtspraxis und Lehrerausbildung“ (Komorek, Fischer & Moschner, 2013, S. 46). Dabei sind die drei in wechselseitiger Beziehung stehenden Untersuchungsaufgaben der DR empirisch zu bearbeiten (Duit et al., 2012) (s. Abbildung 1). Besonders die Lernpotentialdiagnose ist wichtig, weil hochschuldidaktische Forschung u.a. Vorstellungen von Lehramtsstudierenden einbeziehen sollte (Lohmann, 2006). Vorstellungen über die Fachliche Klärung als Teil der inhaltlichen Unterrichtsplanung bilden den Untersuchungsgegenstand dieser Teilstudie. Daher wurden leitfadengestützte Einzelinterviews mit Lehramtsstudierenden im Master des Faches Biologie geführt, die alle audio- und videographiert wurden. Die jeweiligen Aussagen wurden mit der Qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2015; Gropengießer, 2008) und der systematischen Metaphernanalyse (Schmitt, 2017) analysiert, um im Sinne der TeV auf Vorstellungen zu schließen. Es geht darum, Kategorien der Vorstellungen von Lehramtsstudierenden herauszuarbeiten.
Читать дальше