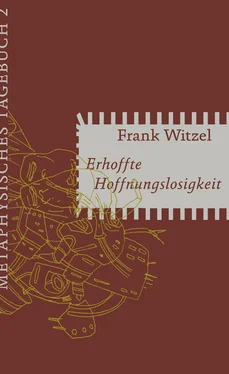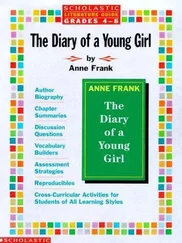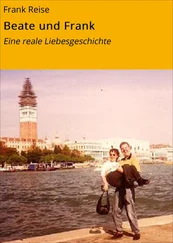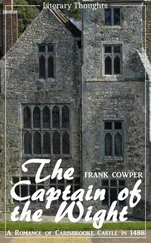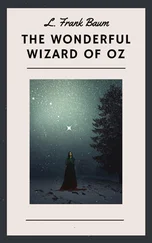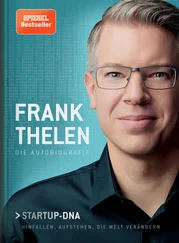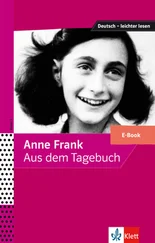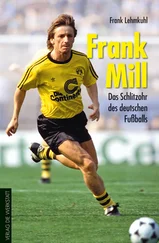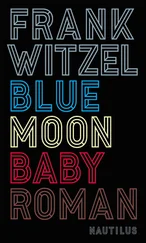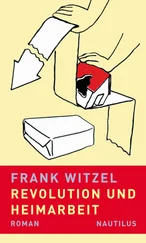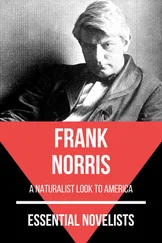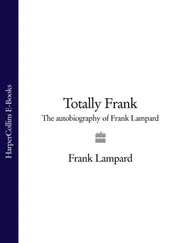Derrida: »Je ne philosophe que dans la terreur, mais dans la terreur avouée, d’être fou.«
Es gibt einen Gedanken, der mich seit sehr vielen Jahren begleitet: Ich stelle mir vor, mich mit einem einzigen Buch zu begnügen, einem umfangreichen beziehungsweise komplexen Buch natürlich, und über einen längeren Zeitraum nur noch dieses Buch zu lesen, langsam, sehr langsam, sehr genau, bis ich seine Sprache und seinen Inhalt völlig verinnerlicht habe, weil ich hoffe, dadurch einen anderen Zugang zur Welt, die mich umgibt, oder meinem Leben in mir und bestenfalls beidem gleichermaßen zu finden. Es erscheint wie eine leichte Übung, doch sobald ich damit anfange, stoße ich auf andere Autoren, Bücher, Begriffe, und meine, zuerst diese klären zu müssen, um das eine Buch auch wirklich in seiner ganzen Tragweite verstehen zu können. Zumindest sage ich mir das, auch wenn ich weiß, dass es sich dabei nur um eine Ausrede handelt. Natürlich habe ich mich immer wieder über Monate mit einem einzigen Autor beschäftigt, aber diese wirkliche Beschränkung auf das eine Buch ist mir nie über einen längeren Zeitraum gelungen. Eher konnte ich Zeit mit einer Suite von Bach, einem Satz daraus, ein, zwei Takten daraus, verbringen, und je länger und langsamer ich sie übte, desto befriedigender war das Gefühl, was ich dabei empfand, weil es sich immer weiter von dem Gedanken an ein Resultat entfernte. Auch darin liegt bei diesem imaginierten eingeschränkten Lesen natürlich meine Hoffnung: mich von einem Resultat, überhaupt einem Verstehen-Wollen, weg- und auf etwas zuzubewegen, das von mir bislang gar nicht oder nur in dürftigen Ansätzen erfahren wurde. Eher war es mir gelungen, über einen längeren Zeitraum hinweg gar nicht mehr zu lesen, nur noch dazusitzen und meine Atemzüge zu zählen. Auch hier hoffte ich, etwas Grundlegendes in meinem Leben zu ändern, und tatsächlich gab es auch eine Änderung, die sich über ein halbes, einmal sogar über ein ganzes Jahr erstreckte, um mich dann doch wieder zu dem zurückkehren zu lassen, was ich zu verlassen versucht hatte. Die Frage, die sich natürlich unmittelbar aufdrängt, ist die, warum ich nicht alles beim Alten belasse, es einfach so laufen lasse, wie es ohnehin läuft.
Das erinnert mich an eine Stelle bei Kierkegaard: »Der Pharisäer im Evangelium ist ein Heuchler, sofern er sich über den Zöllner und andere Menschen erhebt; wie er das aber im Gebet zum Ausdruck bringt, ist komisch. Man denke sich: er spricht mit Gott, und sagt zu Gott, daß er dreimal die Woche faste und von allem was er habe, bis auf Kümmel und Minze hinaus, den Zehnten gebe. Man sieht leicht, daß er nicht mit Gott spricht, wie er meint, sondern mit sich selbst oder einem anderen Pharisäer.« Auch wenn es kein Gebet ist, bin ich insofern ein Pharisäer, weil ich so tue, als spräche ich zu mir, obwohl ich in Wirklichkeit zu einem anderen spreche, oder eigentlich noch genauer: vor mir, oder später, wenn ein anderer das liest, so tue, als spräche ich zu mir oder zu ihm, wo ich lediglich einer Vereinbarung folge, weder mich selbst noch den anderen anspreche, sondern ein Konstrukt vor dem errichte, was Lacan den großen Anderen genannt hat. Ich befinde mich beinahe automatisch in diesem Spannungsfeld, und selbst innerhalb eines persönlichen Textes wie dem eines Tagebuchs gelingt es mir nicht, etwas an dieser Rollenverteilung zu ändern.
Wie man an den beiden Abschnitten sehen kann, versuche ich gerade wieder, in mein »normales« Denken zurückzukehren. Aber noch funktioniert es nicht so ganz, denn zumindest fällt mir gleich, nachdem ich es hingeschrieben habe, auf, dass ich hier Denken simuliere, dass ich etwas reproduziere, auch wenn ich meine, es zu produzieren. Ich höre mich mit einer fremden Stimme sprechen, die doch meine eigene ist. Diese Stimme sagt etwas auf, was sie irgendwann einmal auswendig gelernt hat. Gleichzeitig ist es beinahe rührend, wie ich mir auch inhaltlich eine Lösung anbiete: »Das eine Buch, die paar Takte Bach. Eigentlich könnte ich es doch so einfach haben. Eigentlich läuft doch alles. Ein paar Gedanken, ein paar Texte. Niemand würde etwas merken. Selbst ich nicht.« Aber ist es nicht verständlich, dass ich die Beschäftigung mit meinem vermeintlichen Wahnsinn nicht dauerhaft durchhalte, weil sie selbst die Form des Wahnsinns anzunehmen scheint?
Selbst dem Verrückten gelingt es nicht immer, verrückt zu sein.
Dazu fällt mir ein Witz ein. In einem Varieté treten sowohl der angeblich größte Mann der Welt als auch der kleinste Mann der Welt auf. Ein Verehrer des Riesen möchte ein Autogramm von ihm und klopft nach der Vorstellung an dessen Garderobentür. Als zu seiner Überraschung nicht er, sondern der kleinste Mann der Welt öffnet, sagt er unwillkürlich: »Ach, sind Sie nicht der größte Mann der Welt?« »Doch«, antwortet der, »aber wissen Sie, nach Feierabend mache ich es mir gern etwas bequem.«
Was aber ist dieses Gefühl des Wahnsinns im Vergleich zu dem eigenartigen Tick, der mich seit einigen Tagen verfolgt und mir mehrfach am Tag eine Textzeile eingibt, nämlich: »I know a happy place where I must go.« Es ist eine Zeile aus dem Song Good Side of June von den Lords. Die Lords, der Inbegriff des Uncoolen, wie ich sie schon mit 12 empfunden habe. Allein der Name, der aus dem Schlager ( Lord Leicester aus Manchester ), der Vorabendserie ( Lord Percy Stuart vom Excentric Club ) und der Zigarettenmarke meiner Tante stammte, und die Angewohnheit der Bandmitglieder, sich Spitznamen zu geben, die sie dann auch noch mit dem Adelstitel versahen (Lord Ulli, Lord Max usw.), von dem Kellner-Livree, in dem sie auftraten, einmal ganz abgesehen. Ästhetisch unsicher wurden sie nie ihre Skiffle-Vergangenheit los, auch wenn sie ein paar Beat-Nummern coverten und daraus einen einzigen eigenen Hit destillierten: »Poor Boy«. Unergründlich und verschlungen bleiben die Wege des Unbewussten, das mir eine Textzeile auf die Lippen zwingt, die ich, wo schließlich auch?, seit mehreren Jahrzehnten unter Garantie nicht mehr irgendwo gehört habe und die sich mir dennoch eingeprägt hat, obwohl mir das Lied selbst nie gefiel. Ist es ähnlich wie mit dem Fluchen, dass der Schlager eben nicht über das ästhetische Empfinden, sondern über andere Wahrnehmungskanäle verarbeitet und entsprechend gespeichert wird? Was kommt als Nächstes? »Gloryland«? »Have a Drink On Me«?
Das, was man seit Erfindung des Films die Zeitlupe nennt, existiert auch im wirklichen Leben. Es ist die Aufhebung der Zeit in Momenten völliger Panik. Im Gegensatz zum Film, in dem ich im Nachhinein verlangsamt anschauen kann, was geschah, findet diese Wahrnehmung im Moment des Geschehens statt. Zusammen mit dieser Zeitlupe existiert das, was man analog eine Raumlupe nennen könnte – und was im Film vielleicht »Zoom« hieße. Die Raumlupe ist aber etwas anderes als der Zoom, weil die Raumlupe ähnlich wie die Zeitlupe funktioniert, das heißt der Raum, so wie ich mich in ihm zu befinden meine, wenn ich ihn lediglich als Voraussetzung meiner Wahrnehmung begreife, besteht weiterhin, nur dass ich ihn bewusst wahrnehme, er nicht länger Hintergrund ist, vor dem, oder Bedingung, durch die etwas geschieht. Die Raumlupe vergrößert nicht, sondern macht sichtbar, ähnlich den Röntgenbrillen, die in meiner Kindheit in Zeitschriften angeboten wurden und vorgaben, mit ihrer Hilfe durch die Kleidung von vorzugsweise Frauen schauen zu können. Mit der Raumlupe kann ich durch die Dinge hindurch den Raum sehen, der sie ermöglicht. Ähnlich existiert bei der menschlichen Zeitlupe die Zeit als Voraussetzung meiner Wahrnehmung weiterhin, nur meine ich, die Zeit in ihrem Verlauf (besser: die Zeiten in ihren Verläufen) selbst zu erkennen und nicht wie sonst das Vergehen der Zeit im Moment dieses Vergehens nicht wahrzunehmen, sondern nur im Nachhinein. Raum und Zeit verschieben sich zueinander (man könnte etwa meinen, dass zum Raum hier die Zeit wird oder umgekehrt), werden in ihrer gegenseitigen Bedingtheit fühlbar und rufen in mir, der ich durch diese innere Zeit- und Raumlupe schaue, einen Schwindel hervor, ein Gefühl zu stürzen, zu fallen, orientierungslos zu schweben. Es sind Zustände, die einer Möglichkeit zur Wahrnehmung, noch dazu einer so genauen, zu widersprechen scheinen. Ich meine sogar, und genau das bewirkt eine zusätzliche Desorientierung, das Denken setze aus, bemerke aber in Wirklichkeit, was Denken unter anderem auch ist, nämlich ein beständiges Einordnen und Filtern.
Читать дальше