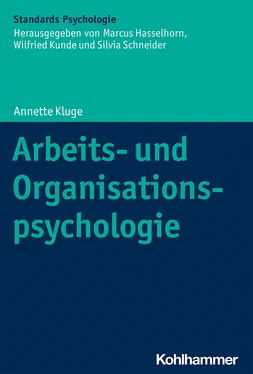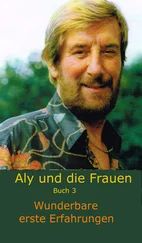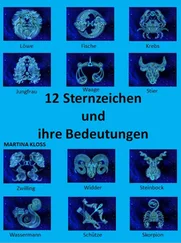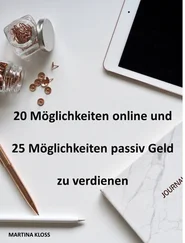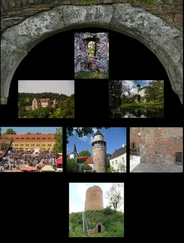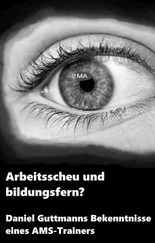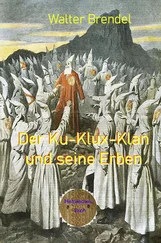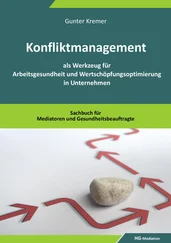b) machtvolle Akteure in der Organisation oder ihrer Nähe (z. B. ein/e neue/r Aufsichtsratsvorsitzende/r, auch als Reaktion auf unternehmerische Aktivitäten aus der eignen Organisation heraus, die zu Innovationen führen),
c) neue Mitglieder in der Organisation (z. B. ein/e neue/r Bereichsvorstand/vorständin, neue Manager/innen)
d) idiosynkratische pfadabhängige Weiterentwicklungen organisationaler Routinen (z. B. ein Verbesserungsvorschlag eines/r Mitarbeiter/in, wie eine Routine oder Geschäftsprozess vereinfacht werden kann)
Auch hinsichtlich der Adaptation und des Weiterbestehens von Populationen ist die Evolutionssichtweise elaborierter als die Sichtweise der Population Ecology. Populationen adaptieren sich, indem sie den Niedergang von anderen Organisationen beobachten, die andere Merkmale (Form/Struktur) aufweisen als die Organisationen, die überleben (Huber, 2011).
In der Praxis findet man diese Theorie in den Unternehmensberatungskonzepten und Managementmethoden, in denen es um »Benchmarking« geht, wieder. Beim Benchmarking mehrere Unternehmen miteinander verglichen, um die Merkmale einer Organisation zu identifizieren, die als Referenz für die optimale Form/Struktur der Leistungserbringung gelten kann. Dazu müssen Best Practices herausgearbeitet werden, die dann auf die eigene Organisation angewandt und in ihr implementiert werden soll.
In der Institutional Theory geht es weniger um Merkmale wie Form und Struktur, sondern um die Werte und Normen, die die Koordination von arbeitsteiliger Arbeit ermöglichen. In allen sozialen Systemen sind demnach Annahmen (beliefs) über die angemessenen Werte und Normen verankert. Als Instituationalisierung wird der Prozess bezeichnet, in dem Annahmen als Regeln betrachtet werden, und – wenn sie von vielen geteilt werden – zu einer starken Kultur reifen (Huber, 2011; O Reilly & Chatman, 1996). Derartige Annahmen können starken Einfluss nehmen und werden auch institutionale Kräfte genannt. Verhaltensweisen, die mit diesen Annahmen verbunden sind, müssen nicht nur interpersonal sein, sondern können sich auch darauf beziehen, wie die »Dinge hier gemacht werden«. Institutionalisierung ist damit ein Prozess, in dem eine Organisation spezielle Merkmale ausbildet, eine distinkte Kompetenz erwirbt oder aber auch ein geübtes Unvermögen (Selznik, 1996, Scott & Davis, 2007).
Institutionalisierung heißt, dass die von Mitgliedern einer Gesellschaft (z. B. der in Deutschland) geteilten Deutungssysteme von diesen Mitgliedern als objektive und externe und als außerhalb der einzelnen Mitglieder liegenden und historisch vor ihnen bestehende Strukturen betrachtet werden (Walgenbach, 1999). Strukturen, Technologien, Prozesse werden als »immer schon gegeben« betrachtet. Die Vorstände haben ihre Büros z. B. immer im obersten Stockwerk in der Konzernzentrale, zur Personalauswahl gehören Auswahlverfahren etc.
Innerhalb der Institutionalsierungstheorien geht man davon aus, dass Führungskräfte generell wenig Einfluss auf die Natur der Organisation haben, und dass die Kräfte der sozialen Normen, der Gesetzgebung und der Ansprüche, die die Gesellschaft stellen, spezielle Anspruchsgruppen oder weitere professionelle Organisationen deutlich stärkeren Einfluss haben. Die Institutional Theory erklärt die Merkmale von Organisationen oder Populationen als Konsequenzen starker institutioneller Kräfte (DiMaggio & Powell, 1983; Huber, 2011). Institutionen bestehen weniger, weil sie durch bewusste Handlungen produziert und reproduziert werden, sondern vielmehr, weil sie durch routinemäßige, reproduzierende Verfahren quasi-automatische Verhaltensabläufe unterstützen und aufrechterhalten (Walgenbach, 1999).
Beispiel für institutionalisierte Annahmen
Viele Organisationen gehen davon aus, dass man Führungsaufgaben nicht in Teilzeit wahrnehmen könne. Führungskräfte müssten sich zu 100 % einbringen und könnten nicht ihre Arbeitszeit reduzieren, um für die Familie da zu sein. Das ist eine institutionalisierte Regel, die »schon immer so ist« und nicht hinterfragt wird. Auch Väter müssten in Führungspositionen zu 100 % arbeiten, denn Führungsaufgaben seien eben nicht teilbar.
Diese reproduzierenden Verfahren werden so lange aufrechterhalten, bis eine Störung den Reproduktionsprozess unterbricht (Walgenbach, 1999). Verhaltensweisen, die institutionalisiert sind, verändern sich langsamer als solche, die es nicht sind, da sich Individuen mögliche Alternativen zu institutionalisierten Elementen meist nicht vorstellen können (»Das wurde hier schon immer so gemacht.«). Im Extremfall bestehen Institutionen fort, obwohl sie in niemandes Interesse mehr sind (Walgenbach, 1999) und gehen als »Fakten« in das soziale Leben ein.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Population Ecology, der Evolutionary View und Institutional Theory die Eigenschaften und Umstände von Organisationen primär als Konsequenzen externer Kräfte betrachten.
In den nun folgenden Theorien werden die Eigenschaften und Umstände von Organisationen als Konsequenzen der Handlungen mächtiger menschlicher Agenten betrachtet.
Resource Dependence Theory
Die Resource Dependence Theory beruht auf der Annahme, dass Organisationen nicht autonom agieren, sondern durch ein Netzwerk von Interdependenzen mit anderen Organisationen eingeschränkt sind, verbunden mit der Unsicherheit, welche Schritte die anderen Organisationen, von denen sie abhängig sind, unternehmen werden.
Organisationen werden deshalb vesuchen, diese Interdependenzen zu managen, auch wenn diese Schritte nicht immer erfolgreich sein werden und neue Abhängigkeiten schaffen (Huber, 2011, Pfeffer, 1997). In der Resource Dependence Theory ist das zentrale Thema daher das Umfeld, in diesem Fall die anderen Organisationen, das die stärkste Determinante der organisationalen Aktivitäten ist. Der Organisation muss es gelingen, möglichst umfangreiche Kontrolle über Ressourcen (z. B. Menschen, Material, Rohstoffe) auszuüben, die auch von anderen Organisationen benötigt werden und die von anderen Organisationen erbracht oder verkauft werden (z. B. Festlegung der Fördermengen von Erdöl durch die OPEC). Die überwiegenden Aktivitäten von Organisationen beziehen sich darauf, die Interdependenzen zu kontrollieren, um die Bedarfe nach speziellen Ressourcen zu befriedigen. Die Resource Dependence Theory erklärt die organisationalen Umstände als Ergebnisse der organisationalen Aktivitäten und Erfolge (oder Misserfolge) bei der Einflussnahme auf und Macht über die Organisationen, die solche Ressourcen besitzen, von denen die Organisation abhängt.
Der Resource-Based View (RBV)
Der Unternehmenserfolg gründet auf strategischen Ressourcenvorteilen (Barney, 1996). Dauerhafter Wettbewerbsvorteil ergibt sich auf der Basis von Ressourcenheterogenität (wie z. B. hochgradig unternehmensspezifischen Kenntnissen) und deren Immobilität (wie z. B. das Unternehmensimage). Als Anforderungen an erfolgspotentialgenerierende Ressourcen gelten Nutzenstiftung am Markt, Selten- bzw. Knappheit, beschränkte Imitierbarkeit sowie Nicht-Substituierbarkeit (Hennemann, 1997). Barney (1991) schlägt eine Klassifikation der Unternehmensressourcen in drei Kategorien vor: physische Ressourcen (technologische Ausstattung, Standort, Zugang zu Rohstoffen u. a.), humane Ressourcen (z. B. Ausbildung, Erfahrung, Urteilskraft, Intelligenz der Unternehmensmitglieder) sowie organisationale Ressourcen (z. B. formale Berichts- und Planungssysteme, Kontroll- und Koordinationsmechanismen sowie informelle Innen- und Außenbeziehungen des Unternehmens). Organisationales Lernen erfüllt in diesem Zusammenhang den Zweck, den eigenen Ressourcenvorteil auszubauen (Kluge & Schilling, 2004). Der Resource Based View wird in Kapitel 4 (Strategisches Human Resource Management) und Kapitel 5 (Unternehmenskommunikation) noch einmal aufgegriffen.
Читать дальше