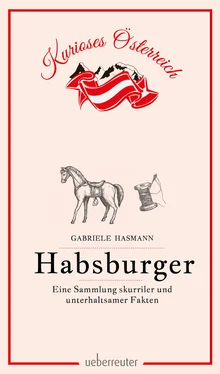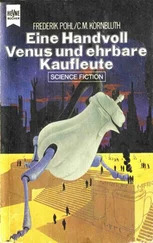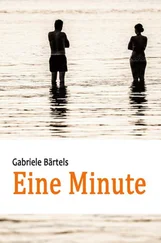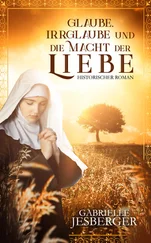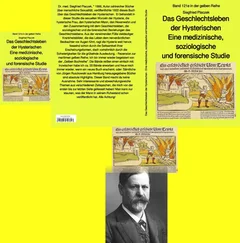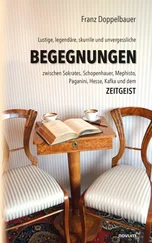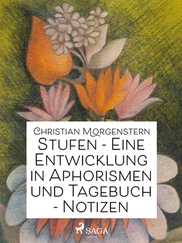Rudolf IV. ist auf dem einzigen von ihm erhaltenen Porträt mit einer Erzherzogskrone dargestellt – die es damals gar nicht gab. Erst im Jahr 1616 hat Maximilian III., Erzherzog von Tirol, den „Erzherzogshut“ als gültiges Machtsymbol anfertigen lassen. Zu sehen ist dieses Sinnbild der Schläue im Stiftsmuseum Klosterneuburg in Niederösterreich.
Bizarre Sammelwut
Haarmenschen und Zwerge
Aus dem Bedürfnis heraus, besonders seltene, wertvolle, exotische und höchst eigenwillige Dinge anzuhäufen, gründete Rudolf IV. im 14. Jahrhundert den Hausschatz der Habsburger. Schon bald schwenkte der Regent von „höchst eigenwillig“ auf „bizarr“ um und konnte sich dabei auch der Faszination durch das Abnorme nicht mehr entziehen. Und so fügte er den vorhandenen Exponaten schon bald diverse Kuriositäten aus aller Herren Länder hinzu.
Ein weiterer exzessiver Sammler von Abnormitäten war Erzherzog Ferdinand II. von Tirol, der auf seinem Schloss Ambras in Innsbruck im 16. Jahrhundert vorwiegend Porträts des Haarmenschen Petrus Gonsalvus von Teneriffa (bis heute bezeichnet man die krankhafte übermäßige Behaarung als Ambras-Syndrom) sammelte. Darüber hinaus holte er sich „Zwerge“ auf sein Schloss und liebte es, sie in ihrer Rolle als „Hofnarren“ zu beobachten.
Eine Vorliebe für „kuriose Menschen“ zeigte auch Kaiser Ferdinand II. – allerdings gehörte es damals fast zum guten Ton, Winzlinge, Riesen, Missgestaltete oder „Mohren“ als Beweis für die Launen der Natur zu beschäftigen und sie bei Gesellschaften vorzuführen. Der „Besitz“ von „ungewöhnlichen Kreaturen“ stärkte den guten Ruf eines Monarchen.
Kaiser Rudolf II. beschäftigte Agenten in ganz Europa, die nach Objekten Ausschau halten und ihm alles herausragend Schöne, Wertvolle oder Seltene bringen sollten. Unter seinen wertvollsten Sammelstücken befand sich beispielsweise der Dolch, mit dem der Überlieferung nach Julius Cäsar erstochen worden war. Allerdings gab es auch jede Menge Abnormes, wie beispielsweise in Alkohol eingelegte Missgeburten, die sich der Kaiser gern abends bei Kerzenschein ansah und eingehend studierte.
Bereits ab dem frühen 17. Jahrhundert, als sich der Adel langsam nichtmehr komplett vom Volk abschottete, wurden Führungen durch die „Kunst- und Wunderkammern“ in Wien veranstaltet.
Der Zopforden
Die weibliche Seite der harten Männer
Im Mittelalter wollten es Mode und Gebräuche, dass harte Männer sich wie Mädchen ausstaffierten und benahmen.
Im 14. Jahrhundert stand beispielsweise Albrecht III., ein Bruder von Rudolf IV., total auf Zöpfe! Er wollte sich deshalb keinem der damals gängigen Ritterorden anschließen, sondern eine eigene Vereinigung gründen: den „Zopforden“oder „Orden von der Locke“, der als Vorläufer des Ordens vom Goldenen Vlies gilt. Nach Albrechts Tod löste sich dieser Männerbund jedoch auf. Das einzige noch erhaltene Ordensabzeichen ist im „Museum im Palais“ zu bewundern, das sich im „Universalmuseum Joanneum“ in Graz befindet.
Die männlichen Mitglieder des „Zopfordens“ trugen nicht nurihr langes Haar geflochten, sondern auch noch einen Halsreif aus Silber in Form eines Zopfes sowie eine kleiderähnliche Tracht mit eigens dafür entworfenem Design. Aufgrund der weiblichen Gewandung galt Albrecht III. später sogar als Transvestit – auch wenn es dieses Wort damals noch gar nicht gab.
Weit weniger kurios, als es interpretiert werden könnte, ist, dass sichdie Könige Friedrich „der Schöne“ aus dem Haus Habsburg und Ludwig IV. aus Bayern auf den Mund küssten. Stattgefunden hat die Intimität nach ihrem Waffenstillstand und bei der Versöhnung im Jahr 1325 auf Burg Trausnitz in der Oberpfalz, auf der Ludwig seinen Vetter Friedrich zuvor drei Jahre lang gefangen gehalten hatte. Das geschmuste Lippenbekenntnis stellte in jener Zeit einen Akt zur Bekräftigung des Friedens dar. Nach der anschließenden Orgie, die als Osterfeierlichkeit getarnt wurde, teilten sich die beiden Herren sogar eine Schlafstatt. Bei dem Ruhen Seite an Seite handelte es sich ebenso um einenAkt mit Symbolcharakter, der Eintracht und Vertrauen demonstrieren sollte. Eine andere Erklärung für die gemeinsame Nacht wäre, dass einer der beiden Männer weinlaunig nicht in sein eigenes Bett gefunden hat.
Inkognito
Der adelige Minnesänger mit den leeren Taschen
Friedrich IV., der zu Beginn des 15. Jahrhunderts die kurzlebige ältere Tiroler Linie der Habsburger begründete, dürfte viel Spaß am Verkleiden undam Rollenspiel gehabt haben. Dem Neffen von Albrecht III. wird beispielsweise nachgesagt, dasser sich auf einem Hof als Knecht anstellen ließ, um inkognito die Arbeit seiner Bauern zuüberprüfen. Häufig mischte er sich aber auch als armer Schlucker unters Volk, tauchte dabei vorwiegend in Gaststätten auf, um beim geselligen und weinlaunigen Beisammensein die Stimmung unter den „einfachen Leuten“ einzufangen. Darüber hinaus erschien er häufig verkleidet in Klöstern, um herauszufinden, wie die Geistlichkeit über ihn dachte – es handelte sich in beiden Fällen um eine politische Maßnahme zum Ausbau seiner Machtposition.
Im Jahr 1416 soll Friedrich IV. zudem in Gestalt eines Minnesängers ausder Gefangenschaft in Konstanz zurück nach Tirol geflüchtet sein und als Troubadour auch so manches Lied unter den Fenstern holder Damen geträllert haben.
Der Habsburger war wirtschaftlich trotz aller Maßnahmen nur wenig erfolgreich und auch seine zahlreichen politischen Niederlagen wurden stets auf seine finanzielle Misere zurückgeführt. Rasch erhielt der dauerpleite Herrscher den Spottnamen „Friedel mit der leeren Tasche“. Eine Geschichte, welcher er diese wenig schmeichelhafte Bezeichnung verdankt, lautet wie folgt: Während Friedrich im Jahr 1402 in Venedig weilte, zeigte man ihm den Kirchenschatz von St. Markus, der einen enormen Wert hatte. Der Habsburger wurde gebeten, sich ein Stück der Juwelen als Geschenk auszusuchen. Er jedoch zog einen kostbaren Diamantring vom Finger und überreichte ihn dem Dogen mit den Worten, er sei von seinen Vorfahren unterwiesen worden, Schätze nicht zu vermindern, sondern zu vermehren. Irgendetwas muss der Gute da völlig falsch verstanden haben!
Der Schatzjäger
Ein kleinkrämerischer Geizhals
Im 15. Jahrhundert herrschte über das Habsburgerreich Kaiser Friedrich III., Sohn von Herzog Ernst „dem Eisernen“, den man im Volk aufgrund seines in politischen Belangen phlegmatischen Naturells „des Reiches Erzschlafmütze“ nannte. Er interessierte sich kaum für das Weltgeschehen; so wusste er beispielsweise lange nicht, dass Kolumbus 1492 Amerika entdeckt hatte. Regelrecht leidenschaftlich wurde der Regent hingegen, wenn es um Geld, Gold und Geschmeide ging, denn er war bekannt als begeisterter Schatzjäger. Bereits als Neunjähriger kontrollierte er nach dem Tod seines alten Herrn 1424 die Inventarlisten des väterlichen Erbes und stellte dabei einige Ungereimtheiten fest. Was folgte, war ein zäher Streit mit den Geschwistern um jeden Silberlöffel.
Als er sich im Jahr 1436 im Orient aufhielt, um sich im Heiligen Land zum Ritter schlagen zu lassen, ging er auch gleich shoppen. In Ägypten trieb er sich in der Verkleidung eines Kaufmanns in den Bazaren herum, um Edelsteine zu kaufen.
Wann immer der schlitzohrige Monarch eine Vermehrung seines Reichtums witterte, griff er beherzt zu, fürchtete er hingegen, Geld ausgeben zu müssen, wurde er zum kleinkrämerischen Geizkragen. Zudem erkannte er Fälschungen, von denen es im Mittelalter viele gab, so sicher wie kein anderer.
Friedrich III. schreckte nicht einmal vor Diebstahl zurück: Übernachtete er auswärts, ließ er immer Wäsche oder Geschirr mitgehen.
Читать дальше