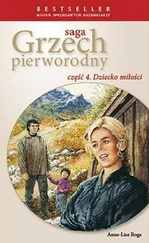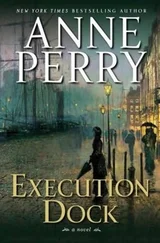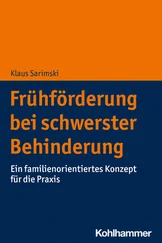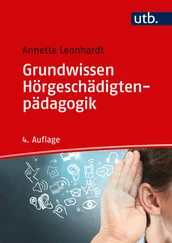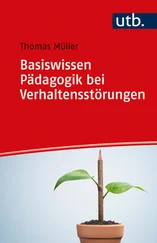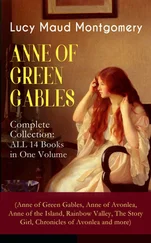Trotz Feusers o. g. Kritik findet sich mittlerweile in der Fachliteratur eine Vielzahl an differenten Begriffsalternativen (vgl. u. a. Kulig et al. 2006). Während Begriffszuschreibungen wie ›Menschen mit kognitiver, intellektueller oder mentaler Beeinträchtigung‹ oder ›Menschen mit seelischer Behinderung‹ noch stark in einem kategorialen Zusammenhang stehen, versuchen Begrifflichkeitsvorschläge wie ›Menschen mit besonderem Unterstützungs-, Assistenz bzw. Hilfebedarf‹ oder ›Menschen mit basalen Fähigkeiten‹ (etc.) weniger starr zu kategorisieren und eher auf zugeschriebene Bedürfnisse/Bedarfsbereiche oder auf mutmaßliche Fähigkeitsbereiche/Kompetenzen (statt auf konstitutive Merkmale oder Ursachenzuschreibungen) zu orientieren. Eine Bedarfs-/Bedürfnisorientierung ist auch im internationalen Sprachraum durch den übergreifenden Terminus ›special needs‹ zu beobachten 21 .
Alle Alternativvorschläge entsprechen nach wie vor einem sogenannten Behinderungsbegriff, welcher »eine von Kriterien abhängige Differenz und somit eine an verschiedene Kontexte gebundene Kategorie« verkörpert, »die eine Relation anzeigt« (Dederich 2009, 15). Damit ist grundsätzlich fraglich, ob sie eine bloße Umbenennung der Kategorie darstellen oder tatsächlich zumindest eine Relativität, eine Kontextsensibilität und/oder eine Flexibilisierung aufweisen und als Rekategorisierungsvorschlag diskutiert werden könnten.
Auch Selbst-/Interessensvertretungsorganisationen favorisieren in der Regel eine Umbenennung und lehnen den Terminus ›Geistige Behinderung‹ ab: Der von Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e. V. favorisierte Begriff lautet ›Menschen mit Lernschwierigkeiten‹ (vgl. Kulig, Theunissen & Wüllenweber 2006), welcher sich mehr und mehr in politisch relevanten Feldern sowie in der Zusammenarbeit mit Selbst- und Interessenvertreterinnen* durchgesetzt hat, aber keineswegs allgemeinen Zuspruch genießt 22 .
Die Schweizer Interessensvertreterinnen*gruppe Mitsprache/Bildungsklub Pro Infirmis Zürich hat sich 2008 auf dem Symposium »Das Ende der ›geistigen Behinderung‹« positioniert: »Wir möchten nicht als geistig behindert bezeichnet werden« 23 und schlägt vor dem Hintergrund umfassender Diskussionen den Begriff ›die An dersbegabten‹ vor (vgl. Weisser 2013). Dieser Vorschlag greift (indirekt) das von Speck und Thalhammer schon 1974 beschriebene konstitutive Merkmal des ›kognitiven Andersseins‹ auf und verdeutlicht, dass auch die Vorschläge von Selbstvertreterinnen* in der Regel (noch) auf einer Dichotomie von ›anders/abweichend‹ und ›normal‹ fußen 24 . Begriffsfassungen, die sich gezielt von einer Diskriminierung oder Beleidigung distanzieren wollen, polarisieren jedoch sehr, und ihnen wird eine Art der scheinheiligen Beschönigung vorgeworfen: Bei alternativen Bezeichnungen wie ›Menschen mit besonderen Bedürfnissen‹ oder ›andersfähige Menschen‹ besteht das hohe Risiko der Entstehung neuer Fehlannahmen und Projektionen: »Die Fähigkeiten und Bedürfnisse behinderter Menschen sind nicht ›besonders‹, sondern genauso vielfältig wie die nicht behinderter Menschen« (Leidmedien 2019, o.S.) 25 .
Die von Buschlinger (2000) und Feuser (2000) oben erwähnte Problematik der Semantik ›geistig/Geist‹ in der Begrifflichkeit Geistige Behinderung wird gemeinhin im deutschen Sprachraum anerkannt (  Kap. I, 3.4): »Gerade das Attribut ›geistig‹ bereitet den damit bezeichneten Menschen heute Schwierigkeiten. Die Gleichsetzung von ›Intellekt‹, ›Kognition‹, also von Denken mit ›Geist‹ greift zu kurz. Der ›Geist‹ ist mehr. Er ist ein Wesensmerkmal des Menschen. Nennt man einen Menschen in seinem Geist behindert, wertet man ihn damit zwangsläufig in seinem Personsein ab« (Fornefeld 2013, 60). Diese berechtigte Kritik wird z. T. mit der Forderung nach einer Dekategorisierung verbunden. Selbige wird jedoch im Kontext der ›cross-kategorialen‹ schulischen Sonderpädagogik für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Verhalten diskutiert (vgl. Benkmann 1994), nicht aber im Hinblick auf den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und das Etikett einer Geistigen Behinderung verhandelt.
Kap. I, 3.4): »Gerade das Attribut ›geistig‹ bereitet den damit bezeichneten Menschen heute Schwierigkeiten. Die Gleichsetzung von ›Intellekt‹, ›Kognition‹, also von Denken mit ›Geist‹ greift zu kurz. Der ›Geist‹ ist mehr. Er ist ein Wesensmerkmal des Menschen. Nennt man einen Menschen in seinem Geist behindert, wertet man ihn damit zwangsläufig in seinem Personsein ab« (Fornefeld 2013, 60). Diese berechtigte Kritik wird z. T. mit der Forderung nach einer Dekategorisierung verbunden. Selbige wird jedoch im Kontext der ›cross-kategorialen‹ schulischen Sonderpädagogik für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Verhalten diskutiert (vgl. Benkmann 1994), nicht aber im Hinblick auf den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und das Etikett einer Geistigen Behinderung verhandelt.
Im allgemeinen Fachdiskurs lassen sich jedoch immer wieder auch Tendenzen von Dekonstruktionen und Dekategorisierungen ausmachen, die auf der radikalen und alternativlosen Abschaffung des Begriffes ›geistig behindert‹ und einem Verzicht auf diese Form der Zuschreibung basieren, weil damit eine Dehumanisierung und Anonymisierung einhergeht (vgl. Feuser 2016). Derartige Dekategorisierungsforderungen wurden u. a. schon von Kobi (2000) und Gaedt (2003) als risikoreich beschrieben, weil sie eine »Akzeptanz der Differenz« (Kobi 2000, 77) verhindern würden in Form von »Verklärungen«, »Positivierungen« oder Versuchen begrifflicher »Auflösungen« (ebd., 73 ff.). Mit Bezugnahme auf das Konstrukt der egalitären Differenz (vgl. Prengel 2001) bleibt hier zu bestätigen, dass Differenz eine grundlegende Kategorie und Voraussetzung für Erkennung und Anerkennung darstellt und eine Leugnung von Differenz die Gefahr der Ausblendung gesellschaftlicher Machtverhältnisse und deren Konsequenzen impliziert.
Wir teilen die Auffassung, dass es unmöglich ist, nicht zu kategorisieren 26 : »Ein gänzlich kategorienabstinentes Denken entzieht sich den menschlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten« (Boger 2018, o. S. mit Bezug auf Levold & Lieb 2017). Damit geht es vielleicht in einem pragmatischen Sinne weniger um das Bestreben nach Dekategorisierung im Sinne eines Verzichts auf Kategorien (vgl. Walgenbach 2018), sondern vielmehr um die Kontextualisierung von Begrifflichkeiten und die Reflexion der (Re)Produktionsmechanismen damit einhergehender Kategorien. Es geht also (auch) um die Frage nach der Entstehungsperspektive: Wem nützt wann welche Orientierung an einer Norm (vgl. Boger 2018)? Wer identifiziert sich in welchem Kontext mit welcher kategorialen Zuschreibung und warum tut sie/er das? Boger verweist in diesem Zusammenhang auf die doppelte Erschließungsnotwendigkeit nicht nur der sozialen Normalitätsraster als Grundlage für Kategorisierungen, sondern auch der »Selbstnormalisierungen und Selbstpathologisierungen, die vom Subjekt selbst ausgehen« (ebd.).
Exkurs: Mit Blick auf den grundlegenden Dekategorisierungsdiskurs in der (Sonder)Pädagogik möchten wir darauf verweisen, dass die Bedeutung von Kategorien in der Regel als unverzichtbar im Rahmen eines professionellen pädagogischen Handlungskonzeptes verstanden werden kann (vgl. Georgi & Mecheril 2018). Georgi und Mecheril (2018) weisen zu Recht darauf hin, dass einem kategorienbezogenen Wissen nicht nur »ein einschränkender, festlegender und auch gewaltförmiger Zug inne« (65) wohnt, sondern Kategorien zunächst als »professionelle Deutungs- und Wahrnehmungsroutinen« zu verstehen sind, welche als »aufeinander in einem Ordnungssystem verwiesene Begriffe zur Strukturierung und Herstellung von Erkenntnis« (ebd.) beitragen. Die Autorinnen berufen sich hier u. a. auf Hornscheidt (2007) in der Lesart, Kategorien als ein »strukturierendes Moment von Wissen« (73) anzuerkennen, welches so gesehen dann das eigene pädagogisch-professionelle Handeln legitimiert. Gleichzeitig ist mit dieser Legitimation auch die Verpflichtung verbunden, die Wirkungen und Folgen des Handelns zu erklären und zu verantworten (vgl. Georgi & Mecheril 2018), und hier schließt sich unseres Erachtens die Dimension an, die wir hier im Kontext einer verbesondernden Pädagogik aufrufen: die Reflexion der Entfaltung von struktureller Diskriminierung durch sprachliche Konstruktionen.
Vor dem Hintergrund dieses Reflexionsanspruches vermischen sich Rekategorisierungs- und Dekategorisierungsforderungen, weil es beiden Ansprüchen weniger um eine »sprachphilosophische Revolte« als vielmehr um »eine Verschiebung der Aufmerksamkeit auf pädagogisch bedeutsame Kategorien« (Walgenbach 2018, 12; Hervorhebung d. A.) geht. Stark an den Anspruch der Dekategorisierung geknüpft scheint der Verzicht auf »separierende bzw. personenbezogene Organisationsmodi in Bildungsinstitutionen« (ebd.), während sich eine Rekategorisierung hier nicht zwingend mit einem Verzicht, sondern eher mit einer tiefgreifenden Reflexion entsprechender kategorialer Zuschreibungen und deren Konsequenzen assoziieren lässt.
Читать дальше
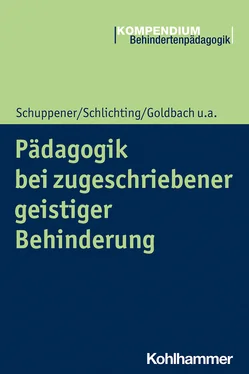
 Kap. I, 3.4): »Gerade das Attribut ›geistig‹ bereitet den damit bezeichneten Menschen heute Schwierigkeiten. Die Gleichsetzung von ›Intellekt‹, ›Kognition‹, also von Denken mit ›Geist‹ greift zu kurz. Der ›Geist‹ ist mehr. Er ist ein Wesensmerkmal des Menschen. Nennt man einen Menschen in seinem Geist behindert, wertet man ihn damit zwangsläufig in seinem Personsein ab« (Fornefeld 2013, 60). Diese berechtigte Kritik wird z. T. mit der Forderung nach einer Dekategorisierung verbunden. Selbige wird jedoch im Kontext der ›cross-kategorialen‹ schulischen Sonderpädagogik für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Verhalten diskutiert (vgl. Benkmann 1994), nicht aber im Hinblick auf den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und das Etikett einer Geistigen Behinderung verhandelt.
Kap. I, 3.4): »Gerade das Attribut ›geistig‹ bereitet den damit bezeichneten Menschen heute Schwierigkeiten. Die Gleichsetzung von ›Intellekt‹, ›Kognition‹, also von Denken mit ›Geist‹ greift zu kurz. Der ›Geist‹ ist mehr. Er ist ein Wesensmerkmal des Menschen. Nennt man einen Menschen in seinem Geist behindert, wertet man ihn damit zwangsläufig in seinem Personsein ab« (Fornefeld 2013, 60). Diese berechtigte Kritik wird z. T. mit der Forderung nach einer Dekategorisierung verbunden. Selbige wird jedoch im Kontext der ›cross-kategorialen‹ schulischen Sonderpädagogik für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Verhalten diskutiert (vgl. Benkmann 1994), nicht aber im Hinblick auf den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und das Etikett einer Geistigen Behinderung verhandelt.