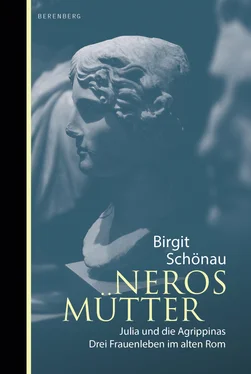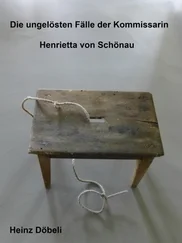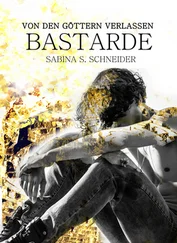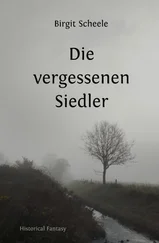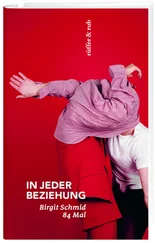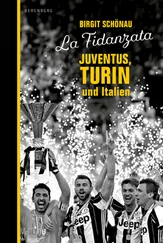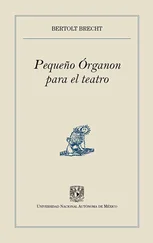So gewaltig, wie sich Stand und Leben der römischen Männer voneinander unterschieden, waren auch die Unterschiede zwischen den Frauen. Eine frei geborene Näherin aus der suburra (Unterstadt) zwischen Forum und Esquilin-Hügel konnte sich beim besten Willen nicht den Alltag der Augustus-Tochter Julia vorstellen, die in ihrem Palast rund um die Uhr von Kosmetikerinnen und Ankleidesklavinnen betreut wurde und mit ihrem Vater beim Abendessen um einen Einsatz würfelte, der dem zwanzigfachen Jahreslohn eines Handwerkers entsprach. Eines jedoch verband Julia in ihren freskengeschmückten Privatgemächern mit der Plebejerin in ihrer rauchgeschwärzten insula- Wohnung: Sie gehörten zum benachteiligten Geschlecht. In jedem Lebensalter und in jeder Gesellschaftsschicht bestimmte ein Mann über ihr Leben und ihren sozialen Status. Ihre Hauptaufgabe war es, Kinder zu gebären, je nach Stand Sklaven, Bürger oder sogar Prinzen, alle möglichst männlichen Geschlechts.
Der Chronist Cassius Dio berichtet, dass im Rom des Augustus weitaus mehr Männer als Frauen lebten. Das Ungleichgewicht erklärte sich zum einen aus der hohen Sterblichkeit der Wöchnerinnen, aber auch aus der höheren Kindersterblichkeit bei Mädchen. Kindsaussetzungen oder die Tötung von Neugeborenen, durchaus gängige Praktiken zur »Familienkontrolle«, trafen weibliche Babys häufiger. Frauen hatten nur durch Heirat Aufstiegschancen, sie waren für die Familien ein Kostenfaktor. Also sparte man bei ihnen an Nahrung, Bildung und medizinischer Versorgung. Auch von den staatlichen Getreidespenden waren sie ausgeschlossen und mussten sich mit dem zufriedengeben, was ihnen die Männer in der Familie übrigließen. Ein Frauenleben war in allen Ständen weniger wert.
Sogar ganz unten, in der Leibeigenschaft, gab es zwischen den Geschlechtern noch Abstufungen der Rechtlosigkeit. Sklaven beider Geschlechter mussten für ihre Herrn jede Art von Arbeit verrichten, auch sexuelle Dienste gehörten dazu. Männlichen Sklaven aber durften mit Erlaubnis ihres Besitzers sexuell über ihre weiblichen »Kolleginnen« verfügen. Vom älteren Cato, einem der großen Moralprediger der untergehenden Republik, erzählt Plutarch, er habe seine Leibeigenen für Sex mit Sklavinnen zahlen lassen, schließlich benutzten sie sein Eigentum. Römische Haushalte verfügten über weitaus mehr männliche als weibliche Sklaven. Von den Kindern der Leibeigenen im kaiserlichen Palast waren über sechzig Prozent Knaben, weil die Mädchen oft schon im zartesten Alter an andere Familien oder in Bordelle verkauft wurden.
Männer waren als Arbeitskräfte gefragter. Sklavinnen verrichteten seltener qualifizierte Arbeiten und hatten deshalb geringere Chancen auf eine Freilassung als ihre männlichen »Kollegen«. Privilegiert waren nur jene, die im direkten Kontakt für Römerinnen der Oberschicht oder gar des Kaiserhauses arbeiteten – als Hebammen, aber auch als Vorleserinnen oder Gesellschaftsdamen. Sehr reiche Frauen beschäftigten Sklavinnen, die ihnen den Sonnenschirm halten oder den Trittschemel zum Ausstieg aus der Sänfte tragen mussten. Auf diese Weise konnte im täglichen Umgang ein Vertrauensverhältnis entstehen, das den leibeigenen Frauen Vorteile verschaffte und ihnen den Weg zur Freilassung bahnte.
Und noch eine Möglichkeit gab es, der Sklaverei zu entrinnen: dem eigenen Herrn eine stattliche Anzahl von außerehelichen Kindern zu gebären. Wenn er nicht wollte, dass diese als Sklaven aufwuchsen, ließ er ihre Mutter frei. Manche Besitzer heirateten sogar ihre Lieblingssklavin, allerdings war das nur für in den unteren Ständen geduldet, Rittern und Senatoren war eine solche Mesalliance gesetzlich verboten.
Frauenarbeit war im Volk weit verbreitet, besonders im Gastronomiebereich und im Handel. Insgesamt waren in der frühen Kaiserzeit mehr als hundert Frauenberufe bekannt, von der Amme bis zur ornatrix , der Friseurin, wörtlich »Schmückerin«, der Oberschichtsfrauen. Frauen waren Schankwirtinnen oder Kellnerinnen, sie verkauften Lebensmittel, Parfüm, Kleidung und Juwelen. Die römischen Theater und Arenen kannten Schauspielerinnen, Sängerinnen, Tänzerinnen und sogar Gladiatorinnen. Deren gesellschaftliches Ansehen war gering, ihr Einkommen dafür jedoch umso höher. Unzählige Frauen arbeiteten in Bordellen, andere in Handwerksbetrieben, vor allem in der Textilproduktion, und nicht wenige hatten ihr eigenes Unternehmen. In Pompeji etwa stieg die Ziegelei-Besitzerin Eumachia zur Schirmherrin ihres Berufsverbandes auf, vertrat also als Lobbyistin auch Männer.
Im Senatorenstand gab es keine Berufstätigkeit, weder für Männer noch für Frauen. Auch bei der Bildung wurden gemeinhin wenig Unterschiede gemacht. Töchter wie Söhne wurden von griechischen Lehrern erzogen, die ihnen Grundzüge der Grammatik und der Mathematik, in selteneren Fällen auch Philosophie und Rhetorik beibrachten. Bildung gehörte für die Mädchen zum notwendigen Gepäck, um sich möglichst Gewinn und Prestige bringend für ihre Ursprungsfamilie zu verheiraten. Liebesheiraten waren Glückssache, von den Vätern vereinbarte Verbindungen üblich. Das Mindestalter für die Hochzeit lag für Mädchen bei vierzehn Jahren, aber Verlobungen im Kleinkindalter waren, wie wir noch sehen werden, keine Ausnahme.
War sie erst einmal matrona (Ehefrau), so hatte die Oberschichts-Römerin eine Menge Freiheiten. Ihre Teilnahme an Gastmählern, wo Männer und Frauen selbstverständlich nebeneinander lagen, war nicht nur normal, sondern ausdrücklich erwünscht. Idealerweise konnten Frauen bei einem solchen convivium geistreich über Kunst, Literatur und Philosophie plaudern, allerdings ohne mit ihrem Wissen anzugeben und die anwesenden Männer übertrumpfen zu wollen. Dieser Balanceakt für die gebildete Frau war schon im alten Rom nichts Neues.
In Abwesenheit ihres Gatten durfte die matrona auch allein zu einem Abendessen außer Haus gehen. Manchmal waren ganze Gruppen von Frauen gemeinsam unterwegs – was bekannt ist, weil Cicero einmal einen Mann verteidigte, der wegen Belästigung einer solchen Frauengruppe angeklagt war. Die gemeinsam genossene Geselligkeit unterschied die Römer von den Griechen, bei denen Frauen im öffentlichen Raum tabu waren und auch private Gastmähler eine rein männliche Angelegenheit blieben. Aus Rom sind derartige Einschränkungen nicht bekannt. Hier gingen Frauen aller Schichten seit der späten Republik ins Theater, in den Circus oder auch zu Gerichtsverhandlungen und nahmen ohne Einschränkung am gesellschaftlichen Leben teil.
Dabei war das Leben der Oberschichtsfrauen voller Widersprüche. Einerseits unerhörter Luxus, viel Zeit für kulturelle Interessen und Teilnahme an allen Vergnügungen, andererseits überkommene moralische Vorschriften und ideologische Vorgaben, die kaum zu erfüllen waren. Die römische Matrone lebte in einem Dauerkonflikt zwischen gesellschaftlicher Realität und überlieferten Idealen. Eigentlich durfte sie ohne einen männlichen Vormund keine Entscheidungen für sich und ihre Angehörigen treffen. De facto aber wurde genau das etwa von Witwen oder Offiziersfrauen selbstverständlich erwartet. Letztere waren manchmal viele Monate oder sogar Jahre auf sich allein gestellt, wenn ihre Männer zu Feldzügen oder anderen Auslandseinsätzen abkommandiert waren – auch die in diesem Buch beschriebenen Frauen der Kaiserfamilie.
Ähnliches galt für Vermögen, die Frauen zwar erben, aber eigentlich nicht selbst verwalten und vermehren durften. Doch schon zur Zeit des Prinzeps Caligula stellten manche Römerinnen ihren Reichtum selbstbewusst zur Schau. Unter Claudius wurden Frauen verbannt, damit der Kaiser ihr Vermögen konfiszieren konnte. Und Lepida, eine Tante von Nero, verfügte auf ihren gigantischen Latifundien in Süditalien über so viele Sklaven, dass diese eine Rebellentruppe bilden konnten.
Читать дальше