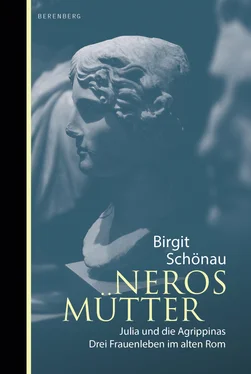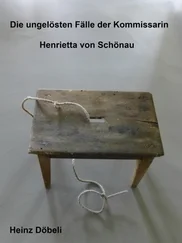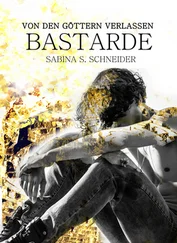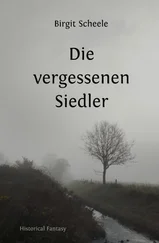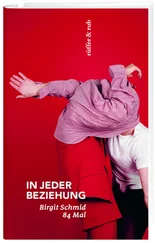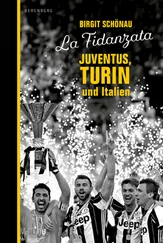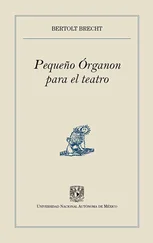Bereits nach Ende des Zweiten Punischen Krieges 200 v. Chr. hatten Roms Oberschichtsfrauen die Abschaffung eines Gesetzes durchgefochten, das ihnen verbot, mehrfarbige Kleidung zu tragen, sich mit mehr als einer halben Unze Gold (dreizehn Gramm) zu schmücken oder mit einem Pferdegespann näher als eine Meile an die Stadt heran zu fahren. »Die Männer jener Epoche durchschauten nicht, zu welchem Luxus es das hartnäckige Drängen des ungewöhnlichen Bündnisses bringen wollte und bis wohin sich der Wagemut, der die Gesetze besiegt hatte, erstrecken würde«, klagte Valerius Maximus, der gut hundert Jahre später die weibliche Aufsässigkeit für den Niedergang der Republik mitverantwortlich machte. Immer wieder wird die angebliche »Unbezähmbarkeit« der Frauen von den antiken Chronisten thematisiert. Trotz aller Anstrengungen der jeweils regierenden Männer ließen sich die Römerinnen offenbar einfach nicht unterkriegen.
Der tiefe Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit entsprang womöglich der Unerreichbarkeit jener Vorzeigefrauen, die seit den Zeiten der Republik als Ideal propagiert wurden. Namentlich die Frauen der Herrscherfamilie mussten diesen Vorbildern nacheifern – ohne nennenswerten Erfolg, wie wir noch sehen werden. Und doch sollten die Ikonen der römischen Vorzeit das Frauenbild weit über den Untergang des Römischen Reiches prägen. Sie blieben in der christlichen Lehre lebendig, überlebten Kirchenspaltungen und die Französische Revolution. Besonders zwei legendäre Frauengestalten prägten das Rollenbild der Römerin als keusche Gattin und als stolze Mutter: Lucrezia und Cornelia, die Mutter der Gracchen.
Als Tochter des Hannibal-Besiegers Scipio gehörte Cornelia im 2. Jahrhundert v. Chr. zu den vornehmsten Frauen Roms. Früh verwitwet, konzentrierte sie sich ganz auf die Erziehung ihrer Söhne Tiberius und Gaius Gracchus, widmete sich ihren Studien und schlug unter anderen einen Heiratsantrag des ägyptischen Königs aus. Als sie einmal gefragt wurde, warum sie (anders als später Lollia Paolina) niemals Schmuck trage, wies sie auf ihre Kinder: »Das sind meine Juwelen!« Die Gracchen wurden Volkstribune, scheiterten aber mit ihren von der Mutter kritisierten, kühnen Reformen und kamen bei den Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern ums Leben. Cornelia ließ sich ihre Trauer nicht anmerken. Denjenigen, die sie trösten wollten, soll sie entgegnet haben, als Mutter der Gracchen sei sie per se vom Schicksal begünstigt.
Bis heute ist Cornelia als Ikone soldatisch-disziplinierter Mütterlichkeit nicht nur in Italien ein Begriff. Als erster nichtgöttlichen Frau wurde ihr in Rom eine Statue gewidmet, deren Sockel sich heute in den Kapitolinischen Museen befindet. Dante platzierte sie neben Virgil und Homer in den Limbus seiner Göttlichen Komödie . Spätestens dadurch wurde die Gracchen-Mutter unsterblich.
Lucrezia hingegen ist in Vergessenheit geraten. Ob sie wirklich existiert hat, ist unsicher. Der Sage nach lebte dieses Muster der Tugendhaftigkeit in der mythenumwobenen Frühzeit. Der Königssohn Sextus Tarquinius, ein Freund ihres Ehemannes, lernte Lucrezia in ihrem Haus kennen. In Abwesenheit ihres Mannes drang er nachts in ihr Schlafzimmer. Als Lucrezia ihn abwehrte, drohte der Prinz, sie zu töten und anschließend einem Sklaven die Kehle durchzuschneiden, um seine Leiche nackt zur ihrer zu legen. So wollte er den Anschein erwecken, sie sei beim Ehebruch entdeckt und bestraft worden. Angesichts dieser Drohung war Lucrezia Sextus zu Willen. Später informierte sie Vater und Ehemann über die erlittene Vergewaltigung und stach sich vor ihnen einen Dolch in die Brust. Lucrezias letzte Worte überliefert Titus Livius: »Auch wenn ich mich von der Schuld losspreche, so befreie ich mich nicht von der Strafe; von nun an wird keine unsittliche Frau unter Berufung auf das Beispiel der Lucrezia mehr leben können!«
Die Selbsttötung der von dem skrupellosen Sextus Tarquinius missbrauchten Lucrezia soll einen Volksaufstand und das anschließende Ende der Monarchie ausgelöst haben. Vor allem aber avancierte Lucrezia bei Generationen von Römern zum leuchtenden Vorbild unerschütterlicher Tugendhaftigkeit. Die eigene Ehre zu bewahren, also jeden sexuellen Akt außerhalb der Ehe zu verhindern, wurde zur wichtigsten Pflicht der Frauen. Nicht von ungefähr bedeutete der Begriff stuprum gleichermaßen Vergewaltigung, Ehebruch und Hurerei: Stuprum war schlicht jede Form von außerehelichem Sex, den eine Frau nicht haben durfte. Eine passiv erlittene Vergewaltigung machte sie in den Augen der Sittenwächter genauso schuldig wie ein aktiv betriebener Seitensprung.
Selbst Dichterfürst Ovid, der uns mit seiner Ars Amatoria ein so poetisches Bild römischer Liebeskunst hinterlassen hat, und die Frauen seiner Zeit als erotisch selbstbewusste Wesen verehrte, hinterfragte nicht dieses Verständnis von weiblicher Ehre und Schuld. In den Metamorphosen erzählt Ovid die Geschichte von Jupiter, der sich in die amazonenhafte Jägerin Callisto verliebt, ihr zunächst in Gestalt der Göttin Diana erscheint und sie dann vergewaltigt. »Sie wehrt sich zwar, soweit sie es als Frau vermag (…). doch wen könnte ein Mädchen und wer könnte Jupiter besiegen?« Mit Begriffen wie Verfehlung ( crimen ) und Verschulden ( culpa ) unterstellt Ovid dem Opfer Callisto die Verantwortung für das Geschehen. Letztendlich verwandelt Jupiters Göttergattin Juno die Vergewaltigte zur Strafe für den »Ehebruch« in eine Bärin, die als Sternbild an den Himmel entrückt wird.
Für eine Frau hing die intakte Ehre und damit die Daseinsberechtigung selbst von Männern ab. Ehebrecherinnen konnten von ihren Familien zum Hungertod verurteilt werden, bevor Augustus als Strafe die lebenslängliche Verbannung einführte. Jede Römerin konnte wegen stuprum denunziert und angeklagt werden, auch die Frauen der kaiserlichen Familie. Augustus schickte mit einer solchen Anklage seine Tochter Julia und seine gleichnamige Enkelin in die Verbannung, Caligula seine Schwestern Livilla und die jüngere Agrippina. Claudius verbannte Livilla gar noch ein zweites Mal wegen Ehebruchs. Tiberius hingegen verzichtete auf den Vorwand des Sexualdelikts, als er die ältere Agrippina gefangen setzte. Er ließ seine Stieftochter als Staatsfeindin verurteilen und machte damit deutlich, über wie viel Macht die Frauen der Kaiserdynastie tatsächlich verfügten. Macht, die den herrschenden Männern gefährlich werden konnte.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.