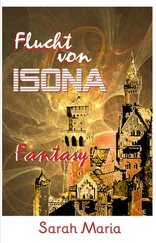Es blieb eine sterbende Hoffnung, die in den letzten Zügen eines ebenso sterbenden Landes öfter enttäuscht denn entflammt worden war. Im Land der Namenlosen existierte kaum Wasser. Unsere Welt war die Wüste. Unsere Pflicht galt den Göttern, die uns gerade eben am Leben erhielten.
Ich war im Staub jener Welt aufgewachsen und kannte kaum mehr als die trostlosen Weiten der Ebenen, die sich vegetationslos in alle Himmelsrichtungen erstreckten – ganz gleich, an welchem Ort man sich aufhalten mochte. Oft hatten meine Augen grünende Oasen in der hitzeflimmernden Luft entdeckt, um kurze Zeit später deren Nicht-Existenz festzustellen und in Träumen an derlei Plätze zu schwelgen. Meine Füße waren nie über Grün gegangen, hatten niemals zuvor glatten Erdboden betreten oder waren am Ufer eines Sees entlanggewatet.
All diese Dinge kannte ich aus Geschichten.
Aus Geschichten, die zu Legenden geworden waren.
In meiner Realität blieben Böden von Rissen durchzogen, als bröckelte die Haut des Landes von seinem Kern. Erde platzte unter den erbarmungslosen Strahlen der Sonne und ließ keinen Raum für das Wachsen von Wurzeln.
Während mein Volk jedoch im Staub der Lande siechte, da hatte sich eine gottlose Gesellschaft der Wüste enthoben und Städte auf der Asche der anderen errichtet. Sie vergaßen die Namen unserer Götter, benannten das Land meiner Väter nach den verschwundenen Geistern und erbauten ihren eigenen Glauben auf den Trümmern des alten.
Die Städter. Die Städter mit ihren neuen Namen und Bauten.
Sie hatten sich selbst die Macht über das Leben verliehen.
Ich ließ meinen Blick über das blaue Himmelsband wandern und richtete meine Augen auf den kuppelförmigen Bauwerkkomplex, der sich am Horizont aus dem Wüstenboden erhob. Die Stadt Gwerdhyll schien den sandwirbelnden Bodenwinden zu entsteigen und über das Leid der Dürre hinauszuwachsen, als wäre sie von den Göttern selbst zu Großem erkoren. Doch hatten nicht die alten Götter die Stadt der Legenden erschaffen. Sie blieb das Zeugnis menschlichen Hochmuts und schmückte sich mit künstlich bewässerten Bäumen.
Die Stadt der Legenden schien kaum selbst mehr als die Illusion einer heilen Welt, als Fata Morgana, die für eine Weile über die Realität hinwegzutäuschen vermochte und doch die Wahrheit nicht vom Land nehmen konnte. Menschengeformte Steinkonstruktionen schmiegten sich zu einem Stadtberg aneinander, formten das Heim eines ganzen Volkes und verkörperten die Distanz zwischen jenen Gottlosen und uns. Ihre künstlichen Anlagen bohrten sich in das Herz unserer Welt und förderten das Wasser in ihre Kanäle, während wir – während mein Reiterstamm, meine Familie, mein Volk – auf trockenem Sandboden hausen musste.
Aus ebendiesem Grunde waren wir verpflichtet, ihr Wasser zu stehlen: Die Städter nahmen sich das Blut unseres Landes, ohne einen Anspruch darauf zu besitzen. Sie nahmen sich, worüber sie nicht verfügten …
Und seither hatte es keinen Regen gegeben.
So blieb es unsere heilige Pflicht, durch die Festungsanlagen jener Städte zu dringen und Wasser aus ihren Brunnen zu nehmen. Mit gefüllten Beuteln beförderten wir das Wasser zu denjenigen, die unsere Götter noch beim Namen zu nennen vermochten, die das Wasser an die Wüste zurückgeben konnten und über ihre Gebete die Erde unseres Landes kurzfristig mit Regen speisten. Die Stammesältesten sämtlicher Reiterstämme entsandten Wasserdiebe in die befestigten Häuser der Städter, um mit dem erbeuteten Gut ihre Rituale zu Ehren der alten Götter zu führen.
Ganz recht. Wir waren nicht allein.
Selbst die Völker feindlichster Gesinnungen sahen ihre Pflicht in der Verteilung des Wassers. Ja, selbst die Westvölker hatten vor wenigen Tagen Tribut geleistet, ein Loch in die Mauer der Legendenstadt gesprengt und auf diese Weise Wasser aus den Brunnen entwendet. Wo wir über Wochen aufgrund veränderter Wachstrukturen ohne Erfolg geblieben waren, hatten sie einen neuen Weg in die Stadt geschaffen und uns Anreiz genug für den nächsten Wasserdiebstahl geliefert.
Und nun? Nun lagen wir in sicherer Entfernung zur Stadt.
Lagen im Gras, warteten auf das Ergebnis des Ablenkungsmanövers unserer Krieger und zerflossen beinahe in der Hitze des immerwährenden Sommers.
Doch wir hatten neuen Mut in der gebrochenen Stadtmauer gefunden. In Trümmern und Teilen schöpften wir neue Hoffnung. Die Hoffnung, nun endlich wieder zu den Stadtbrunnen vordringen und das Wasser für die Rituale stehlen zu können.
»Meine Herren! So sehr ich die Stämme des Westens verabscheuen mag und so sehr mich das weibische Gezanke erheitert … Ich stimme Wassermeister Jharrn in seiner Argumentation vollkommen zu. Womöglich sollten wir das Loch in der Stadtmauer als Geschenk des Schicksals ansehen«, warf ich nun selbst in die Diskussion der Männer ein, um den sinnlosen Tiraden ein Ende zu setzen. »Sollten die Krieger ihre Aufgabe erfüllen, können wir unbemerkt durch die Bruchstelle schlüpfen und uns unter die anderen mischen. Das erscheint mir wesentlich leichter, als falsche Papiere zu besorgen oder über Mauern zu steigen.«
Jedoch sollte ich meine Worte umgehend bereuen, als ich die folgende Handlung bereits im Entstehen erahnte. Anstatt wegen meines Einschreitens erleichtert zu sein, schnellte nun der geballte Zorn jener Männer in meine Richtung und entlud sich auf dem noch weniger beliebten Mitglied der Gruppe.
Auf mir. Ausgerechnet auf mir. Auf der Frau, die nie hätte Wasserdiebin werden dürfen, da die heilige Pflicht doch für gewöhnlich den Männern des Stammes vorbehalten blieb.
»Deine Meinung war nicht gefragt, Nakhara«, grunzte Jharrn, während er seinen Kopf drohend in meine Richtung wandte.
Ein Blick aus dem Augenwinkel. Eine stille Drohung, die in diesem Falle genügte.
So gern ich meinen Dolch in seiner Kehle platzieren und das selbstgefällige Lächeln aus seinem Gesicht schneiden wollte, so gern ich ihm aus Gewohnheit eine bissige Bemerkung gegen die Brust donnern wollte, ich hatte ja doch keine andere Wahl. Wollte ich weiterhin Wasserdiebin unter den gesegneten Mitgliedern des Stammes bleiben, so hatte ich den Worten des Wassermeisters während des Diebstahls Folge zu leisten … und der bevorzugte es zumeist, eine schweigende Frau in den Reihen zu wissen.
Das stechende Blassgrün seiner Augen bohrte sich förmlich durch meine Lederrüstung, schien den improvisierten Panzer von meinem Körper zu schälen und die Haut unter den schützenden Lagen zu versengen. Obwohl ich mit der Hitze unseres Hauptsterns seit Jahren gut Freund war, so konnte ich doch das Gefühl der unerträglichen Temperaturen unter den Blicken des Meisters nicht leugnen.
Jharrn fuhr sich mit seinen erdverkrusteten Fingern unter der Nase entlang, sodass sich die braunen Schnörkel seiner Körperbemalung in skurrile Formen dehnten und den Titel des Meisters beinahe bis zur Unleserlichkeit verformten. Mit gespitzten Lippen spuckte er auf den Boden.
Eine deutliche Geste, mich nicht an weitere Worte zu wagen.
Wider Willen senkte ich das Haupt zu einer Geste der Demut und konzentrierte mich auf die glitzernden Spuckefäden am Boden, die rasch mit der Wüstenerde zu verwachsen begannen. Der Sand schluckte das Nass in gierigen Zügen, sodass sich der benetzte Flächenabschnitt innerhalb kürzester Zeit in einen klebrigen Klumpen verwandelte und dunkel vom Rest des Bodens abgrenzte.
Jharrn hatte gesprochen.
Noch hatte ich mir unter den Wasserdieben keinen Respekt erworben, sodass ich mir in ebendiesen Momenten Widerworte hätte erlauben oder mich gar dem Meister widersetzen dürfen, ohne den kostbaren Posten an den nächstbesten Mann in der Reihe der Jungen zu geben. Mit den Fäusten krallte ich mich in die nahegelegenen Wüstengrasbüschel, zwang mich zu kontrollierten Atemzügen und hielt den aufsteigenden Zorn in Schach. Nein, Jharrns Respektlosigkeit sollte mich nicht meiner Stellung entheben, hatte ich doch jenen Platz unter den Herren mit all meinem Herzblut und Schweiß erstritten!
Читать дальше