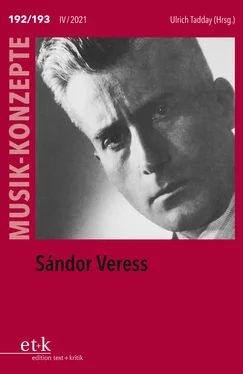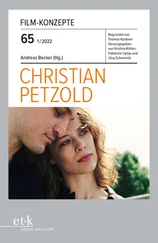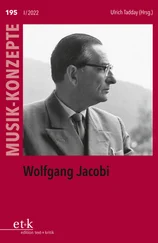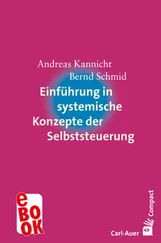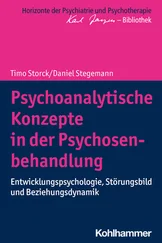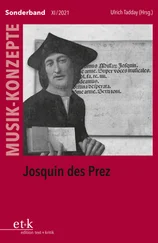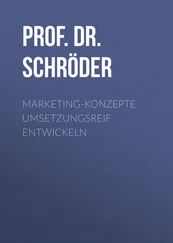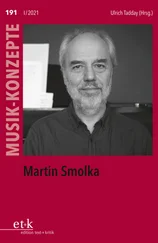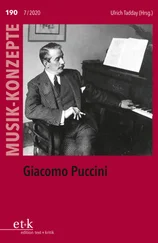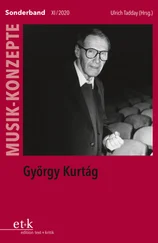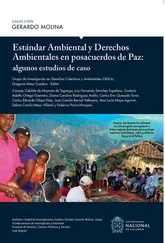Dennoch lässt sich aus einem direkten Vergleich der Spezifika von Wegleitung und Konfession recht gut erschließen, worin vermutlich das wichtigste Element eines Überzeugungskerns Veress’ in Bezug auf die MKP der Stunde Null bestand:
»Ich unternahm zahlreiche Volksmusik-Sammelreisen in ungarische und rumänische Dörfer, und diese Reisen und Studien brachten mich sehr nahe an die sozialen Probleme der Bauern, mit der unvermeidlichen Konsequenz, dass ich in engen Kontakt mit jenen demokratischen Jugendbewegungen (allgemein ›Dorfforscher‹ genannt) kam, die für die Rechte der Bauern und für eine demokratische Landreform kämpften.« 51
Als erfahrener »Dorfforscher« 52wusste Veress aus konkretester Anschauung um das dringende, seit Ende des Ersten Weltkriegs systematisch verschleppte Desiderat, in den vom drastischen Klassengegensatz zwischen adligem bzw. kirchlichem Großgrundbesitz auf der einen, Kleinbauerntum und Agrarproletariat auf der anderen Seite geprägten Dörfern endlich für mehr Verteilungs- und soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Und es waren in der Tat just die beiden Parteien am linken Rand des Koalitionsspektrums der provisorischen Übergangsregierung, die diese Aufgabe im März 1945 programmatisch-federführend und energisch an die Hand nahmen: die Nationale Bauernpartei NPP und die MKP mit ihrem Landwirtschaftsminister Imre Nagy, dem späteren Ministerpräsidenten des 1956er Aufstands, dem der Komponist noch 1983 ein berührendes Epitaph in Gestalt eines Memento für Bratsche und Kontrabass setzen sollte. 53Ganz im Sinne dieser Faktenlage weist Veress in einem weiteren, erst kürzlich ans Licht gekommenen Rechtfertigungsdokument aus dem ersten Schweizer Jahr – einem Brief an Paul Sacher, damals Präsident des Schweizerischen Tonkünstlervereins (STV) – auf die generelle Beweger-Rolle der MKP hin:
»Die politische Lage war (…) damals in Ungarn eine solche, dass die vier Parteien, die Kleinlandgutbesitzerpartei (= Kleinlandwirtepartei, Anm. CV), die Sozialdemokraten, die Bauernpartei und die Kommunisten, eine vollkommen ausgeglichene Koalition formten, die als eine Einheit für das einzige, grosse Ziel: die Rekonstruktion des Landes und des Lebens, arbeitete. In dieser Koalition war damals die kommunistische Partei eine kleine Minderheit, zugleich spielte sie aber die Rolle eines Motors, und war eigentlich nichts anderes als eine demokratische, progressive Reformpartei.« 54
Das »Motor«-Argument ist wichtig, liefert es doch einen Ansatz zur Beantwortung der Frage: Warum ausgerechnet die MKP, wenn sich die vier großen Parteien doch eigentlich in der Identifikation und Bewertung der grundlegenden Desiderate der politischen Stunde vollkommen einig waren? – Interessanterweise fehlt es in der fünf Jahre später niedergeschriebenen Endfassung der Konfession: Dort wird, im Gegenteil, die Nichtunterscheidbarkeit der Parteiprogramme und daher der Zufallscharakter der Entscheidung für die MKP akzentuiert – ganz im Sinne der von Borsody adressatenbezogen insinuierten Tendenz, die Motive des Parteibeitritts möglichst gründlich zu entkernen.
Wie auch immer man die verwickelte Quellenlage zu diesem Komplex behandelt – eines lässt sich mit Bestimmtheit sagen: Veress hat als Komponist weder vorher noch nachher so ausgeprägt politisch komponiert wie zwischen 1945 und 1949. 55
Wann genau die politischen Hoffnungen des Frühjahrs 1945 so brüchig wurden, dass die Emigration zur ernsthaft verfolgten ultima ratio wurde, lässt sich angesichts der bislang dünnen Quellenlage zum Jahr 1946 nicht sagen. 57Klar ist, dass der 1948 so zielstrebig gefasste Plan einer Amerika-Emigration bereits die Folge einer tiefgreifenden politischen Evidenzkrise war, die bei Sándor und Enid Veress schon mehr als ein Jahr zuvor eingetreten sein muss. Der gut acht Monate dauernde England-Aufenthalt des Jahres 1947 belegt dies hinreichend. Ermöglicht durch ein Sechs-Wochen-Besuchsstipendium des British Council, auf das sich Veress schon im Sommer 1946 beworben hatte 58, wurde die Reise Mitte Februar – zunächst durch Veress allein – im festen Vorsatz angetreten, die knapp bemessene Zeit, anknüpfend an Vorkriegs-Kontakte, zu einer Stabilisierung in London zu nützen, seine Frau nachzuholen und in jedem Fall, mindestens, deutlich auf Distanz zu Budapest zu gehen. 59
Die ersten Wochen zeitigten Ermutigendes: Kontakte zur BBC, insbesondere zu den Dirigenten Adrian Boult und Stanford Robinson, die Konzertprojekte für den Herbst anstießen, aber auch Aufnahmetermine als Interpret eigener Werke – der 20 Klavierstücke (1938) und der Klaviersonatine (1932) –, den Beginn der Freundschaft mit Gwynn Williams, Mitinspirator und künstlerischer Leiter des 1947 erstmals durchgeführten Llangollen International Musical Eistedfodd , an dem Veress von 1948 bis 1984 mit ganz wenigen Ausnahmen jährlich in der zweiten Juliwoche als Juror der Chorwettbewerbe amten sollte. Die seit 1939 in der Schwebe befindliche Verbindung zu Boosey & Hawkes hingegen wurde 1947 formell beendet. 60
Trotz dieser Ansätze musste Veress realistischerweise bis Mitte März damit rechnen, innert Monatsfrist wieder zurück in Budapest zu sein (»danach verlasse ich England, es sei denn, inzwischen geschieht etwas – was ich mir in der Tat erhoffe« 61). Das erhoffe Ereignis in between, das niemand voraussehen konnte, trat aber tatsächlich zuhause am 14. März mit dem Ausscheiden des der NPP angehörenden Religions- und Unterrichtsministers Dezső Keresztury, seines Zeichens Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und enger Vertrauter Kodálys, aus der Regierung des Ministerpräsidenten Ferenc Nagy ein. 62Sein Nachfolger wurde der Ethnograf Gyula Ortutay, ein Vertreter des linken Flügels der Kleinlandwirtepartei und mit Veress seit spätestens Ende der Dreißigerjahre gut bekannt. 63Dieser sah seinen Kairos gekommen und unterbreitete dem frischgebackenen Minister mit Datum des 28. März den Vorschlag der Schaffung einer Musik-Attaché-Funktion ad personam an der ungarischen Vertretung in London:
»Seit ’38 erkläre ich zuhause, dass nichts so wichtig für das geistige Ungarn ist wie die Nutzbarmachung der Gegebenheiten, die eine internationale Anerkennung und das Gewicht der neuen ungarischen Musik in sich bergen. Nun ist der richtige Moment da, und es wäre – wie oben erwähnt – ein großer Fehler, ihn zu versäumen. Es ist ja nicht sicher, dass eine solche Konstellation noch einmal entsteht. Nun treffen nämlich Nachfrage und Angebot, unsere internationale Position, die auf uns gerichtete Aufmerksamkeit, das gesunde Kunstleben zuhause, viele neue Initiativen, die geeigneten Leute auf den entsprechenden Posten, das hiesige hungrige Interesse sowie resonanzfähige Führungskräfte zusammen. Du bist frisch und flexibel genug, all das zu erkennen. So frage ich Dich also, ob Du mir einen Auftrag für ein, zwei Jahre erteilen kannst, um hier einen Posten aufzubauen und zu halten. Die glückliche Konstellation ist auch bei mir gegeben, weil man bereits vor 12 Jahren von mir gehört hat und meine Kontakte noch bestehen und freundschaftlich geblieben sind. Und sie sind überdies, das ist wichtig, langsam, allmählich und nicht mit propagandistischem Ziel aufgebaut worden. Das heißt auch, sie sind aufrichtig und überzeugend. Ungeschickte ›professionelle‹ Kulturattachés verrichten nirgendwo solche Arbeit. Ich weiß durchaus, dass meine Tätigkeit auch zuhause benötigt wird. Ich selbst sollte daheim auch hunderte Sachen erledigen. Doch habe ich das Gefühl, infolge der skizzierten glücklichen Sternpositionen, dass ich jetzt und hier mehr für Ungarn tun kann als zuhause, wo letztlich meine Stellvertreter die akademische Arbeit genauso gut (wie ich) verrichten, während diese, hier, an meine Person gebunden ist. Denn, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.« 64
Читать дальше