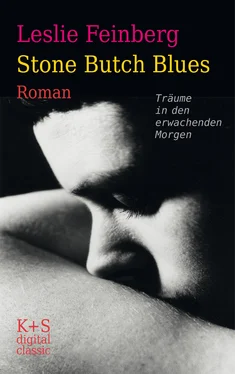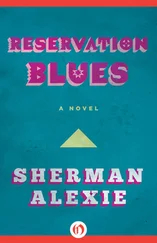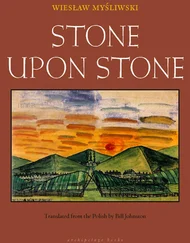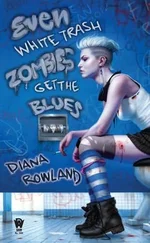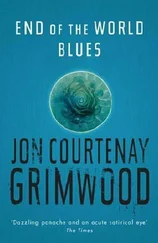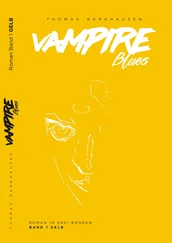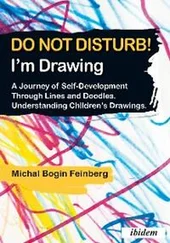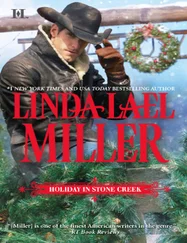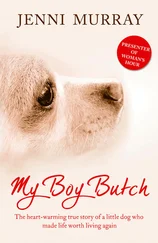Als wir an jenem Tag beim Abendbrot saßen, lachte meine Mutter über mich.
„Du hast letzte Nacht im Schlaf geredet wie ein Marsmensch.“
Ich knallte meine Gabel auf den Tisch. „Es ist keine Marssprache!“
„Junges Fräulein!“ schnauzte mein Vater mich an. „Geh auf dein Zimmer!“
Als ich in der Schule den Gang hinunterging, quiekten ein paar Mädchen, als ich an ihnen vorbeikam: „Ist das ’n Tier, ’n Mineral oder ’ne Pflanze?“ Ich paßte in keine ihrer Schubladen.
Ich hatte ein neues Geheimnis, und es war so schrecklich, daß ich es nie jemandem würde erzählen können. Ich entdeckte es eines Tages im Colvin-Kino. Es war an einem Samstag. Ich blieb nach der Nachmittagsvorstellung lange Zeit auf der Toilette. Ich mochte noch nicht nach Hause gehen. Als ich schließlich rauskam, lief gerade der Erwachsenenfilm. Ich schlich mich hinein und sah zu. Ich schmolz dahin, als Sophia Loren sich an ihren Helden preßte. Ihre Hand umfaßte seinen Nacken, als sie sich küßten; ihre langen roten Fingernägel strichen über seine Haut. Ein genüßlicher Schauer überkam mich.
Von da an versteckte ich mich jeden Samstag nach der Nachmittagsvorstellung auf dem Klo, damit ich anschließend die Erwachsenenfilme sehen konnte. Ein neuer Hunger nagte an mir. Er machte mir angst, aber ich hütete mich, mich irgend jemandem anzuvertrauen.
Ich ertrank in meiner Einsamkeit.
Eines Tages gab unsere Englischlehrerin, Mrs. Noble, uns eine Hausaufgabe: Bringt acht bis zehn Zeilen von eurem Lieblingsgedicht mit und lest sie der Klasse vor. Einige maulten und stöhnten, sie hätten kein Lieblingsgedicht, und das sei ja „ö-de“ . Doch ich geriet in Panik. Wenn ich ein Gedicht las, das mir gefiel, würde ich mich verwundbar machen und mich der Klasse ausliefern. Andererseits, Gedichtzeilen vorzulesen, die mir nichts bedeuteten, schien mir wie Selbstverrat.
Als ich am nächsten Tag an der Reihe war, nahm ich mein Mathebuch mit nach vorn. Zu Beginn des Halbjahres hatte ich aus einer braunen Obsttüte einen Schutzumschlag für das Buch gemacht und ein Gedicht von Poe auf die Innenklappe geschrieben.
Ich räusperte mich und sah Mrs. Noble an. Sie lächelte und nickte mir zu. Ich las die ersten Zeilen vor:
Anders seit meiner Kindheit Jahren
Bin ich, als andre sind und waren ,
Um andres, als andre thaten, mich müht’ ich
Von andern Leidenschaften glüht’ ich .
Nicht floß mein Gram aus denselben Quellen ,
Dieselbe Freude ließ nicht zu schnellen
Empfindungen das Herz mir schwellen .
Allein war ich in Freude wie in Pein ,
Und was ich liebte, das liebt’ ich allein .
Ich versuchte, die Worte in einem tonlosen Singsang zu lesen, damit meine Mitschülerinnen und Mitschüler nicht merkten, wie viel mir dieses Gedicht bedeutete, aber ihre Augen waren ohnehin stumpf vor Langeweile. Ich senkte den Blick und kehrte an meinen Platz zurück. Mrs. Noble drückte mir den Arm, als ich an ihr vorbeiging, und als ich aufblickte, sah ich Tränen in ihren Augen. Sie sah mich auf eine Weise an, daß ich beinahe auch geweint hätte. Es war, als sähe sie mich wirklich, und in ihrem Blick lag keine Kritik.
Die Welt war in Aufruhr, aber meinem Leben war nichts davon anzumerken. Ich erfuhr von der Bürgerrechtsbewegung nur aus den Heften der Zeitschrift Life , die wir abonniert hatten. Ich war jede Woche die erste in der Familie, die die neue Ausgabe las.
Ein Bild, das sich meinem Gedächtnis eingeprägt hat, ist das Foto von zwei Trinkwasserquellen mit den Aufschriften „Farbige“ und „Weiße“. Auf anderen Fotos sah ich, wie mutige Menschen – dunkelhäutige wie hellhäutige – versuchten, das zu ändern. Ich las ihre Transparente. Ich sah, wie sie in Restaurants blutig geschlagen wurden und in Birmingham stahlbewehrten Streitkräften gegenüberstanden. Ich sah, wie Wasserwerfer und Polizeihunde ihnen die Kleider vom Leib rissen. Ich fragte mich, ob ich jemals so mutig sein könnte.
Ich sah ein Foto aus Washington, D.C., auf dem sich mehr Leute, als ich mir jemals hätte vorstellen können, an einem Ort versammelt hatten. Martin Luther King erzählte ihnen von seinem Traum. Ich wünschte mir, dazugehören zu können.
Ich beobachtete die Mienen meiner Eltern, als sie unbewegt dieselben Zeitschriften lasen wie ich. Sie sagten nie ein Wort dazu. Die Welt stand Kopf, und sie blätterten die Seiten in aller Ruhe durch wie einen Versandhauskatalog.
„Ich würde gern an einem Freedom Ride durch die Südstaaten teilnehmen“, sagte ich eines Tages beim Abendessen. Ich sah, wie meine Eltern sich eine Reihe komplizierter Blicke zuwarfen. Schweigend aßen sie weiter.
Dann legte mein Vater seine Gabel auf den Tisch. „Damit haben wir nichts zu tun“, sagte er und schloß damit das Thema ab.
Meine Mutter blickte von ihm zu mir und wieder zurück. Ich merkte, daß sie den bevorstehenden Ausbruch um jeden Preis verhindern wollte. Sie lächelte. „Wißt ihr, was ich mich frage?“
Wir wandten uns ihr zu. „Ihr kennt doch das Lied von Peter, Paul, and Mary – ‚The answer, my friend, is blowing in the wind’?“ Ich nickte gespannt.
„Ich verstehe nicht, was man davon hat, in den Wind zu blasen.“ Meine Eltern brachen in schallendes Gelächter aus.
Mit fünfzehn nahm ich neben der Schule einen Job an. Ich mußte den Therapeuten davon überzeugen, daß das gut für mich war, damit meine Eltern ihre Einwilligung gaben. Ich überzeugte ihn. Damit änderte sich alles.
Ich arbeitete als Handsetzerin in einer Druckerei. Ich hatte Barbara, einer meiner wenigen Freundinnen in meiner Klasse, gesagt, daß ich sterben würde, wenn ich keine Arbeit fände, und ihre große Schwester beschaffte mir diesen Job, indem sie log und schwor, ich sei sechzehn.
Auf der Arbeit kümmerte sich kein Mensch darum, ob ich Jeans und T-Shirts trug. Sie zahlten bar am Ende jeder Woche, und meine Kolleginnen und Kollegen waren nett zu mir. Sie merkten sehr wohl, daß ich anders war, schienen sich jedoch nicht soviel daraus zu machen wie meine Mitschülerinnen und Mitschüler. Sie fragten mich nach der Schule und erzählten mir, wie es war, als sie selbst noch zur Schule gingen. Als Jugendliche denkst du nie daran, daß Erwachsene auch mal jung gewesen sind, wenn sie dich nicht daran erinnern.
Eines Tages fragte ein Drucker aus einer anderen Abteilung Eddie, meinen Vorarbeiter: „Wer ist denn diese Butch?“ Eddie lachte nur, und sie gingen weg und redeten weiter. Die beiden Frauen, die rechts und links von mir arbeiteten, warfen mir einen Blick zu, um zu sehen, ob ich verletzt war. Ich war eher verwirrt.
An dem Abend setzte sich meine Freundin Gloria in der Pause zum Essen neben mich. Aus heiterem Himmel erzählte sie mir von ihrem Bruder – daß er schwul sei und Frauenkleider trage, sie ihn aber trotzdem liebe und sich darüber ärgere, wie die Leute ihn behandelten, denn schließlich könne er ja nichts dafür, daß er so sei. Einmal sei sie sogar mit ihm in eine Bar gegangen, wo er seine Freunde traf. Lauter Mannweiber hätten sie da angemacht. Sie schauderte, als sie das sagte.
„Wo war das denn?“ fragte ich.
„Was?“ Sie sah aus, als täte es ihr leid, davon angefangen zu haben.
„Wo ist denn diese Bar, wo solche Leute sind?“
Gloria seufzte.
„Bitte.“ Meine Stimme zitterte.
Sie sah sich um, bevor sie antwortete. „In Niagara Falls“, flüsterte sie. „Warum willst du das wissen?“
Ich zuckte die Achseln. „Wie heißt sie?“ Ich versuchte, ganz beiläufig zu klingen.
Gloria seufzte tief. „Tifka’s.“
Fast ein ganzes Jahr verging, bevor ich den Mut aufbrachte, mich bei der Auskunft nach der Adresse von Tifka’s zu erkundigen. Schließlich stand ich vor der Bar, zitternd vor Angst. Ich fragte mich, wieso ich dachte, dies könnte ein Ort sein, wo ich hinpaßte. Und wenn es nicht so war?
Читать дальше