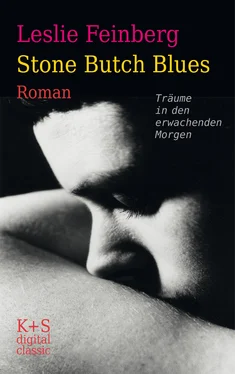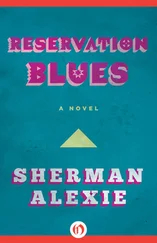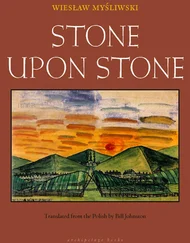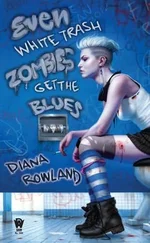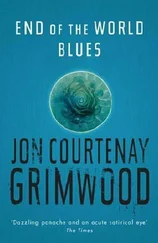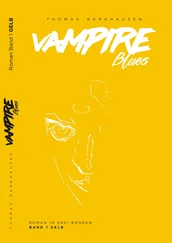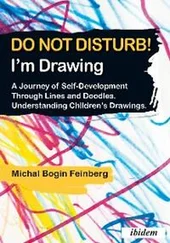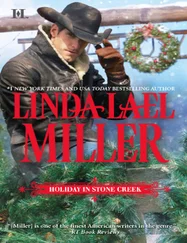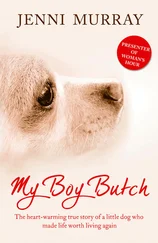Den Rest des Tages spielten wir zusammen Tischtennis. Paula brachte mir den Text von „Are you lonesome tonight?“ bei. Sie lachte und klatschte, als ich meine Stimme tief klingen ließ wie die von Elvis. „Du mußt Rechauds und Mokassins machen“, riet Paula mir. „Und zwar ’ne Menge. Je mehr, je besser. Das finden sie gut.“ Ich wußte nicht, was ein Rechaud war.
In dieser Nacht konnte ich nicht einschlafen. Ich hörte flüsternde und lachende Männerstimmen in meinem Zimmer. Ein Reißverschluß wurde aufgezogen. Uringeruch stieg mir in die Nase. Noch mehr Lachen, und dann entfernten sich die Schritte. Mein Bettzeug war durchnäßt. Ich hatte Angst, daß man mir die Schuld geben und mich bestrafen würde. Wer hatte das getan, und warum? Ich mußte Paula fragen.
Das Licht jenseits der vergitterten Fenster war noch grau, als die Schwestern und Pfleger in unser Zimmer kamen. „Aufstehen, aufstehen!“ riefen sie.
Die alte Frau fing mit ihrem Gerufe an.
Paula wehrte sich gegen die Pfleger, biß sie in die Hände. Sie fluchten, schnallten sie fest und rollten sie aus dem Zimmer.
Eine Schwester kam an mein Bett. Ich konnte immer noch den schwachen Uringeruch auf meinem Bettzeug wahrnehmen, obwohl es schon wieder trocken war. Würde sie mich wegbringen, wenn sie es auch roch? Sie blätterte in ihren Unterlagen. „Goldberg, Jess.“ Es machte mir angst, sie meinen Namen aussprechen zu hören. „Für die hier habe ich keine Unterschrift“, sagte sie zu den Pflegern. Sie gingen alle aus dem Zimmer.
„Goldberg, Jess“, rief die alte Frau immer wieder.
Nach dem Mittagessen schlüpfte ich zurück in unser Zimmer, um mein Jo-Jo zu holen. Paula saß auf ihrem Bett und starrte ihre Pantoffeln an. Sie blickte auf und legte den Kopf schief. Sie streckte die Hand aus. „Ich heiße Paula“, sagte sie. „Nett, dich kennenzulernen.“
Eine Schwester kam herein. „Du da“, sagte sie und zeigte auf mich. Ich folgte ihr zum Schwesternzimmer. Sie hielt mir zwei Pappbecher hin. In dem einen rollten Tabletten in den schönsten Farben herum, in dem anderen war Wasser. Ich starrte die beiden Becher an.
„Nimm sie!“ befahl die Schwester. „Mach’s mir nicht so schwer.“ Ich ahnte schon, daß ich vielleicht nie hier rauskommen würde, wenn ich es dem Klinikpersonal schwermachte, also nahm ich die Tabletten. Schon bald, nachdem ich sie geschluckt hatte, wurde der Fußboden schief, und ich hatte das Gefühl, als ginge ich durch Klebstoff.
Ich stellte täglich mehr Rechauds und Mokassins her. Und ich begann mich mit einer Frau verbunden zu fühlen, die mit Geistern sprach, die ich nicht sehen konnte.
In der Patientenbücherei entdeckte ich eine Lyrikanthologie – sie veränderte mein Leben. Ich las die Gedichte wieder und wieder, bis ich allmählich begriff, was sie bedeuteten. Nicht nur, daß die Worte wie Noten waren, die meine Augen singen konnten – es war auch die Entdeckung, daß Frauen und Männer, die schon lange tot waren, mir Botschaften über ihre Gefühle hinterlassen hatten, Emotionen, die ich mit meinen eigenen vergleichen konnte. Endlich hatte ich andere gefunden, die genauso einsam waren wie ich. Dieses Wissen tröstete mich.
Drei Wochen, nachdem ich eingeliefert worden war, brachte mich eine Schwester in ein Büro. Ein Mann mit Bart saß hinter einem großen Schreibtisch und rauchte Pfeife. Er sagte mir, er sei mein Arzt. Er sagte, daß ich Fortschritte zu machen schiene, daß es schwer sei, jung zu sein, und daß ich gerade eine schwierige Phase durchmachte.
„Weißt du, warum du hier bist?“ fragte er mich.
Ich hatte in den drei Wochen eine Menge gelernt. Mir war klar geworden, daß die Welt viel mehr konnte, als nur über mich zu richten – sie hatte enorme Macht über mich. Es war mir gleichgültig geworden, daß meine Eltern mich nicht liebten. Ich hatte diese Tatsache in den drei Wochen, die ich in diesem Krankenhaus allein überlebt hatte, akzeptiert. Es machte mir nichts mehr aus. Ich haßte sie. Und ich traute ihnen nicht. Ich traute niemandem. Ich hatte nur noch meine Flucht im Kopf. Ich wollte hier rauskommen und von zu Hause weglaufen.
Ich erzählte dem Arzt, daß ich vor den männlichen Patienten auf der Station Angst hätte. Ich sagte, ich wüßte, daß meine Eltern enttäuscht von mir wären, ich in Zukunft jedoch alles tun würde, damit sie stolz auf mich sein könnten. Ich sagte ihm, daß ich nicht wüßte, was ich falsch machte, aber wenn ich nur nach Hause könnte, würde ich tun, was er mir sagte. Ich meinte es nicht, aber ich sagte es. Er nickte, aber er schien sich mehr dafür zu interessieren, daß seine Pfeife nicht ausging, als für mich.
Zwei Tage später erschienen meine Eltern auf der Station und holten mich nach Hause. Wir redeten nicht über das, was geschehen war. Meine Gedanken kreisten um meine Flucht; ich wartete nur auf den richtigen Moment. Doch zunächst mußte ich mich bereit erklären, einmal in der Woche zur Therapie zu gehen. Ich hoffte, daß die Therapie nicht lange dauern würde, aber sie dauerte mehrere Jahre.
Ich weiß noch genau, an welchem Tag es war, als der Seelenklempner die Bombe platzen ließ: Meine Eltern und er waren übereingekommen, daß ein Benimmkurs mir helfen würde. Das Datum ist in meinem Kopf eingebrannt. Der 23. November 1963. Wie betäubt verließ ich sein Büro. Diese Erniedrigung schien mehr, als ich ertragen konnte. Wenn ich eine schmerzlose Methode gewußt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich umgebracht.
Als ich nach Hause kam, hatten meine Eltern den Fernseher laut gestellt, und eine Nachrichtensprecherin berichtete, daß der Präsident in Dallas erschossen worden war. Es war das erste Mal, daß ich meinen Vater weinen sah. Die ganze Welt war aus den Fugen geraten. Ich schloß meine Zimmertür hinter mir und flüchtete mich in den Schlaf.
Ich hatte nicht geglaubt, daß ich es überleben würde, in dem Benimmkurs meine beschämende Andersartigkeit in aller Öffentlichkeit vorzuführen. Aber irgendwie bin ich durchgekommen. Jedesmal, wenn ich mich vor der ganzen Klasse auf dem Laufsteg drehen mußte, wieder und wieder, war mein Gesicht knallrot vor Demütigung und Wut.
Der Benimmkurs brachte mir ein für allemal bei, daß ich nicht hübsch und feminin war und niemals anmutig sein würde. Der Wahlspruch der Schule lautete: Jedes Mädchen, das zu uns kommt, verläßt uns als Dame. Ich war die Ausnahme.
Gerade als ich dachte, schlimmer könnte es nicht mehr kommen, stellte ich fest, daß mir Brüste wuchsen. Die Menstruation machte mir nichts aus. Wenn die Blutung nicht gerade unvermutet einsetzte, war es eine private Angelegenheit zwischen mir und meinem Körper. Aber Brüste! Jungs lehnten sich aus Autofenstern und schrien mir unanständige Sprüche nach. Mr. Singer vom Drugstore starrte auf meine Brüste, während er meine Süßigkeiten eintippte. Ich trat aus der Volleyball- und der Leichtathletikmannschaft aus, weil mir die Brüste beim Springen oder Laufen weh taten. Mir gefiel mein Körper so, wie er vor der Pubertät gewesen war. Irgendwie hatte ich gedacht, er würde sich nie ändern, jedenfalls nicht so!
Schließlich kam ich an einen Punkt, wo ich fand, daß all die Leute, die mich abartig fanden, recht hatten. Schuldgefühle brannten wie Säure in meiner Kehle. Sie ließen nur nach, wenn ich in das Land-das-mich-so-nimmt-wie-ich-bin zurückkehrte. So kam es, daß ich mich wieder an die Wüste erinnerte.
Eines Nachts besuchte mich im Traum eine Dineh-Frau. Sie war früher jede Nacht zu mir gekommen, aber seit ich in der Psychiatrie gewesen war nicht mehr. Sie nahm mich auf den Schoß und forderte mich auf, meine Vorfahren zu suchen und stolz auf mich zu sein. Und an den Ring zu denken.
Als ich aufwachte, war es draußen noch dunkel. Ich kauerte mich ans Fußende des Bettes und lauschte auf den stürmischen Regen. Blitze erhellten den Nachthimmel. Ich wartete, bis meine Eltern zur Arbeit gegangen waren, dann schlich ich in ihr Schlafzimmer und holte den Ring. In der Schule versteckte ich mich in einer Klokabine, betrachtete den Ring und fragte mich, was er wohl zu bewirken vermochte. Wann würde seine Macht beschützen? Wahrscheinlich war es wie beim Captain Midnight Decoder Ring – du mußtest selbst rauskriegen, wie er funktionierte.
Читать дальше