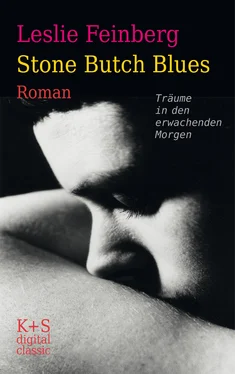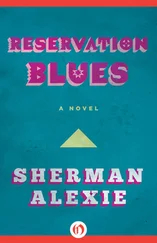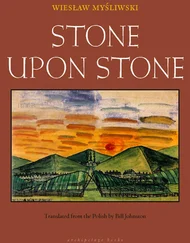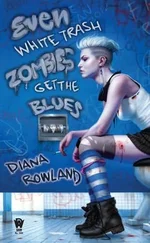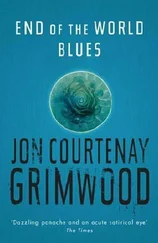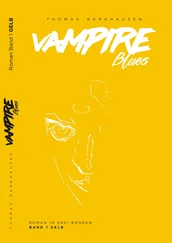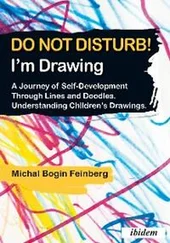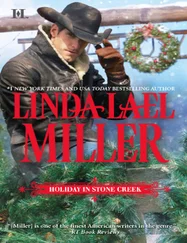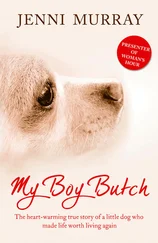Jahre später stritten sich die Väter immer noch über den Streik, am Küchentisch und am Gartengrill. Ich bekam dabei so blutrünstige Beschreibungen von Streikkämpfen mit, daß ich dachte, der Zweite Weltkrieg wäre in der Fabrik ausgetragen worden. Nachts, wenn wir meinen Vater zu seiner Schicht fuhren, hockte ich auf dem Rücksitz des Autos und spähte hinaus, an den Fabriktoren vorbei über das mittlerweile so ruhige Schlachtfeld.
Wir hatten auch Banden in der Siedlung, und die Kinder, deren Eltern Streikbrecher gewesen waren, bildeten eine kleine, aber gefürchtete Truppe. „He, Schwuli! Bist du ’n Junge oder ’n Mädchen?“ In der kleinen Welt der Siedlung gab es keine Möglichkeit, ihnen auszuweichen. Ihre Hänseleien verfolgten mich noch, wenn ich schon längst an ihnen vorbei war.
Die Welt sprang hart mit mir um, und so wurde ich zur Einzelgängerin – oder wurde dazu gemacht.
Die Hauptstraße machte einen Schnitt zwischen unserer Siedlung und einem riesigen Feld. Es war mir verboten, diese Straße zu überqueren. Viel Verkehr gab es nicht. Ich hätte schon ziemlich lange mitten auf der Fahrbahn stehen müssen, um überfahren zu werden. Aber ich durfte diese Straße nicht überqueren. Ich tat es trotzdem, und niemand schien es zu merken.
Ich schlug mich durch das lange braune Gras, das die Straße begrenzte, und war in meiner eigenen Welt.
Auf dem Weg zum Teich hielt ich an, um die Hunde in den Außenzwingern an der Rückseite des Tierheims zu besuchen. Sie bellten und stellten sich auf die Hinterbeine, wenn ich an den Zaun kam. „Pst!“ warnte ich sie, denn der Zutritt war verboten.
Ein Spaniel drückte seine Nase durch den Maschendrahtzaun. Ich kraulte ihm den Kopf. Ich sah mich nach dem Terrier um, den ich so liebte. Er war nur einmal an den Zaun gekommen, um mich zu begrüßen, und hatte vorsichtig geschnuppert. Normalerweise lag er mit dem Kopf auf den Pfoten da, so sehr ich ihn auch lockte, und sah mich mit kummervollen Augen an. Ich hätte ihn so gern mit nach Hause genommen.
„Bist du ein Junge oder ein Mädchen?“ fragte ich den Spaniel.
„Wuff, wuff!“
Den Mann vom Tierschutzverein sah ich erst, als es schon zu spät war. „He, Kleiner. Was machst ’n da?“
Erwischt. „Nichts“, sagte ich. „Ich hab nichts Schlimmes getan. Nur mit den Hunden geredet.“
Er lächelte ein wenig. „Steck nicht die Finger durch den Zaun, Kleiner. Manche beißen auch.“
Ich fühlte, wie meine Ohren zu glühen anfingen. Ich nickte. „Ich suche den Kleinen mit den schwarzen Ohren. Ist er zu einer netten Familie gekommen?“
Der Mann runzelte die Stirn. „Ja“, sagte er leise. „Er ist jetzt richtig glücklich.“
Ich rannte zum Teich hinüber, um mit einem Glas Kaulquappen zu fangen. Ich stützte mich auf die Ellbogen und besah mir die kleinen Frösche, die auf die sonnendurchglühten Steine kletterten.
„Krah, krah!“ Eine riesige schwarze Krähe kreiste in der Luft über mir und landete auf einem Felsen in der Nähe. Wir betrachteten einander schweigend.
„Krähe, bist du ’n Junge oder ’n Mädchen?“
„Krah, krah!“
Ich lachte und rollte mich auf den Rücken. Der Himmel war kreideblau. Ich tat so, als läge ich auf den weißen Wattewolken. Die Erde an meinem Rücken war feucht. Die Sonne brannte heiß, die Brise kühlte mich. Ich war glücklich. Die Natur hielt mich ganz fest und hatte anscheinend nichts an mir auszusetzen.
Auf dem Rückweg traf ich auf die Bande der Streikbrecherjungen. Sie hatten einen unverschlossenen Lastwagen gefunden, der an einer Steigung geparkt war. Ein älterer Junge hatte die Handbremse gelöst und zwang zwei kleinere Jungen von meiner Seite der Siedlung, vor dem rollenden Laster herzulaufen.
„Jessy, Jessy!“ riefen sie herausfordernd und stürmten auf mich zu.
„Brian sagt, du wärst ’n Mädchen, aber ich denke, du bist bloß ’ne Memme“, sagte einer.
Ich schwieg.
„Was bist du denn nun?“ hänselte er.
Ich schlug die Arme wie Flügel. „Krah, krah!“ machte ich und lachte.
Einer der Jungs schlug mir das Glas mit den Kaulquappen aus der Hand, und es zersprang auf dem Kies. Ich trat und biß sie, aber sie hielten mich fest und banden mir die Hände mit einem Stück Wäscheleine auf den Rücken.
„Wollen mal sehn, wie du pinkelst“, sagte einer, stieß mich zu Boden, und zwei andere rissen mir die Hose und die Unterhose runter. Ich war starr vor Schreck. Ich konnte nichts gegen sie ausrichten. Ich schämte mich so, halbnackt vor ihnen zu hocken, daß mich alle Kraft verließ.
Sie stießen und schleiften mich zum Haus der alten Mrs. Jefferson und sperrten mich in die Kohlenkiste. Es war dunkel da drin. Die Kohle war hart und hatte messerscharfe Kanten. Stilliegen tat weh, aber je mehr ich mich bewegte, um so schlimmer wurden die Schnitte. Ich hatte Angst, da nie wieder rauszukommen.
Es dauerte Stunden, bis ich Mrs. Jefferson in der Küche hörte. Ich weiß nicht, was sie dachte, als sie das Gepolter in ihrer Kohlenkiste bemerkte. Doch als sie dann die kleine Klappe aufmachte und ich mühsam rauskroch, sah sie aus, als wollte sie vor Angst tot umfallen. Da stand ich in ihrer Küche, ruß- und blutverschmiert, gefesselt und halbnackt. Sie fluchte halblaut vor sich hin, während sie mich losband und mich in ein Handtuch gewickelt nach Hause schickte.
Meine Eltern waren stinksauer, als sie mich sahen. Ich habe nie verstanden wieso. Mein Vater ohrfeigte mich immer wieder, bis meine Mutter ihm in den Arm fiel und ihm etwas zuflüsterte.
Eine Woche später fiel mir einer aus der Streikbrecherbande in die Hände. Er hatte den Fehler begangen, allein in der Nähe unseres Hauses herumzulaufen. Ich zeigte ihm meinen Bizeps und forderte ihn auf, mal zu fühlen. Dann boxte ich ihn ins Gesicht. Er rannte heulend weg. Zum ersten Mal seit Tagen fühlte ich mich richtig gut.
Meine Mutter rief mich zum Abendessen rein. „Wer war denn der Junge, mit dem du da gespielt hast?“
Ich zuckte die Achseln.
„Hast du ihm deine Muskeln gezeigt?“
Ich erstarrte und fragte mich, wieviel sie wohl gesehen hatte.
Sie lächelte. „Manchmal ist es besser, die Jungen in dem Glauben zu lassen, daß sie stärker sind“, sagte sie zu mir.
Ich dachte nur, sie mußte einfach verrückt sein, wenn sie das wirklich glaubte.
Das Telefon klingelte. „Ich geh schon ran“, rief mein Vater. Es war die Mutter des Jungen, dem ich die Nase blutig gehauen hatte, das merkte ich an den wütenden Blicken, die mein Vater mir zuwarf, während er zuhörte.
„Ich hab mich so geschämt“, erzählte meine Mutter meinem Vater auf der Rückfahrt von der Synagoge. Er starrte mich wütend im Rückspiegel an. Ich konnte nur seine dicken schwarzen Augenbrauen sehen. Man hatte meiner Mutter mitgeteilt, daß ich nicht mehr in die Synagoge gehen könnte, wenn ich kein Kleid trüge. Dagegen hatte ich mich bislang mit Händen und Füßen gewehrt. Ich trug immer meinen Cowboy-Anzug – ohne die Pistolen. Es war schon schwer genug für uns, die einzige jüdische Familie in der Siedlung zu sein, ohne auch noch in der Synagoge Ärger zu kriegen. Mein Vater betete unten. Meine Mutter, meine Schwester und ich mußten von der Empore aus zusehen, wie im Kino.
Es kam mir nicht so vor, als gäbe es viele Juden auf der Welt. Einige kannte ich aus dem Radio, aber in der Schule gab es keine, außer mir. Juden durften nicht auf den Schulhof. Das hatten mir die älteren Kinder gesagt, und sie setzten es auch durch.
Wir kamen nach Hause. Meine Mutter schüttelte den Kopf. „Warum kann sie bloß nicht wie Rachel sein?“
Rachel warf mir einen verlegenen Blick zu. Ich zuckte die Achseln. Rachel träumte von einem Samtrock mit aufgesticktem Pudel und von straßbesetzten Lackschuhen.
Mein Vater parkte den Wagen vor dem Haus. „Du gehst sofort auf dein Zimmer, junges Fräulein! Und daß du mir da bleibst!“ Ich hatte mich schlecht benommen. Ich würde bestraft werden. Ich hatte Kopfschmerzen vor Angst. Ich wünschte mir so sehr, brav sein zu können. Ich erstickte fast an meiner Scham.
Читать дальше