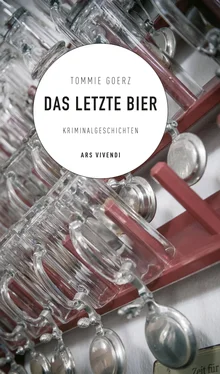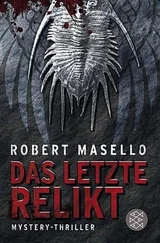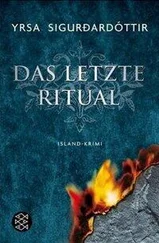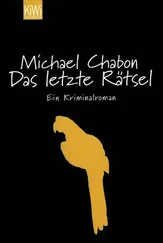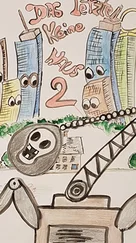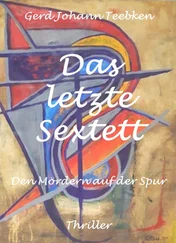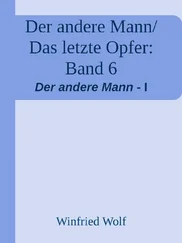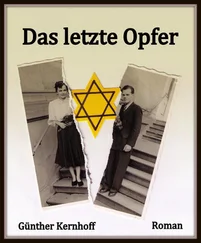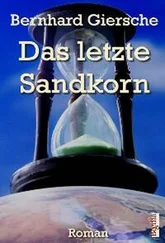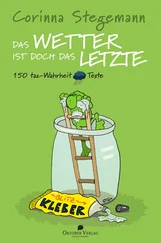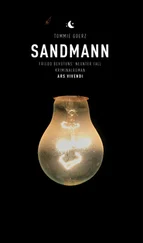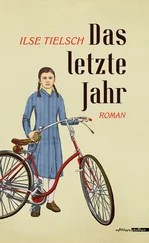»Der Pfarrer stichd es Fässla oh
dasses nur so spritzt,
der wollt scho anders spritzn ah,
doch drauf der Teifl sitzt.«
Hochwürden ließ das erste Bier ins Glas, Schaum pur, der Wirt übernahm, der Gottesmann hielt das schaumgefüllte Seidla hoch, skandierte aus dem Stegreif
»Freund Zeilmann is gar durschdi heut,
doch grichder bloß an Schaum,
weil in der Kirchn sichdmern nie,
der tut ans Weardshaus glaum.«
und reichte ihm unter fröhlichem Gejohle der Gemeinde das mit weißem Schaum gefüllte Glas. Anschließend sang er mit ausgebreiteten Armen den Segen für die Kärwa:
»Wenn aufs Johr die Kärwa is,
na soll die lusti sei,
sunst scheiß i in die Kärwa nei,
soll lieber kahni sei.«
Auch der Herr Pfarrer hatte ein hochrotes Gesicht, allerdings war der Grund hierfür eine sichtlich ausgeprägte Couperose. Vielleicht gingen die vielen kleinen Äderchen ja auf den Messwein zurück? Konnte aber auch Bluthochdruck sein oder einfach eine Bindegewebsschwäche. Ich konzentrierte mich wieder aufs Mitschreiben, kam kaum mehr nach. Aus der Küche wurden die ersten Teller mit Bratwürsten, Kraut und Brot balanciert, die Wirtin und ihre Töchter servierten. Dabei sang die Wirtin den Ersten, dem sie einen Teller hinstellte, direkt an:
»Wo is denn es Gerchla?
Es Gerchla, des is net daham.
Des is aaf der Kärwa,
frisst die ganzn Brodwörschd zam.«
Der Angesungene, er hieß ganz offenbar Georg, also Gerch, konterte den braven Vers gleich rustikal:
»Früh um halber vierer
weggd der Weard die Wearddi auf
zubbfdera weng oh ihrer,
bumms, do hoggder drauf.«
Die Wirtin ließ sich nicht lumpen und antwortete, als sie auf ihrem Rückweg an ihm vorbeikam:
»Ach ja, es Gerchla glah,
des sauft sei Bier allah
doch noch der erschdn Moß
ner werder groß.«
Was soll ich sagen. Das Bier floss in Strömen, das Freibierfass war ruck, zuck leer, der Zapfhahn wurde aufgedreht, die Stimmung ebenso, es wurde immer lauter und die Gstanzln immer derber. Sang einer
»Im Summer, do is Kärwa,
im Winter Weihnachd und Neijohr,
die Katzn rammln zeitenweis,
die Madli is ganz Johr«,
griff ein anderer das Stichwort »Kärwa« auf und donnerte:
»Und wenn mei Fra ihr Kärwa hat,
dann hob ich meine a,
bei mir left’s dann di Gurgl ro,
bei meiner Fraa die Baa.«
Der Saal tobte, es wurde immer schlüpfriger. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass sich, bis auf zwei oder drei, keine Frauen in der Gesellschaft der dreißig, fünfunddreißig Männer befanden. Es dürften so ziemlich alle Männer sein, die der Ort aufweisen konnte, schätzte ich. Ob sie, weil sie unter sich waren, so zotig wurden? Jedenfalls fielen die Hemmungen im Lauf des Abends immer mehr, und mit ihnen das Niveau.
»Nüber, rüber, rauf und ro,
säht der Bauer Linsen.
Wenn die Madli bemberd ham,
dann genners ham und grinsen.«
Die Obergrenze der Derbheit war noch längst nicht erreicht, das Thema der nachfolgenden halben Stunde aber fest umrissen: Es ging ab da nur um die Weiblichkeit und ums Essenzielle. Und wiewohl ich nicht nur einmal heftig lachen musste, ich gestehe es, hatte ich doch stark den Eindruck, dass die hier anwesenden Mannsbilder allesamt bei ihren Ehefrauen zu kurz kamen, sich nicht trauten, von anderem träumten oder was auch immer. Manchmal fühlte ich mich auch derb an meine Jahrzehnte andauernde berufliche Tätigkeit erinnert, während der ich auch das eine oder andere, manchmal durchaus ganz und gar nicht Erfreu- oder Erbauliche, erlebt hatte:
»Ich hob amol a Madla ghabt,
des wor vo Kastlreith,
der hobi untern Ruck nogschaut,
no hätti mi ball gschbeid.«
So verbrachte ich den Eröffnungsabend der Kärwa von Oberspring sehr unterhaltsam am Tisch der Alten und sollte schon am nächsten Morgen zum Frühstück drei von ihnen wiedersehen: den Anstreicher Lenz, den dicken Zeilmann sowie den Landwirt Eh. Sie saßen beim Frühschoppen, die anderen waren mit der Dorfjugend in den Wald hinausgezogen, um den Kärwabaum zu holen. Als der Wirt dem Zeilmann das erste Seidla brachte, stellte der es vor sich hin, hielt es mit ausgestreckten Armen zwischen den Händen und strich genüsslich mit den Daumen über die Kondenswassertropfen, die sich am Glas gebildet hatten.
»Ja, des is schon was Schönes«, sagte er wie zu sich selbst.
»Ein Bier so früh am Morgen?«, konnte ich mir nicht verkneifen.
»Nein«, schüttelte er den Kopf, »obwohl – das auch. Aber ich mein, dass ma jetzt so tolle Kühlschränk hat, wo des Bier immer so schö frisch ist und kalt.«
Ich muss ihn wohl etwas begriffsstutzig angesehen haben, denn er schob gleich die Erklärung nach: »Wissen S’, früher wurd ja noch geeist. Da hammers Eis ausm Weiher gholt druntn und drühm«, und dazu deutete er hinüber zur ehemaligen Brauerei, »in den Keller bracht, fürn Sommer. Da semmer aufs Eis, einer hat gesächd, mit der Hand nu, und der war mit an Seil gesichert. Und manchmal hammern auch reinfallen lassen.« Er lachte. »Issermoll fast ahner dabei gschdorm, ersoffm. Den hammer grodnu rechtzeitig rausgrichd. War so.«
Der Eh nickte, während mein Blick fasziniert auf dessen offensichtlicher Aszites ruhte. So extrem hatte ich das schon lange nicht mehr gesehen. Es war ein massives Dreieck, das es ihm unter den Rippen und über seinem Gürtel herauspresste. Der Zustand seiner Leber konnte nicht sonderlich gut sein, aber er hatte noch keinen Anflug von Gelb im Gesicht, zumindest konnte ich im leichten Zwielicht, das hier herrschte, nichts diesbezügliches Erkennen. Derweil hatte der Eh die Ausführungen vom Zeilmann ergänzt: »Des Eis aus dem Keller hat sich en ganzn Sommer ghalten. Und wenn mir gschlacht ham, aber die Metzger ah, dann ham mir des Eis kafft und hams für di Wurscht gnummer und fürn Leberkäs, do braugst ja eins. Des deaferst heut nemmer, Weiereis für die Wurscht. Wie lang bleim S’ n einglich doh?«, wandte er sich unvermittelt an mich.
»Bis Dienstag hab ich jetzt gebucht«, sagte ich, »bis die Kärwa rum ist.«
»Dann könner S’ ja mit uns ah di Sau eigrohm.«
»Sau eingraben?« Ich wusste nicht, was er meinte.
Da grinste er nur verschmitzt. »Des wern S’ dann scho sehn.« Und das sollte ich auch.
Inzwischen war es draußen lauter geworden, die Männer mit dem Baum kamen aus dem Wald zurück. Es war ein bestimmt zwanzig Meter langer, gerade gewachsener und bis auf die Spitze entasteter Nadelbaum. Das ganze Dorf schien auf den Beinen zu sein.
Die restlichen Kärwatage sind schnell erzählt. Der Baum wurde unter großem Hallo aufgestellt, die Musikkapelle spielte, die Kärwasburschen bewachten in der ersten Nacht den Baum, damit er von den Burschen der Nachbargemeinde nicht abgeschält würde – was eine Schmach fürs ganze Dorf gewesen wäre. Der Bauer Malter, aus dessen Wald der Baum stammte, erzählte mir, genau das sei vor Jahren einmal passiert, da hätten es die Kärwasburschen mit dem Trinken übertrieben und seien in der Nacht eingeschlafen. Schon sei der Baum bis auf Mannshöhe abgeschält gewesen. Er aber sei dann noch »gleich in der Früh, bevor’s alle gsehng ham«, hinaus in den Wald gefahren, habe einen anderen Baum entrindet und die Rinde am Kärwasbaum angebracht. »Alle Welt hätt doch es ganze Joahr über uns glacht, wenn do so a naggerder Baum mittn im Dorf gschdandn wär.« Seitdem sei nachts zur Baumwache immer wenigstens ein Erwachsener da, der über die Kärwasburschen wache. Damit die nicht gar zu viel tränken und noch halbwegs zurechnungsfähig blieben. Trotzdem sahen die Kärwasburschen am nächsten Tag reichlich verorgelt aus, und nach nur sehr wenig Schlaf zogen sie mit drei Musikanten durchs Dorf und tanzten ihre Madli raus.
Der Sonntag ließ sich dann schon etwas gemütlicher an, alle schienen inzwischen reichlich mitgenommen, man aß gut nach einem gemütlichen Frühschoppen, überwiegend Braten und Klöße, und saß danach bei Musik und Tanz unter den großen Bäumen zur einen oder anderen Maß Bier. Erst im Lauf des späteren Nachmittags zog die Stimmung, dem Alkohol und der Musik geschuldet, wieder an.
Читать дальше