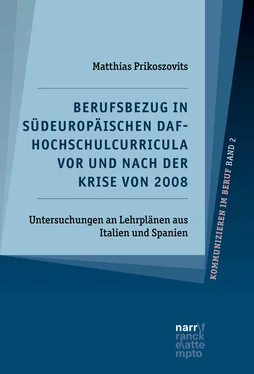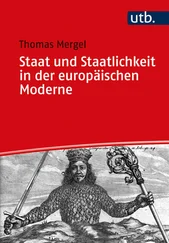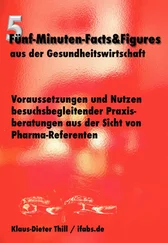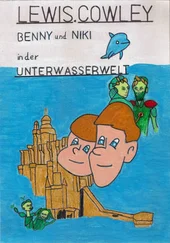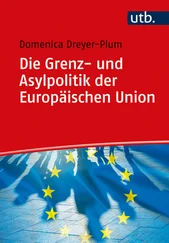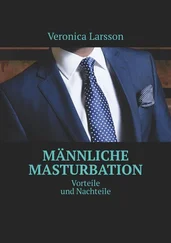Die Hürden, die bei einem Transfer von DaF-Curricula aus dem amtlich deutschsprachigen Raum in distante Erdregionen bestehen, werden in der Fachliteratur der 1990er Jahre diskutiert (Gutzat, 1996; Wannagat, 1998; Prikoszovits, 2017b, S. 87), was einen „[…] Ruf nach regionalen, der jeweiligen Gesellschaft angepassten Curricula […]“ (Prikoszovits, 2017b, S. 87), die in den 1990er Jahren noch ausstehen, zur Folge hatte (Wannagat, 1998). Solche Curricula können den an die Germanistiken außerhalb des amtlich deutschsprachigen Raums entsandten Lektoren eine grundlegende Orientierungshilfe bieten. Laut Königs (2004, S. 6) definiert sich eine von ihm so bezeichnete „[…] Auslandsgermanistik […]“ durch die „[…] Fremdperspektive […]“, also die externe Sichtweise auf die Germanistik. Die Unterschiede zwischen Germanistik und Auslandsgermanistik hätten curriculare Folgen. Gemäß Königs (ebd., S. 6) überschneiden sich Curricula der „[…] Inlandsgermanistik […]“ mit jenen der Auslandsgermanistik nur gering. Dem Erwerb der Fremdsprache Deutsch, der viel Zeit in Anspruch nimmt, muss an germanistischen Hochschulinstituten außerhalb des amtlich deutschsprachigen Raums ein zentraler Stellenwert eingeräumt werden. Dass unter solchen Umständen auch Curricula anders aussehen müssen, ist offensichtlich. Das Bedürfnis nach curricularer Übertragung ist auch insbesondere vor dem Hintergrund kritisch, dass Curricula kulturell geprägt und nicht starr in fremde und ferne Gesellschaften transferierbar sind. Curricula germanistischer Studiengänge in anderen Sprach- und Kulturräumen sollten somit durchaus eigene Ausrichtungen haben.
Ein Curriculum soll sich nicht ausschließlich an den Strukturen der jeweiligen Fachwissenschaften orientieren (Abschnitt 2.5), sondern auch an kulturspezifischen Maximen (s. Robinsohn, 1971, S. 13; Gutzat, 1996, S. 443), pädagogischen Normen sowie gesellschaftlichen und institutionellen Voraussetzungen (s. Gutzat, 1996, S. 443; Mickan, 2013, S. 45, S. 125). Zur Erkenntnis, wie stark kulturabhängig und -gebunden Curricula sind, gelangt man häufig in Publikationen, in denen die Situation der Germanistik und des DaF-Unterrichts in asiatischen Ländern thematisiert wird. Chen (2009, S. 91) etwa hält fest, dass beim Curriculumdesign lokale Lehr- und Lernbedingungen und Traditionslinien nicht vernachlässigt werden dürfen. Gutzat schreibt von einem 1992 vom DAAD in Hochiminh-Stadt eingerichteten Lektorat für den Studiengang Deutsch, für den es kein Curriculum gegeben hätte. Es sei dem DAAD-Lektor überantwortet worden, den Studiengang fachlich zu planen (Gutzat, 1996, S. 443). Somit erscheint eine gewisse „Curriculumkompetenz“ eine für Lehrkräfte anzustrebende Qualifikation darzustellen. Schlak (2006, S. 337) etwa vermisst bei Studierenden in der japanischen DaF-Lehrerausbildung neben erziehungswissenschaftlich relevanten Kenntnissen auch „[…] sprachpolitisch-curriculare[.] Qualifikationen […]“. Des Weiteren erläutert er (ebd., S. 339), dass es im Zuge seiner Bestrebungen, an der Universität Osaka einen offiziellen Studiengang für DaF zu gründen, bedauerlich gewesen sei, Kurse unter anderem zur Curriculumentwicklung und zur Sprachenpolitik nicht berücksichtigen zu können. Diese Äußerungen zeigen, dass er eine gewisse curriculare Qualifikation, die er in einen engen Zusammenhang mit Sprachenpolitik stellt, als unerlässlich in der DaF-Lehrerausbildung erachtet. Es stellt sich hier die Frage, inwieweit also Elemente aus der Curriculumforschung in Lehrpläne für die Fremdsprachen lehrer ausbildung aufgenommen werden sollten. Inwiefern angehende Lehrkräfte entsprechende Kompetenzen im Bereich der Curriculumentwicklung benötigen, kann im Zuge der vorliegenden Arbeit nicht beantwortet werden. Da universitäre Lehrpläne jedoch häufig von Unterrichtenden an Universitäten selbst erstellt werden (Abschnitt 2.4), liegt es allerdings nahe, dass entsprechende Kompetenzen tatsächlich hilfreich wären.
Noch in den 2010er Jahren beschreiben Adamson und Morris (2014, S. 315) ein Curriculum als „[…] set of tensions and contradictions […]“, also als ein Gebilde aus Spannungen und Widersprüchen. Gerade in den Fremdsprachenfächern kommt es aufgrund der Diskrepanz eigene Sprache/Kultur – fremde Sprache/Kultur immer wieder und immer noch zu derartigen Spannungen und Widersprüchen. Man hat „[…] Identitätsstiftung statt Verwestlichung“ (Gouaffo, 1996, S. 476) in den 1990er Jahren in Kritiken an einem Deutsch-Lehrwerk in Afrika verlangt, was sowohl die gesellschaftliche als auch die politische Komponente von FSU verdeutlicht. Die Übertragung deutscher Curricula auf den DaF-Unterricht in der Volksrepublik China hat in den 1990er Jahren aufgrund kultureller Unterschiede und anders gearteter Wertvorstellungen nicht funktioniert, weswegen Wannagat in seinem Beitrag von 1998 für regionale Curricula und Lehrwerke plädiert. Er geht darin sogar so weit, regionale Curricula und Lehrwerke als Desiderat für die Aufrechterhaltung von DaF in der Volksrepublik China zu beschreiben. Einen guten Mittelweg stellt dar, dass Deutschland bei Bedarf im Ausland mitzuhelfen bereit ist, effiziente Curricula für den DaF-Unterricht zu erstellen. Dies geschieht etwa im Rahmen von Kulturaustauschprogrammen, beispielsweise zwischen Deutschland und der Volkrepublik China. Seit den 1980er Jahren seien durch diese Kooperationen fünf in der gesamten Volksrepublik gültige Curricula für den Deutschunterricht entstanden (Yu, 2004, S. 91). Durch eine solche Vorgangsweise werden mitteleuropäische und asiatische Grundsätze und Vorstellungen zusammengeführt, sodass die Curriculumentwicklung hier als eine Form der kultursensiblen Kompromissbildung in Erscheinung tritt, die erfolgversprechend und zukunftsweisend sein kann.
(3) Curriculumforschung und -entwicklung im DaF-Bereich: Die 2000er Jahre
Schon in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends schlägt sich der Einfluss des GER und somit auch der deutschsprachigen Fassung Profile Deutsch (Glaboniat, Müller, Rusch, Schmitz & Wertenschlag, 2005) auf DaF-Hochschulcurricula nieder (s. Funk, 2016, S. 152). Funk (ebd., S. 152) spricht hier von einem „[…] partielle[n] Paradigmenwechsel […]“, den er in die Nähe einer verstärkt wirtschaftsorientierten Bildungslandschaft rückt. Der Einfluss des GER wird von DaF-Experten überwiegend negativ bewertet, vor allem aufgrund seiner stark standardisierenden Wirkung (Iluk, 2002; Krumm, 2002; Königs, 2004, S. 7–8). Eine Standardisierung im Bereich fremdsprachlicher Kompetenzen birgt die Gefahr, dass sich offene in geschlossene Curricula4 verkehren. In neueren DaF-Curricula werden Elemente wie Emotionsausdruck, Problemlösestrategien und regionale Besonderheiten vermisst. Iluk verweist auf die Notwendigkeit, fremdsprachliche Emotionsbekundungen auf allen Niveaustufen zu lernen (2002, S. 101), stellt aber fest, dass dies in Curricula nicht ausreichend umgesetzt wird (ebd., S. 98, S. 101).
Auch Schmidt (2010, S. 930) plädiert für mehr literarische, kreative und interkulturelle Aspekte in künftigen DaF-Curricula. Diese seien durch die Kompetenz- und Outputorientierung des GER aus dem Fokus geraten. Am GER, den Funk (2016, S. 152) als „[…] Orientierungspunkt, Forschungsgegenstand und Streitpunkt der Fremdsprachendidaktik in Deutschland“ bezeichnet, orientieren sich seit den 2000er Jahren zudem zahlreiche moderne Sprachprüfungen wie für DaF etwa sämtliche ÖSD-Prüfungen. Auch derartige standardisierte Formen der Leistungsmessung werden in der Forschung ab den 2000er Jahren immer wieder als Bedrohung für DaF-Curricula angesehen, da die Gefahr besteht, dass sich der Unterricht an den Anforderungen für die Prüfungen, nicht an Curricula orientiert. Dies erkennt man jedoch bereits vor Erscheinen des GER (Macht, 1995). Macht (ebd., S. 284) sieht durch den „[…] back-wash effect […]“ von Prüfungen gar die Wirkkraft von Lehrplänen aufgelöst.
Читать дальше