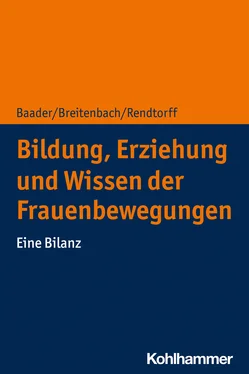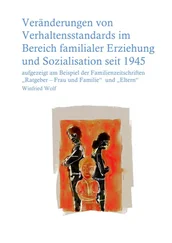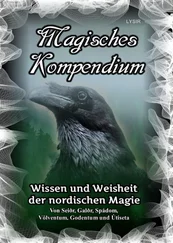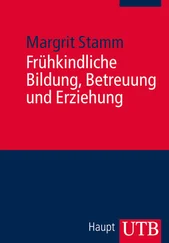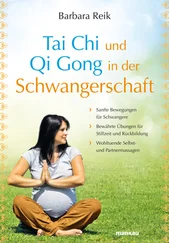Aber auch bevor das Zusammenspiel verschiedener Differenzlinien seit den 1990er Jahren unter dem Begriff der »Intersektionalität‹« systematischer diskutiert wurde, ist innerhalb der Frauenbewegungen und des Feminismus immer wieder nach dem Subjekt des Feminismus und danach gefragt worden, wer für welche Gruppe spricht (und sprechen darf), wer wessen Interessen vertritt (oder gegen wessen Interessen verstößt), wessen Positionen Gehör finden und wessen nicht – und warum. Für das bürgerliche Spektrum der ersten Frauenbewegung trifft dies insbesondere für die Erwartungen der jüdischen Mitstreiterinnen ( 
Kap. 6
und 
Kap. 10
) sowie für die Positionen von Frauen unterbürgerlicher Schichten zu. In der zweiten Frauenbewegung bildeten sich zunehmend Gruppen eingewanderter Frauen (teilweise interkulturell, teilweise herkunftsspezifisch), von denen heute ebenfalls eine reichhaltige intersektionelle Forschung ausgeht (vgl. Diehm/Messerschmidt 2013; Kulaçatan/Behr 2020).
In die deutschsprachige Erziehungswissenschaft wurde die Perspektive der Intersektionalität Anfang der 2000er Jahre insbesondere von Lutz/Krüger-Potratz (2002) eingeführt. Zwischenzeitlich ist sie für die erziehungswissenschaftliche Diskussion um Geschlecht, Heterogenität und Diversität grundlegend (vgl. Walgenbach 2014) und methodologisch-methodisch insbesondere von den Soziologinnen Winker/Degele 2009 ausgearbeitet und reflektiert worden. Damit hat jenes vom »schwarzen Feminismus« (Graneß/Kopf/Kraus 2019: 23) hervorgebrachte Paradigma aus der politischen Sphäre der sozialen Bewegungen in einem über mehrere Jahrzehnte stattgefundenen Prozess der Auseinandersetzung und Diskussion Eingang in die Erziehungs- und Sozialwissenschaften gefunden. Es lässt sich allerdings beobachten, dass bei der Thematisierung der verschiedenen Ungleichheitsaspekte die Dimension Geschlecht deutlich in den Hintergrund geschoben wird, teilweise in Identitätsfacetten zerlegt und teilweise marginalisiert. Dahinter steht die Diskussion darüber, ob unter den zahlreich ausgemachten »Heterogenitätsdimensionen« der Kategorie Geschlecht überhaupt (noch) eine besondere Stellung zukomme (vgl. Knapp 2008) oder ob sie nicht mittlerweile längst »veraltet« oder »überholt« (Knapp 2012: 301) und nur noch eine fast nebensächliche Kategorie unter anderen sei.
Die Frage, ob der Feminismus die Geschlechterdifferenz akzentuieren solle, so etwa bei Luce Irigary (1987), oder aber Gleichheitsforderungen fokussieren, wird in der Theoriediskussion immer wieder gegeneinandergesetzt, wie auch die Rekonstruktion von Casale/Windheuser 2019 zeigt. Wir wollen diese Gegenüberstellung des Entweder-Oder jedoch nicht fortschreiben, denn die Opposition ist zum einen historisch nicht angemessen und zum anderen gab und gibt es immer wieder Versuche, das Verhältnis anders zu bestimmen, etwa über Gleichheit in der Differenz (vgl. Prengel 1990), durch Versuche der Balancierung beider Perspektiven (vgl. Maihofer 1995), durch eine Reflektion von Subjektkonstitutionen (vgl. Dingler 2019) oder durch eine Verflüssigung der Kategorie Geschlecht im »doing gender« und durch Ansätze, die das System der Zweigeschlechtlichkeit insgesamt in Frage stellen, wie in den Queer Studies ( 
Kap. 12
). Gegen die Schablonen und festgefahrenen Mainstreamnarrationen wollen wir diese Aspekte vor allem mit dem Fokus auf Erziehung, Bildung, Sozialisation und Sorge diskutieren. Darüber hinaus ist auch zu fragen, ob die insbesondere in der französischen und italienischen Theoriebildung verwendeten Begriffe der »sexuellen Differenz« oder »differenzia sessuale« nicht noch andere Bedeutungshorizonte einschließen. Catrin Dingler hat in ihrer Auseinandersetzung mit dieser Theorietradition auf den »Schnitt« bezüglich des Subjektverständnisses hingewiesen (ebd.: 9ff.). Diese Debatten machen darüber hinaus deutlich, dass in einer reflektierten Perspektive »der« Feminismus aus vielen Feminismen besteht. Der Begriff »Feminismus« wurde im späten 19. Jahrhundert von französischen Frauenrechtlerinnen aufgebracht, er wird Hubertine Auclert zugeschrieben und bezeichnet Positionen, die sich für die Emanzipation, Frauenrechte und rechtliche Gleichstellung von Frauen stark machten. Er wurde in den 1890er Jahren auf verschiedenen internationalen Frauenkongressen diskutiert und teilweise synonym mit dem Begriff der Frauenbewegung verwendet.
»Im Deutschen aber haftet dem Begriff bis heute der Geruch besonderer Radikalität an. Tatsächlich wurde er an der Wende zum 20. Jahrhundert von den Akteurinnen kaum zur Selbstbezeichnung, dagegen abwertend und denunzierend von den Gegnern der Frauenemanzipation gebraucht und hat erst mit der Frauenbewegung der 1970er Eingang in unsere Alltagssprache gefunden« (Gerhard 2018: 8).
Die Geschichte des Feminismus ist also von seinen Anfängen an auch mit seiner Abwertung verbunden. Dabei ist die Geschichte des Antifeminismus historisch zudem immer wieder mit dem Antisemitismus verbunden. Karin Stögner etwa argumentiert, dass beides »in Form von Ideologemen, verfestigten Diskursformen, eingeschliffenen Stereotypen und tiefsitzenden Verhaltensmustern als verdinglichte soziale Tatbestände« auftreten und sich auf Natur und Ontologie berufen würde (2014: 15). Diese Konstellation erfährt auch aktuell Revitalisierungen und digitale Neukonfigurationen.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Frauenbewegungen
Ebenso vielschichtig und uneinheitlich wie der Begriff »Feminismus« ist die Bezeichnung »Frauenbewegung«. Eine Kategorisierung als »Bewegung« kann stets nur im Nachhinein als Etikett vergeben werden, wenn sich bereits Personen in größerer Menge für ein bestimmtes Ziel oder gegen bestimmte politische Bedingungen zusammengefunden haben, sich zumindest rudimentär auch organisiert und ihre Aktivitäten über einen längeren Zeitraum hinweg artikuliert haben und so sichtbar werden. Damit dies funktioniert, brauchen Bewegungen auch so etwas wie eine »kognitive Konstitution« (Gilcher-Holtey 2005: 11), das heißt identitätsstiftende Themen und Praktiken, »ein symbolisches System der Selbstverständigung und Selbstgewissheit« (ebd.), die für den Mobilisierungsprozess bedeutsam sind. Diese bedürfen, neben den kognitiven Rahmungen, auch immer wieder besonderer Gelegenheitsstrukturen, innerhalb derer die Forderungen der Bewegung öffentlichkeitswirksam vorgetragen werden und ihren Ausdruck finden. Diese Merkmale treffen auf beide Frauenbewegungen zu. Beide haben sich organisiert, haben spezifische Protestformen entwickelt, Treffpunkte, Räume und Publikationsorgane geschaffen, agierten transnational und haben Theoriebildung und Akademisierung in Gang gesetzt und ihre Themen und Forderungen so mittel- bis langfristig eingebracht. Beide Frauenbewegungen haben dabei in ihren Themen unterschiedliche Akzentuierungen gehabt, aber es gibt auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten und Berührungspunkten. Diese arbeiten wir in den einzelnen Kapiteln zu den zentralen Themen heraus. Die erste Frauenbewegung setzte ihre Akzente auf Bildung, Erwerbstätigkeit und Rechte (Bock 2005: 169), die zweite auf Formen der Wissensproduktion, Hausarbeit, Sprache, Körper, Gewalt, Sexualität und Formen der Selbstbestimmung in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Sie fokussierte sich stark auf »Individualisierung, Subjektwerdung, Subjektivität und Raum zur Selbstentfaltung« (ebd.: 323). Sie erfreute sich auch provokativer Protestformen, sie forderte Autonomie und brach »zuweilen unter Mühen – mit der Neuen Linken« (ebd.: 321).
Читать дальше