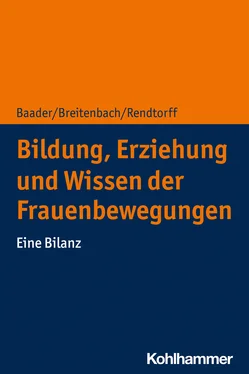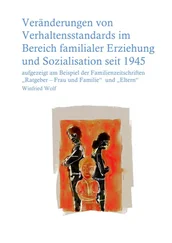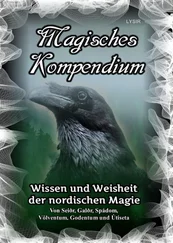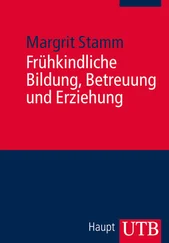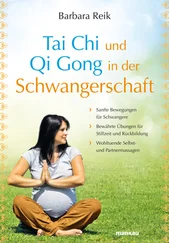Auch die Geschichte der Sozialen Arbeit und ihrer Professionalisierung war maßgeblich sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Frauenbewegung verbunden ( 
Kapitel 5
, 
Kapitel 7
). Konzepte von Bildung und Konzepte von Sorge wurden dabei bereits in der ersten Frauenbewegung in unterschiedlichen Ansätzen miteinander, mit den Geschlechterverhältnissen und mit der geschlechtstypischen Arbeitsteilung verknüpft. »Bildung und Sorge werden im Kontext frauenbewegter Visionen des Sozialen gleichermaßen als Notwendigkeit formuliert und erweisen sich als bewusster und explizit politischer Umgang mit den zeitgenössischen sozialen Herausforderungen« (Maurer/Schröer 2015: 597). Durch die zweite Frauenbewegung wurden manche Themen überhaupt erst zu Gegenständen von theoretischer Analyse und praktischer Hilfe. Aus Initiativen der Frauenbewegung entwickelten sich Handlungsfelder der Sozialen Arbeit, im Verlauf der erfolgreichen Etablierung als Gegenstand Sozialer Arbeit wurde allerdings die kritische feministische Analyse der Geschlechterverhältnisse auch domestiziert und teilweise zum Verschwinden gebracht.
Eine umfassende Darstellung der Geschichte der Frauen- und Mädchenbildung über 500 Jahre in vergleichender Perspektive zwischen Deutschland, Frankreich und England wurde vor wenigen Jahren von Juliane Jacobi vorgelegt. Dabei werden auch die Aktivitäten und Kämpfe des 1894 gegründeten Bundes Deutscher Frauenvereine (BDF) für die Bildungsbeteiligung von Frauen und Mädchen um 1900 zentral in den Blick genommen (Jacobi 2013: 301). Jacobi resümiert, dass die meisten der seit Mitte des 19. Jahrhunderts für die Bildungszugänge von Frauen kämpfenden bürgerlichen Aktivistinnen der Frauenbewegung an der »Besonderheit von Mädchenbildung« festgehalten hätten und davon ausgegangen seien, dass damit kein Ausschluss aus der »Welt des Wissens und dem Erwerbsleben« verbunden sein müsse (ebd.: 446) Diese Position wurde allerdings von den sozialistischen Aktivistinnen nicht geteilt, aber auch nicht von radikaler denkenden bürgerlichen wie etwa Hedwig Dohm (1831–1919) (vgl. Dohm 1910/1981), die nicht zuletzt mit der Forderung nach Wahlrecht auch die Gleichheit von Frauen und Männern betonen wollten.
Dass der Rekurs auf »weibliche Besonderheiten« problematisch ist, weil er die kategoriale Aufteilung in zwei unterschiedliche Geschlechter mit je spezifisch zugeordneten Tätigkeiten und Passungen aufrechterhält – und es damit denjenigen Frauen, die sich in andere Berufsbereiche begeben wollten, zusätzlich schwermachte –, wird im Folgenden an verschiedenen Themenfeldern und aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert. Denn auch wenn die separate Mädchenbildung spätestens im Zuge der Bildungsreformen der 1970er Jahre aus der Regelschule der Bundesrepublik verschwand und die Frage nach einer besonderen Form der Mädchenbildung zunächst als erledigt betrachtet wurde (auch wenn es die Nische der Mädchenschulen weiterhin gab und noch gibt), blieben die Aufteilung nach Geschlecht und die Orientierung an einer vermeintlichen Besonderheit des Weiblichen in vielen anderen Bereichen – etwa der Segregation in Berufswahl und -bildung, dem Erziehungsbereich, der öffentlichen Kinderbetreuung oder den Konzepten der Sozialen Arbeit – weiterhin wirksam.
Erst die neue Frauenbewegung, so noch einmal Jacobi, habe die Einführung der Koedukation nicht mehr nur als Erfolg und Gleichstellung betrachtet, sondern kritisch danach gefragt, inwiefern sich unter der scheinbaren Gleichheit nicht alte Stereotypen und Geschlechterungleichheiten fortsetzen würden (Jacobi 2013: 447). Diese Perspektive, die nach Gemeinsamkeiten, Kontinuitäten, Unterschieden oder gar Brüchen im Verhältnis von erster und zweiter Frauenbewegung fragt, will das vorliegende Buch aufnehmen, auch wenn dabei vieles nur angerissen werden kann. Vor diesem Hintergrund verstehen wir unsere Arbeit auch als Anregung zum Weiterdenken, zur Vertiefung und differenzierten Erforschung. Unsere Bilanz ist eine vorläufige.
Während also die Impulse der ersten Frauenbewegung für Fragen von Bildung und Erziehung vor allem unter dem Aspekt der »Frauen- und Mädchenbildung« insgesamt recht gut erforscht sind, ist dies für die zweite Frauenbewegung nicht der Fall. Diese nahm in der Bundesrepublik ihren Ausgang 1967/1968 mit der Kritik am männlichen und autoritären Habitus in der sogenannten Studentenbewegung. Zwar ist der Tomatenwurf 1968 von Frauen gegen ihre männlichen Genossen durchaus in das kulturelle Gedächtnis der Bundesrepublik eingegangen (vgl. Notz 2006), dass es dabei aber um Fragen von öffentlicher Kindererziehung ging, ist weniger bekannt (vgl. Baader 2008, 2018a). Einzelne Aspekte der zweiten Frauenbewegung zu Frauen an Schule und Hochschule sind entlang der Frage nach der Frauenbildung in den Blick genommen worden (vgl. Kleinau/Opitz 1996), diese werden aber nicht durchgängig mit den Aktivitäten und Initiativen der Frauenbewegung in Verbindung gebracht. Eine umfassende Darstellung ihres bildungsbezogenen Engagements und dessen Wirkungen existiert bislang nicht.
Dieses Buch will diese Lücke schließen und die Impulse der ersten und zweiten Frauenbewegung für Fragen von Bildung, Erziehung, Sozialisation und Sorge in ihren Kontinuitäten und Diskontinuitäten skizzieren und diskutieren. Dabei wird auch nach den Kämpfen und Auseinandersetzungen innerhalb der erziehungswissenschaftlichen Fachcommunity um die Akzeptanz und Anerkennung bestimmter Perspektiven und Positionen, die aus der Frauenbewegung und dem Feminismus kamen, gefragt. So hatte beispielsweise die 1964 gegründete Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) zunächst sehr skeptisch auf den 1982 eingereichten Antrag zur Gründung einer »Kommission für Frauenfragen« reagiert, die anfänglich als Bedrohung für die »Identität der Disziplin« (Berg/Herrlitz/Horn 2004: 48) gesehen wurde. 1985 wurde diese Initiative dann als »Arbeitsgemeinschaft auf Zeit« akzeptiert und erst 1991 konnte der Status einer »Kommission Frauenforschung in der Erziehungswissenschaft« durchgesetzt werden. Die Umbenennung und Erweiterung erfolgte dann 1999 zur Sektion »Frauen und Geschlechterforschung« (vgl. Rieske 2016).
Fragen von »Geschlechtergerechtigkeit« oder »Koedukation« kommen in der wichtigsten und traditionsreichsten Zeitschrift der Disziplin, der »Zeitschrift für Pädagogik«, bis in die 1970er Jahre nicht vor. Ein von einer Frau herausgegebenes Beiheft der Zeitschrift erschien im Jahre 1959 (eine Festgabe für Herman Nohl) und dann wieder im Jahr 2004. Juliane Jacobi hat 2008 vor dem Hintergrund einer Analyse der »Zeitschrift für Pädagogik« unterstrichen, dass die Geschlechterforschung dort bis dahin nicht angekommen war, genauso wenig wie in der empirischen Bildungsforschung (Jacobi 2008: 94ff.) Aber auch die 1967 gegründete kritisch ausgerichtete Zeitschrift »betrifft: erziehung«, die ein Forum für eine jüngere Generation von kritischen Erziehungswissenschaftler:innen und Bildungsforscher:innen darstellte und deshalb als kritischer Gegenentwurf zur »Zeitschrift für Pädagogik« gelten kann, wies in ihrem Redaktionsteam Anfang der 1970er Jahre nur eine Frau auf. Damit bildet die schwache Repräsentanz von Frauen eine Gemeinsamkeit sowohl einer älteren und tradierten wie auch einer jüngeren und aufbruchsorientierten Zeitschrift der Disziplin. Insgesamt würde das spezifische Verhältnis der Disziplin zu Fragen der Geschlechterforschung durchaus ein eigenes Forschungsprojekt darstellen.
In diesem Buch werden Fragen auf mehreren Ebenen berücksichtigt: erstens die nach der Repräsentanz und Sichtbarkeit von Frauen mit feministischen Positionen zu Erziehung, Bildung, Sozialisation und Sorge an den Schulen und Hochschulen, in den Fachgesellschaften und in einschlägigen Publikationsorganen und Publikationen; zweitens die nach den erziehungs- und bildungsbezogenen Themen, die von der Frauenbewegung initiiert und bearbeitet wurden, einschließlich der damit verwandten Topoi (wie Gerechtigkeit, Gleichstellung, Gemeinsamkeit, Solidarität). Drittens ist danach zu fragen, auf welche Resonanzen diese Themen in der Erziehungswissenschaft stießen und wie und wo sie aufgenommen worden sind. Dabei werden auch Ambivalenzen und Paradoxien in den Blick genommen, etwa bezüglich der Integration bestimmter ursprünglich aus dem Feminismus stammender Perspektiven in das Erziehungs- und Bildungssystem, das System der Sozialen Arbeit oder in diejenigen Wissenschaften, die sich mit Erziehung, Bildung und Sorge befassen – wobei das Wissen um diese historische Verbindung meist verloren gegangen ist. Und schließlich wird viertens auch danach gefragt, wie die von engagierten Frauen ausgegangenen pädagogischen, bildungs- und erziehungsbezogenen Impulse in das gesellschaftliche Miteinander, die gesellschaftliche Geschlechterordnung und in das Alltagshandeln zu Erziehung und Geschlecht hineingewirkt haben. Angesichts dessen wird mit diesem Buch auch ein erinnerungskultureller Beitrag geleistet, der der Geschichtsvergessenheit gegenüber den Debatten und Impulsen der Frauenbewegung und den diesbezüglichen Tradierungslücken etwas entgegensetzen will.
Читать дальше