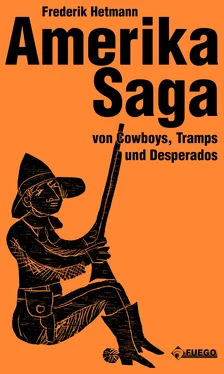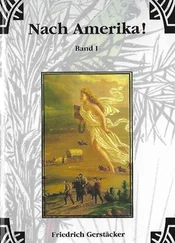Als ich so vor der Theke stand und recht verlegen wurde, da mich Jobs Hausordnung in blasser Kreideschrift tückisch anstarrte, entdeckte ich einen Fetzen Waschbärenfell zwischen den Stangen, die die Bar trugen. Job hatte mein Fell in aller Eile dorthin gestopft. Mit einem raschen Griff zog ich daran und warf es mit dem unschuldigsten Gesicht der Welt auf die Theke. Job, der sich nicht träumen ließ, was hier gespielt wurde, schob mir eine zweite Flasche herüber, die meine Wähler in übermütiger Stimmung eilig leerten, denn einige hatten meinen Trick bemerkt. Als die Flasche leer war, gingen wir hinaus und wandten uns wieder dem Wohl des Staates zu.
Ich weiß auch nicht warum, jedenfalls waren alle Wähler bald wieder durstig, wieder gingen wir in den Schuppen, und wieder steckte das Fell zwischen den Stangen. Wieder wurde der Rum über die Theke gereicht, und wieder war die Flasche schnell leer. Ich will auf der Stelle tot umfallen, wenn ich nicht mit ein und demselben Waschbärenfell an diesem Tag zehn Flaschen Rum einhandelte, und dies von einem Burschen, der ansonsten wirklich auch nicht auf den Kopf gefallen war.
Dieser Spaß half mir die Wahl zu gewinnen, denn Berichte davon verbreiteten sich unter meinen Wählern mit der Schnelligkeit eines Präriebrandes, und diese folgerten (nicht ganz zu Unrecht, will ich meinen), dass ein Mann, der Job Snelling in einem fairen Geschäft übervorteilen konnte, wohl auch mit dem Präsidenten fertig werden müsse »und deshalb der richtige Mann für den Kongress sei«. Nach gewonnener Wahl erstattete ich Job Snelling den Betrag für die geprellte Zeche, und ich muss sagen, er war ein guter Verlierer. Er lachte und strich das Geld ein.

Bei der Kongresswahl im Juli 1835 unterlag Crockett seinem Gegenkandidaten mit zweihundertunddreißig Stimmen. Bei dieser Wahl, war es zu beträchtlichen Unregelmäßigkeiten gekommen. Der Präsident Andrew Jackson hatte Staatsgelder, die auf einer Privatbank deponiert waren, abgehoben und damit Stimmen gekauft. 25 Dollar war damals eine Wählerstimme wert. Angewidert von solchen Praktiken, fasst Davy Crockett den Entschluss, »die Vereinigten Staaten so lange zu verlassen, bis die Zeit kommt, da auch ein ehrlicher und unabhängiger Mann seinen Weg in der Politik machen kann.« – »Und«, so fährt er fort, »da mir bis dahin wohl hinreichend lange Musestunden verbleiben würden, entschloss ich mich, den Texanern auf ihrem Weg in die Freiheit helfend meine Hand zu reichen. Ja, dergleichen hat mir immer Spaß gemacht, denn wenn es auf dieser Welt etwas gibt, was das Leben lebenswert macht, so ist es die Freiheit.«
– Das abenteuerliche Leben des Davy Crockett –
Der Ritt nach Texas
Es war Herbst geworden. Das Thermometer zeigte schon Frost an, als ich Frau und Kinder verließ. Ich zog einen sauberen Jagdanzug an, setzte eine Fuchspelzkappe auf, von der hinten der Schwanz herunterhing, und nahm mein Gewehr Betsey, das mir, wie jeder weiß, von den Bürgern von Philadelphia in Anerkennung meiner Verdienste im Kampf gegen tyrannische Maßnahmen der Regierung geschenkt worden war. So ausgerüstet, brach ich schweren Herzens in Mill Point auf und fuhr mit einem Dampfboot den Mississippi hinunter, einem neuen Land entgegen. Nach längerer Reise und manchen Abenteuern gelangte ich nach Nacogdoches, einer kleinen Stadt mit Poststation und Gericht in Louisiana, am rechten Ufer des Red-River. Hier lernte ich einen seltsamen Mann kennen. Er war Bienenjäger. Er war weit gereist und erklärte mir, dass er den weiten Ozean der Prärien gut kenne: Besonders in Texas fänden sich viele wilde Bienenschwärme, die einen Honig von ganz ausgezeichneter Qualität sammelten. Es gäbe Menschen, die einen besonderen Sinn für die Gewohnheiten dieser Tiere mitbekommen hätten und deshalb leicht jeden wilden Bienenstock aufspüren könnten. Diese Beschäftigung sei nicht nur bloßer Zeitvertreib, sondern recht einträglich. Allein das Wachs erziele in Mexiko drüben hohe Preise; da in den Kirchen überall Wachskerzen von der Länge und Stärke eines Männerarms brennen. Viele der Bienenjäger würden deshalb aus den Stöcken nur das Wachs entnehmen. »Es ist seltsam«, sagte mir der Mann, »fast nie finden sich Bienenstöcke in einem noch unberührten Landstrich. Für die Indianer sind Bienenschwärme die Vorboten des weißen Mannes. Und es scheint so, als ob sie mit der Grenze der Zivilisation immer weiter nach Westen wanderten.«
Mit dem Bienenjäger und einem Mann namens Thimblerig setzte ich meine Reise fort, und als wir einige Tage über die endlos weite Prärie geritten waren, kam mich eine große Lust auf einen Jagdausflug an.
Wir sprachen davon und der Bienenjäger schenkte mir noch eine Tüte Kaffee und Biskuits, die ihm sein Mädchen in Nacogdoches mitgegeben hatte. Wir tranken auf das Wohl der kleinen Kate und wünschten dem Bienenjäger, der voll Ungeduld auf den Tag wartete, da er sie zur Frau nehmen würde, viel Glück. Während wir tranken und sprachen und einige Einwände gegen meinen einsamen Ausflug geäußert wurden, bemerkte ich, dass der Bienenjäger in einem fort seine Blicke zum Horizont schweifen ließ. Plötzlich hielt er inne, sprang auf, rannte wie vom Wahnsinn gepackt zu seinem Pferd und preschte in die Prärie hinaus. Wir beobachteten, wie Pferd und Reiter kleiner und kleiner wurden und schließlich in der Ferne verschwanden. Ich war völlig verblüfft, und auch Thimblerig meinte, der gute Mann müsse wohl verrückt geworden sein.
Kurz nachdem der Bienenjäger verschwunden war, hörten wir in der Ferne ein Geräusch, das wie das Grollen eines heraufziehenden Gewitters klang. Der Himmel war klar, kein Anzeichen für einen Sturm war zu bemerken; also schlossen wir, dass das Grollen wohl eine andere Ursache haben müsse. Als wir nach Westen schauten, sahen wir am Horizont eine gewaltige Staubwolke.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte ich.
»Du darfst meine Schuhe ins Feuer werfen, wenn ich es weiß«, sagte mein Gefährte und stülpte sich seinen Hut auf den Kopf.
Wir starrten weiter in die Richtung, aus der der Lärm zu uns herüberdrang. Vielleicht war es ein Tornado, doch was immer es sein mochte, es kam genau auf uns zu. Unsere Pferde hatten aufgehört zu grasen und legten die Ohren an. Wir liefen zu ihnen, fingen sie ein und ritten zu einem Wäldchen – und immer noch schwoll das Geräusch an. Kaum dass wir die schützenden Bäume erreicht hatten, als das heulende und donnernde Etwas nahe genug heran war, um erkennen zu lassen, worum es sich handelte.
Eine Herde Büffel, vier- oder fünfhundert Tiere, stürmte auf uns zu. Und es war, als seien alle Teufel der Hölle losgelassen. Die Tiere galoppierten am Wäldchen vorbei und wären wir ihnen draußen, auf der freien Prärie, begegnet, so hätten sie uns bestimmt totgetrampelt. Mein armes Pferd scheute. Es war so nervös wie ein Politiker, den man eben aus seinem Amt gejagt hat.
An der Spitze der Herde, etwas voraus, lief ein schwarzer Büffelbulle, der das Leittier zu sein schien. Er kam wie ein Wirbelsturm angeprescht und sein Schwanz stand steil in die Höhe. Von Zeit zu Zeit bohrte er wütend seine Hörner in den Boden und warf Erdklumpen auf. Als er ganz nahe herangekommen war, nahm ich mein schönes Gewehr Betsey auf und schoss. Er brüllte und blieb dann plötzlich stehen. Die Tiere hinter ihm taten das Gleiche. Und es ist mir bis heute unverständlich, dass sie sich dem entstehenden Gewühl, nicht die Beine brachen. Der schwarze Bulle stand für ein paar Augenblicke regungslos da, dann warf er seinen schweren Körper herum und preschte davon.
Читать дальше