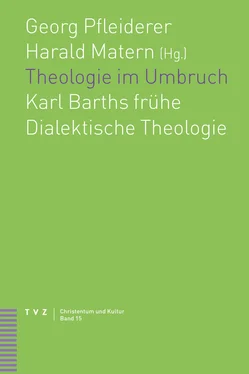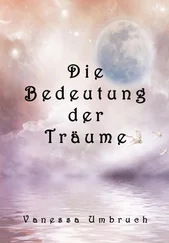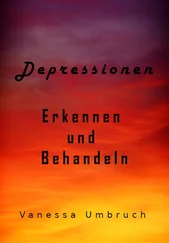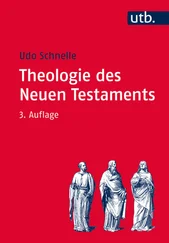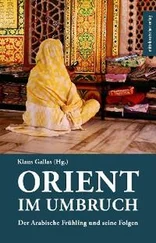Abgerundet, oder besser: über den Tellerrand des Untersuchungszeitraums hinaus geöffnet wird der Band durch den Beitrag des Saarbrücker Systematischen Theologen Michael Hüttenhoff. Seine Ausführungen über die «Kirchliche Opposition im Streit» beschäftigen sich mit Barths Verhältnis zur Bekennenden Kirche und ihren führenden Vertretern. Im Zentrum der Untersuchung stehen die Vorworte, die Barth für die «Theologische Existenz heute!» 1933 und 1934 schrieb. Anhand der Äusserungen Barths zur Lutherfeier 1933 analysiert Hüttenhoff die umstrittene Stellung Barths innerhalb der kirchlichen Opposition und seine Reaktionen darauf. Dabei stehen Barths Kritik an der Theologie (die Hüttenhoff auf der Linie seiner Polemik gegen die natürliche Theologie bzw. den Neuprotestantismus interpretiert) sowie der s. E. unrechtmässigen Übernahme der Kirchenleitung durch die Deutschen Christen im Vordergrund, die ihn zugleich in eine kritische Position gegenüber der Jungreformatorischen Bewegung, aber auch innerhalb des Pfarrernotbunds brachte. Hüttenhoffs konzise Mikroanalyse zeigt Barths Dialektische Theologie in der dramatischen Phase der gesamtgesellschaftlichen und humanitären Krise, die der nationalsozialistische Staat zu diesem Zeitpunkt noch nur Deutschland brachte. Sie zeigt die «Dialektische Theologie in Scheidung und Bewährung» (Walter Fürst). Ob die Scheidungen, die Barth in dieser Phase oft auch gegenüber engeren Weggefährten aus grundsätzlichen theologischen Erwägungen meinte vornehmen zu müssen, der politischen und ethischen, aber auch theologischen Bewährung seiner Theologie in allen Fällen wirklich dienlich waren, – dies zu beurteilen muss, wie vieles andere auch, ebenfalls der weiteren Forschung vorbehalten bleiben. |21|
Die Herausgeber danken zunächst der Autorin und den Autoren dafür, dass sie ihnen ihre Beiträge für diesen Band überlassen und dabei teilweise einige Geduld bewahrt haben.
Dass die betreffenden Anlässe, aus denen der Grossteil der Beiträge hervorgeht, möglich wurden, ist vor allem der Förderung und Unterstützung der Karl Barth-Stiftung und namentlich ihrem Präsidenten, Dr. iur. Dr. theol. h. c. Bernhard Christ, zu danken. Ihm bzw. ihr danken wir auch für einen namhaften Beitrag zur Deckung der Druckkosten des vorliegenden Bandes. Ebenfalls danken wir dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) für einen Beitrag zur Förderung der Tagung vom November 2012.
Die redaktionelle Bearbeitung dieses Buchs ist grossenteils von Tanja Manz, Julia Vitelli sowie Paul Schalck geleistet worden, denen für ihre vielfältigen Mühen und beständige Unterstützungsbereitschaft besonders gedankt sei. Schliesslich, aber nicht zuletzt danken wir dem Theologischen Verlag Zürich in der Person von Lisa Briner sowie von Stephan Landis, deren geduldige Begleitung und freundliche Kritik dem Text viel Gutes getan und diesem Buch nun endlich zu seiner Veröffentlichung verholfen haben. Sie bewahren auch in dieser Hinsicht aufs Beste das Erbe ihrer Vorgängerin, der so früh verstorbenen Marianne Stauffacher, der wir auch an dieser Stelle noch einmal in grosser Dankbarkeit und Anerkennung gedenken möchten.
Basel, im Oktober 2014
Georg Pfleiderer und Harald Matern
|22|
|23|
I.
|25|
«Abwechselnd über der Zeitung und dem Neuen Testament brütend». Themen und Probleme in Barths «Vorträgen und kleineren Arbeiten 1914–1921»
Hans-Anton Drewes
Die Dramaturgie des Symposiums, in dem der nachstehende Beitrag seinen Sitz im Leben hatte, hatte für das erste Referat eine Einführung in Barths «Vorträge und kleinere Arbeiten 1914–1921» vorgesehen, denen die Konferenz insgesamt gewidmet war.12
Wenn wir uns zum Vergleich an den Studienbetrieb der Hohen Schulen des Mittelalters erinnern, die doch ein bleibendes Modell der universitas magistrorum et scholarium darstellen, wäre meine Aufgabe also die des baccalaureus, der zu einer quaestio disputanda Fragen und Antworten, traditionelle und womöglich auch neue, zusammenzutragen und zu ordnen und das Für und Wider dieser oder jener Problemlösung zu besprechen hatte, um so die determinatio magistralis vorzubereiten. |26|
Gewiss wird es heute mehrere solche determinationes magistrales geben. In jedem Fall hat die vorbereitende Sammlung von Perspektiven und Aspekten jetzt mit der Formulierung der Disputationsfrage zu beginnen, die in unserem Fall also wohl hiesse: «Utrum doctrina Barbae in tempore Safenviliensi sit doctrina dialectico-theologici socialismi.»13 Und die erste Angabe, der erste Schritt zur Beantwortung dieser Frage müsste traditionsgemäss lauten: «Videtur quod non», es scheint so, dass Barths Denk- und Lehrform in der Safenwiler Dekade nicht die Denkform eines dialektisch-theologischen Sozialismus gewesen sei.
Als einen ersten Beleg für diesen Eindruck möchte ich, um gleich mitten in die Sache zu springen, den kurzen Text anführen, den Barth mit «Sozialismus und Kirche» überschrieben hat. Barth sagt hier einerseits, er sei «mehr Pfarrer als Sozialist», andererseits, er sei «auch Sozialist wenigstens». Die Stichworte, die Barth sich wohl für eine Aussprache im Safenwiler Arbeiterverein notiert hat, erläutern dieses «mehr» und dieses «auch wenigstens» so: Das «Unausgesprochene» im Sozialismus ist gerade das Wesen des Sozialismus, und deshalb ist hinter und über dem Parteiprogramm von der Bibel zu reden – von der Bibel, die aber in der kirchlichen Tradition entleert worden ist; deshalb ist im gleichen Vorgang ebenso umgekehrt von der Bibel, von der Theologie her auf den Sozialismus Bezug zu nehmen, um die einseitig geistige, die einseitig moralische, die insgesamt zu wenig radikale Auffassung und Wahrnehmung der Bibel zu korrigieren.
Friedrich-Wilhelm Marquardt, dessen ich auch an dieser Stelle mit aufrichtigem Dank gedenken möchte, hat diese Notizen in den Zusammenhang der thematisch ähnlichen Vorträge über «Religion und Sozialismus», «Krieg, Sozialismus und Christentum» und über «Christus und die Sozialdemokraten» gestellt und entsprechend in die Jahre 1915/1916 eingeordnet. Das ist gewiss sehr erwägenswert. Trotzdem stellt sich hier eine Frage: Denn zum einen ist das Schriftbild z. B. der Ausführungen über «Krieg, Sozialismus und Christentum» vom 14. Februar 1915 doch deutlich anders als das der Notizen über «Sozialismus und Kirche».14 Zum andern aber und vor allem: Die Stichworte über «Sozialismus und Kirche» sind auf der Rückseite eines Textentwurfs notiert, dessen Schrift ebenso wenig oder noch weniger |27| der von 1915/1916 gleicht.15 Die Gedankenmotive in diesem Textfragment erinnern an die Predigt, die Barth am 26. Oktober 1919 gehalten hat.16 Das gibt uns einen Orientierungspunkt.
Gemeinsam ist dem Textfragment und der Predigt die Unterscheidung von drei bzw. vier Zeiten: Das Textfragment unterscheidet sie deutlich als erste, zweite und dritte Zeit. Soviel aus den wenigen Zeilen – in Barths an Thomas von Aquins «littera inintelligibilis» erinnernder Schrift – zu entnehmen ist, sind sie im Blick auf die Frage unterschieden, «die verborgen im Herzen der Menschen lebt»; die dritte Zeit, «in der wir daran denken müssen», wird der ersten gegenübergestellt, in der wir daran denken – vielleicht akzentuiert Barth: «noch daran denken» –, und der zweiten, in der wir nicht daran denken – vielleicht: nicht daran denken wollen. Vermutlich hatte Barth zuvor, auf der nicht erhaltenen oberen Blatthälfte, davon gesprochen, dass wir in Beziehung auf die Lebensfrage auch in der ersten und der zweiten Zeit leben. «Die gegenwärtige Zeit» ist, «aufs Ganze gesehen», jedoch «jedenfalls dritte Zeit»: «die Zeit der offenen, der brennenden Frage», in der «viel Sicherheit, viel Befriedigung, viel Gerechtigkeit» dahin ist; aber gerade da «fängt das Leben an».
Читать дальше