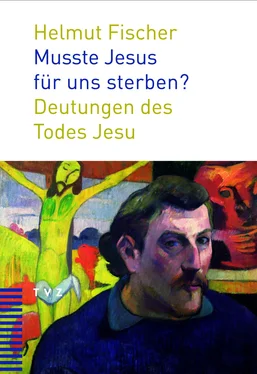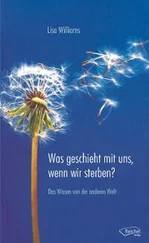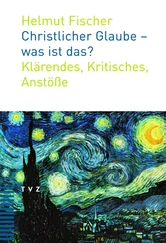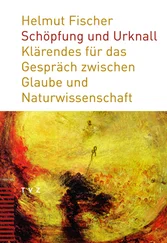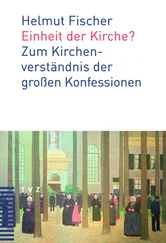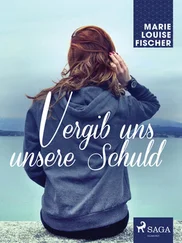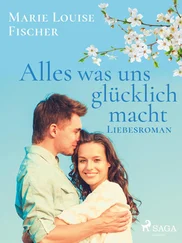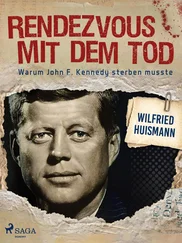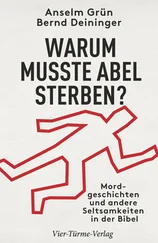Jesus war durch die jüdische Tempelpolizei im Schutz der Nacht festgenommen worden. Man wollte öffentliches Aufsehen vermeiden. Ein Anhänger Jesu scheint dabei eine Rolle gespielt und die Tempelpolizei zum Aufenthaltsort Jesu geführt zu haben. Die übrigen Jünger flohen aus Angst vor Verfolgung in ihre galiläische Heimat. Nur wenige Frauen blieben in Jerusalem zurück. Ob ein Prozess vor dem Hohen Rat in der gleichen Nacht in der Weise stattgefunden hat, wie es im Markusevangelium (14,54–65) zu lesen ist, ist eher unwahrscheinlich. Ein ordentlicher Prozess war es wohl nicht. Nach der damaligen Prozessordnung durften Prozesse, in denen es um ein todeswürdiges Verbrechen ging, nur am Tag stattfinden. Hier wurde aber nachts verhandelt. Gerichtsverhandlungen durften grundsätzlich nicht am Sabbat, an Festtagen und an den vorausgehenden Rüsttagen abgehalten werden. Der geschilderte Prozess soll aber in der Passanacht stattgefunden haben. Ein Todesurteil durfte nicht innerhalb der Sitzung des ersten Verhandlungstages gefällt werden. Es durfte erst am folgenden Tag in einer neuen Sitzung ausgesprochen werden. Als regulärer Versammlungsort war die Quaderhalle innerhalb des Tempels vorgesehen, die freilich nachts nicht zugänglich war. Der Hohe Rat war aber für die Verhandlung im Palast des Hohen Priesters zusammengekommen. Diese Widersprüche zum damals geltenden Prozessrecht sprechen dafür, dass es einen regulären Prozess des Hohen Rates gegen Jesus gar nicht gegeben hat. Es handelte sich wohl nur um ein Verhör, in dem jene Anklagepunkte ermittelt wurden, die der Hohe Rat der römischen Justiz als plausibel und vertretbar vortragen konnte.
|15| Der Hohe Rat braucht gerichtsverwertbare Anklagepunkte
Was war für die römische Justiz, welche die Rechtshoheit besaß, in einem Prozess gegen Jesus verwertbar und was nicht? Unbrauchbar war jedenfalls alles, was innerjüdische Konflikte betraf, z. B. Verstöße gegen Regeln oder Ordnungen der jüdischen Religion, Kritik am Tempel, der Vorwurf falscher Prophetie oder der Gotteslästerung. In solche innerjüdische Angelegenheiten mischten sich die Römer nicht ein.
Jesus musste also so dargestellt werden, dass er aus der Sicht der römischen Behörde als politischer Unruhestifter und Aufrührer und damit als eine Gefahr für die öffentliche Ordnung erschien. Der Hohe Rat wollte vor allem die für ihn bedrohliche Tempelkritik Jesu unterbinden. Diese konnte von den Römern so interpretiert werden, dass sie als Ruhestörung der öffentlichen Ordnung erschien. Und wenn Jesus von der anbrechenden Königsherrschaft und vom Reich Gottes öffentlich sprach, so sprach er zwar von dem Leben, das da entsteht, wo nicht Regeln und Gesetze, sondern Gottes Geist der Liebe die Herzen der Menschen erfüllt und ihr Handeln leitet. Aber die Stichwörter »Herrschaft«, »Reich« und »König« konnten den Römern leicht als politischer Anspruch und als politisches Umsturzprogramm und damit als ihren Zuständigkeitsbereich vermittelt werden.
Die römische Justiz handelt
Im Sinne dieser politischen Anklagen scheint dann auch der Prozess Jesu abgelaufen zu sein, nämlich im Stil einer dringenden römischen Polizeimaßnahme gegen einen gefährlichen |16| Aufrührer. Für einen ordentlichen römischen Strafprozess waren eine schriftliche Vorladung, ein Verteidiger und ein Protokollant erforderlich. Davon hören wir aber nichts. Es war also ein »kurzer Prozess«, wie er für kurzfristig zu klärende Notfälle vorgesehen war. Die Tafel, die über dem Kreuz Jesu angebracht wurde (der Titulus), verkündete das offiziell festgestellte strafwürdige Delikt. Es lautete: »Jesus Nazarenus Rex Judeorum« – »Jesus von Nazaret, König der Juden«. Wer unerlaubterweise den Königstitel führte, beging nach römischem Recht ein Majestätsverbrechen, das mit dem Tode bestraft wurde. Für Rom war dieser ganze Vorgang eine Routinebagatelle, mit der sich der Prokurator eines vermeintlichen politischen Aufrührers entledigte. Für die jüdische Priesterschaft war es nach Lage der Dinge die beste Lösung. Für die Jünger war es eine Katastrophe.
Hat Jesus seinen Tod erwartet?
Angesichts der Zwangsläufigkeit, mit der das Wirken Jesu und die Reaktionen der jüdischen Priesteraristokratie sowie der römischen Justiz zu Jesu Tod führten, kann man die Frage stellen, ob Jesus diesen Tod bewusst herbeizwingen wollte. Dafür gibt es aber keinerlei Anhaltspunkte.
Erwägenswert ist allerdings die Frage, ob Jesus mit seinem Tod rechnen konnte. Die Haltung der Tempelpriesterschaft konnte ihm ja nicht verborgen geblieben sein. Beim letzten Abendmahl sagte er nach dem Wort über Brot und Kelch: »Ich werde von der Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu dem Tag, da ich aufs Neue davon trinken werde im Reich Gottes.« (Mk 14,25) Danach jedenfalls |17| scheint er seine Situation realistisch eingeschätzt zu haben.
Deutlich ist schließlich, dass er in den Verhören durch den jüdischen Hohen Rat und durch Pilatus offenbar nichts getan hat, um die Anklage, er sei ein politischer Revolutionär, zu entkräften. Als er von Pilatus gefragt wurde: »Bist du der König der Juden?«, d. h. erhebst du den Anspruch, König der Juden zu sein (was Pilatus im politischen Sinne meinte), da sagte er unumwunden »Ja« und verstand das in seinem Sinne der Königsherrschaft Gottes, die er ja stets verkündet hatte. Er äußerte sich auch zu den anderen Anklagen nicht, die gegen ihn vorgebracht wurden. Wir wissen nicht, wie historisch zuverlässig diese Verhörszenen dargestellt sind. Sie entsprechen aber sehr genau der Haltung eines aus dem Geiste Gottes Handelnden, die Paulus mit dem weisheitlichen Satz umschreibt: »Lass dich vom Bösen (in der Gestalt des Verfolgers) nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute.« (Röm 12,21), nämlich mit jenem Geist der Liebe, die auch den Feind einschließt.
Das Todesurteil sollte unverzüglich vollstreckt werden, und zwar durch Kreuzigung, jene besonders abschreckende und entehrende Todesart, bei der der Todeskampf oft mehrere Tage dauern konnte, bis schließlich Lähmungserscheinungen und Herzversagen der Qual ein Ende bereiteten.
Geißelung und Verspottung gehörten zum Ritual der Kreuzigung. Der Leichnam blieb am Kreuz hängen. Er war |18| selbst in seiner Qual den Menschen zu Spott und Verachtung und den Vögeln zum Fraß freigegeben.
Die Hinrichtungsstätte Golgota lag nordwestlich außerhalb der Jerusalemer Stadtmauern auf einer Felskuppe. Jesus wurde hier um die Mittagszeit gekreuzigt. Er verstarb ungewöhnlich rasch bereits nach drei Stunden mit einem lauten Schrei (Mk 15,37). Jünger, die »letzte Worte« hätten hören können, waren nicht anwesend. Einige galiläische Frauen (unter ihnen Maria von Magdala) standen in der Nähe. Nicht mehr zu klären ist, ob die Geschichte, nach der Josef von Arimatäa den Leichnam von Pilatus erwarb und ihn noch am Abend in seinem eigenen neuen Felsengrab bestattete (Mk 15,42–45), einen historischen Kern hat.
Die Frage nach der Schuld am Tod Jesu, die in der Geschichte zwischen Juden und Christen eine so verhängnisvolle Rolle gespielt hat, lässt sich sinnvoll gar nicht stellen und noch weniger beantworten. Feststellbar ist lediglich, dass Jesu Botschaft und Verhalten beim Volk, bei den jüdischen Religionsführern und bei der römischen Justiz Reaktionen auslösten, die unter den damaligen Gegebenheiten mit einer nachvollziehbaren Handlungslogik aller Beteiligten zu dem bekannten Ende geführt haben. Auf keinen Fall kann und durfte jemals aus den Reaktionen des damaligen jüdischen Rates eine Kollektivschuld des jüdischen Volks am Tod Jesu hergeleitet und als Vorwand für judenfeindliche Aktionen missbraucht werden. Die Frage nach den Schuldanteilen an Jesu Tod hat allerdings bereits die biblischen Texte beschäftigt und geprägt. Erkennbar ist |19| dort eine zunehmende Tendenz, die Verantwortung für den Tod Jesu von der römischen Besatzungsmacht auf den Hohen Rat der Juden zu verlagern.
Читать дальше