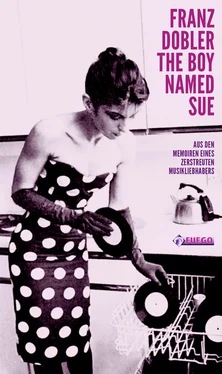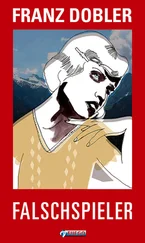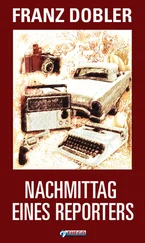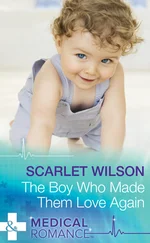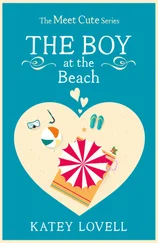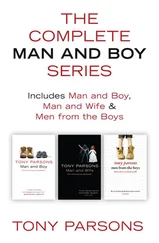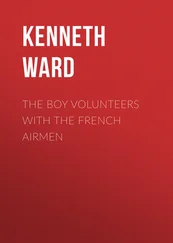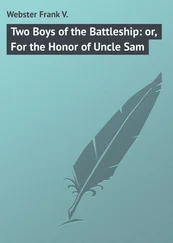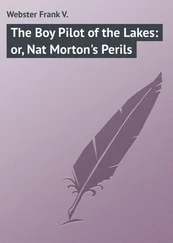»Bleib auf deinem Platz«, sagte sie beruhigend. »Er glaubt, du tust mir was, aber er tut dir nichts.«
Als sie sich den Höhepunkt endlich erarbeitet hatten, stöhnte sie laut. Und der kleine Vierbeiner bellte. Und dann kämpften sie darum, wer seinen Kopf zwischen ihre riesigen Brüste legen durfte.
Nur die Hunde werden gewinnen, dachte er, als er zur Geisterstunde schon wieder allein war.
Aus: Letzte Stories. Blumenbar, Berlin 2010
BEETHOVEN IN ANDERTHALB MINUTEN
Sind die ungeschriebenen nicht die schönsten Gesetze? Stimmt es, dass die weißen Kinder der oberen Unter- und der unteren Mittelschicht sich für ihre Musikrevolten möglichst arm kleiden, tatsächlich arme Kinder jedoch so schick wie’s nur geht, um nicht arm zu erscheinen? Entwickelt sich das Gehirn wirklich weiter bis zum Tod?
Und was ist mit diesem ungeschriebenen Gesetz: Wenn die Produktionen zu aufgeblasen werden und die Musiker so aufgeblasen wie die Produktionen und die Menschen nichts mehr hören außer dieses aufgeblasene Zeug, dann betreten davon genervte und gern in Lederjacken oder auch in Holzfällerhemden gekleidete junge Leute die Szene, die nicht so spielen, als hätten sie ein paar Jahre im Übungsraum geübt, und was sie singen, erzählt ebenfalls vom Ankotzen. Manche von ihnen bekommen dann geschäftliche Probleme, weil sie es mit erfahrenen älteren Managern und Musikindustriellen zu tun haben, die bei Sonnenaufgang Konzepte, Verträge und Branchenberichte studieren, während die bösen jungen Musiker bei Sonnenaufgang immer noch einen drauf machen.
Einmal in jedem Jahrzehnt schlägt die Glocke zu einer neuen Musikbewegung, heißt es. In diesen immer auch vernebelten Vorgang hat niemand so intelligent Klarheit gebracht wie Rick Davies von Supertramp: »Ich könnte nie Grunge, Rap oder Free Jazz spielen, für mich ist das alles Krach mit überhaupt keinem Ausdruck drin.«
Am 16. August 1974 gaben die Ramones ihr Debüt im CBGBs »einer heruntergekommenen Bar in der Bowery Street, die bald darauf zum Synonym für das explosionsartige Auftreten neuer Musik in New York City werden sollte«, mit der »winzigen Bühne und den sagenhaft stinkenden Toiletten«, schreibt Everett True. Tommy Ramone fand es »sehr gemütlich. Es gab einen kleinen Buchladen, wo man während des Soundchecks stöbern konnte. Anfangs gingen wenige Leute dorthin. Ich glaube, die Hell’s Angels hingen vor uns dort rum. Die örtlichen Marines kamen vorbei. Es gab einen Billardtisch.«
Marc sagte über dieses Konzert: »Es war die nackteste Variante von Rockmusik, die ich je gehört hatte.« Hilly sah es so: »Der Auftritt dauerte 40 Minuten, und 20 davon bestanden darin, dass die Bandmitglieder sich gegenseitig anschrien.« Und Valentine brachte es auf diesen Punkt: »Bis ich die Ramones sah, dachte ich, die New York Dolls wären die lauteste Band aller Zeiten. Sie waren fantastisch, 20 Songs in 15 Minuten. Da war dieser stillschweigende Ansatz von Gewalt im Hintergrund, aber auf der Bühne waren sie sehr lustig«, und »obwohl es unterschiedliche Lieder waren, klangen sie alle gleich – es war wie Beethoven in anderthalb Minuten, mit Joey Ramone, der darüber hinweg murmelte.«
Verständlich, dass die Ramones, Richard Hell oder die New York Dolls, die Malcolm McLaren kurz vor Erfindung der Sex Pistols gemanaged hatte, sauer auf London waren, auf diese Sex Pistols und alle diese Pisser, die plötzlich da waren und in den Weltnachrichten als das neue Ding beachtet wurden. Niemand von den New Yorkern sollte jemals auch nur annähernd diese Aufmerksamkeit bekommen. Außer Patti Smith natürlich. Die mit Andy Warhol schon Punk gespielt hatte, als Rimbaud noch Gedichte schrieb.
Aus: Rock’n’Roll Fever (mit Guido Sieber).
Edel, Hamburg 2010
LIEDER FÜR KUGELN UND FREIHEIT
In einem Schongauer Café bekamen wir die richtigen Gefühle für das Konzert, genauer gesagt die »Kalahari Liberation Opera« von Abdullah Ibrahim, der früher Dollar Brand hieß. In einem Lesezirkel fand sich die von verschiedenen südafrikanischen Botschaften herausgegebene Zeitschrift Südafrikanisches Panorama. Mit vielen Photos von der heilen weißen Welt, ohne die Probleme zu verschleiern: »Die Weiterentwicklung der menschlichen Zivilisation wurde ermöglicht, weil die Natur flexibel genug war, sich der veränderten Umwelt anzupassen. Dieser Anpassung sind jedoch Grenzen gesetzt, und heute ist Umweltschutz unumgänglich, wenn die Menschheit überleben will.«
Ibrahims Jazz-Oper schildert die Geschichte des Landes. Eine kurze Einleitung deutet den Charakter des Werks an: Behelmte Polizisten prügeln mit Gewehren auf einen Schwarzen und ihm zu Hilfe kommende Frauen ein. Erst danach kommt der Rückblick auf das »ancient Africa«. Die Zeit der Jäger und Sammler gerät insofern zur Idylle, als zwei Szenen später ein mit Gewehr bewaffneter Weißer sich von Ureinwohnern herumtragen lässt, wobei er den wirtschaftlich sehr weisen (und weißen) Gedanken hat, eine Erfrischungsstation zu errichten (1652 gründeten holländische Seefahrer an der Stelle des heutigen Kapstadt eine Handelsniederlassung und setzten damit den Beginn des schwarzen afrikanischen Elends). »Die Auseinandersetzung mit den Eingeborenen gestaltete sich einfach im Fall der Buschleute … man rottete sie aus«, schrieb 1941 ein deutscher Forscher. Die wenigen überlebenden Buschleute zogen sich in die unwegsame Beckenlandschaft Kalahari zurück.
Eine turbulente Karnevalszene soll zeigen, dass sich die Lebensfreude der Schwarzen dennoch lange Zeit nicht zerstören ließ. Erst das faschistische System der Apartheid begann mit letzter mörderischer Konsequenz die totale Unterdrückung der Schwarzen durchzusetzen, dargestellt in einer Vertreibungsszene mit schauderhaft überzeugendem Klagegesang. Historischer Hintergrund sind die Zwangsumsiedlungen, die das weiße Apartheid-Regime ab den 50er-Jahren zur Durchsetzung seiner Homeland-Politik durchführte, die zum Ziel hatte: die Schwarzen in einem Gebiet einzusperren, aus dem nur zur Arbeit benötigte Personen rauskommen. 80% der Bevölkerung werden gezwungen, auf einer Fläche von 14% des Landes zu leben, die zudem ausschließlich zu den am wenigsten fruchtbaren Gebieten gehören.
Im zweiten Teil des Werks wird der African National Congress (ANC) vorgestellt. Dieser Teil ist eine Hymne auf den ANC und seine politischen Ziele und Arbeitsweisen, die nur verständlich sind, wenn man die Hintergründe kennt: 1910 gegründet, wandelte sich die gewaltfreie Haltung der Organisation zu Beginn der 60er-Jahre in eine militante, nachdem die gewaltfreien Aktionen keinen Erfolg gegen die Unterdrückung gehabt hatten. Nelson Mandela wird mehrmals erwähnt. Er war bis zu seiner Inhaftierung 1962 der populärste und wichtigste ANC-Politiker.
Hauptperson dieses zweiten Akts ist ein junger Schwarzer, dessen 16-jährige Schwester bei einer Demonstration erschossen wurde und der durch die Rede des von Abdullah Ibrahim gespielten Predigers an ihrem Grab, die von den Zielen des ANC zur Befreiung des Volks handelt, zum Widerstandskämpfer wird. Die Problematik zeigt die folgende Szene: der junge Mann wird von einer Guerilla-Kämpferin auf der einen, von seiner Geliebten auf der anderen Seite an der Hand gehalten. Die Geliebte bricht nach seinem Entschluss weinend zusammen. Die Szene wirkt nicht im Geringsten klischeehaft, wenn man die südafrikanische Wirklichkeit bedenkt.
Es folgt die Schilderung seiner Ausbildung in einem ANC-Lager – mit Ibrahim als Karatekämpfer, eine sehr persönliche Szene, denn er ist tatsächlich ausgebildeter Karatekämpfer – und schließlich sein Tod bei einem Banküberfall. Sein Tod fällt mit einem Neubeginn zusammen: ein politisch unbedarfter schwarzer Bankangestellter, der schikaniert wird und mit seiner lakaienhaften Arbeit nicht mal das Existenzminimum verdient, findet ein ANC-Parteiprogramm, liest es und stößt – als Einziger, der die Kugeln der Polizei überlebt – mit erhobener Faust den Freiheitsruf »Armandla« aus.
Читать дальше