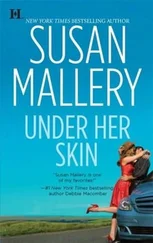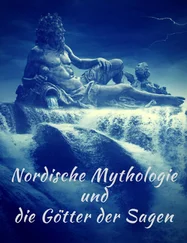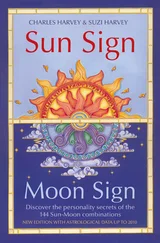Judith war wie elektrisiert. Einen Freispruch vom Vorwurf des Mordes hatte es zwar schon hin und wieder gegeben, aber sie selbst kannte so etwas nur vom Hörensagen. Wie würde er ausgehen, der Streit der Gutachter? Musste die Wissenschaft, die Volker Schmidt hinter Gitter gebracht hatte, auch für seine Rehabilitierung sorgen? So ohne Weiteres würde die Staatsanwaltschaft sicher nicht mitspielen. Mergentheim war optimistisch: „Wenn einer fair spielt, dann ist es Lachmann.“
„Sind Sie da so sicher?“
„Warten wir’s ab. Außerdem bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Lesen Sie nur, was die Steiner-Wiesemann schreibt. Sie wirft dem Mundt klipp und klar vor, unwissenschaftlich gearbeitet zu haben. Ihr Gutachten lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.“
„Ja, aber vielleicht will sie jetzt nur nicht klein beigeben, nachdem sie schon damals davon ausgegangen ist, dass die Beweise nicht ausreichen würden“, überlegte Judith immer noch skeptisch. Mergentheim schüttelte den Kopf: „Sie argumentiert absolut überzeugend und geht dabei Punkt für Punkt auf Mundts Ausführungen ein. Lesen Sie erst einmal selbst. Vorher ist jede Diskussion zwecklos. Möchten Sie noch einen Grappa?“
Judith stimmte immer noch gedankenverloren zu. Mergentheims Großzügigkeit kannte heute offenbar keine Grenzen. Pietro freute sich wie ein Stint, denn er präsentierte gern sein Grappa-Sortiment, das beachtlich war – legte man nicht gerade italienische Verhältnisse zugrunde. Mit jenem Lokal in den Ligurischen Bergen, in dem Judith einmal mit der vierzigfachen Spielart dieser Schnapssorte konfrontiert worden war, konnte er nicht konkurrieren. Das hätte sich einfach nicht rentiert. Pietros Meinung nach ließ die Ess- und Trinkkultur der Deutschen generell zu wünschen übrig. Sie hielten stur daran fest, die Spaghetti als Hauptgericht anzusehen und stopften ohne Unterlass Pizzen in sich hinein, als handele es sich um eine Küchenkreation von Lukull persönlich.
Es war schon beinahe Mitternacht, als Judith sich von Mergentheim verabschiedete. „Sie finden doch allein heim?“, fragte er erwartungsgemäß. Wie schön, immer wieder bestätigt zu bekommen, wie sehr man sich auf die eigene, vorgefasste Meinung verlassen konnte, dachte Judith selbstironisch, als sie durch die klare Herbstnacht nach Hause ging. Sie war kein bisschen müde und wusste ganz genau: Der Aktenordner unter ihrem Arm würde ihr eine lange Nacht bescheren.
Mao und Li wirkten wie der personifizierte Vorwurf. Sie saßen direkt vor der Korridortür, als Judith aufschloss und liefen maunzend von ihr weg – den Schwanz hoch erhoben nach dem Motto ‚du kannst uns mal‘. Als Judith sich im Schlafzimmer aus ihrem englischen Kaschmirkostüm schälte, um es sich im Bademantel bequem zu machen, blieben sie in einiger Entfernung erwartungsvoll sitzen, regungslos nebeneinander wie Statuen, die Schwänze artig um die Vorderpfoten gelegt. Jeder Handgriff, den der menschliche Hausgenosse tat, schien sie zu interessieren. Schließlich konnte man um diese Uhrzeit mit Fug und Recht erwarten, dass zum Dosenöffner gegriffen werde, statt unnütz herumzutändeln und sogar noch in den Spiegel zu schauen und durch die Haare zu bürsten. Endlich war es soweit. Es gab Kaninchen. Jedenfalls behauptete das der Hersteller auf dem Dosenetikett.
Während die Katzen in aller Ruhe fraßen – so, als hätten sie keine Sekunde auf ihr Futter warten müssen – köpfte Judith kurz entschlossen die letzte Flasche Champagner, die sie noch im Kühlschrank hatte. Morgen würde sie diesen alkoholischen Leichtsinn sicher bitter bereuen. Aber heute war heute – und außerdem musste sie ja nicht alles austrinken. Am liebsten hätte sie jemanden angerufen, um mit ihm die aufregende Wende durchzudiskutieren – Helga beispielsweise – aber dafür war es inzwischen doch zu spät geworden.
So kuschelte sie sich mit ihrem Aktenordner in den Korbsessel, legte – der besinnlichen Stunde angemessen – Vivaldis ‚La Stravaganza‘ auf den Plattenspieler und goss den Champagner in ein Wasserglas, um sich später das aufwendige Auswaschen ihrer absolut spülmaschinenungeeigneten Sektflöten zu ersparen. So gerüstet machte sie sich über die Ausführungen der Spurenkundlerin Dr. Erika Steiner-Wiesemann her. Sie waren nicht nur einleuchtend, wie Dr. Mergentheim prophezeit hatte, sondern auch ausgesprochen leicht lesbar – geschrieben ohne den üblichen Wust fachspezifischen Brimboriums, hinter dem Wissenschaftler so gern ihre Erkenntnisse vor Laien zu verbergen pflegen. Als sie sich durchgearbeitet hatte war es
2.30 Uhr, der Aschenbecher ziemlich voll und die Champagnerflasche beachtlich leer. Judith warf einen neidischen Blick auf die schlafenden Katzen und begab sich zu Bett. Morgen würde sie ein wenig länger schlafen. Sie wollte ausnahmsweise nicht um 9 Uhr ins Gericht gehen, sondern sich zum Redaktionsbeginn um 11 Uhr gleich auf die Auswertung der Ergebnisse ihres nächtlichen Einsatzes stürzen. Ihr Exklusivbericht würde Furore machen und eine Menge Staub aufwirbeln. Allerdings musste sie ihn vorher mit dem Chefredakteur besprechen. An Rufius’ Zustimmung bestand jedoch keinerlei Zweifel. Judith hatte einen guten Ruf. Man vertraute ihr. Im Traum erlebte sie, wie er ihr eine Gehaltserhöhung anbot, während sie das Blumengebinde des dankbaren, freigesprochenen Volker Schmidt in der Vase arrangierte. Die Welt war in Ordnung – sogar im Schlaf. Jedenfalls sah es damals so aus.
Erwartungsgemäß fühlte sich Judith am nächsten Morgen wie gerädert. Aus Erfahrung wusste sie, dass dieser Zustand mindestens bis nach dem Mittagessen andauern würde. Zu viel Alkohol, zu wenig Schlaf – eine nicht gerade bekömmliche Mischung. Immerhin: Es war ihr schon mal weit schlechter gegangen. Von diesem schwachen Trost motiviert, erledigte sie rasch ihre morgendlichen Rituale: Katzenfüttern, Duschen, Anziehen, Schminken. Das Blumengießen pflegte sie meistens auf den Abend zu verlegen. Fürs Frühstück nahm sie sich Zeit. Judith war wirklich alles andere als ein Frühstücksmuffel. So schlecht konnte es ihr einfach gar nicht gehen, dass ihr Toast, Ei, Käse und Wurst nicht schmeckten. Robert, der sich selbst als frankophil bezeichnete und seine Vorliebe auch auf die etwas spärlichere, französische Art zu frühstücken ausdehnte, pflegte Judiths Gewohnheit als teutonische Fressorgie zu bezeichnen. Was daran typisch deutsch sein sollte, leuchtete Judith ganz und gar nicht ein. In England hatte sie schon einmal begeistert ein Yorkshire-Frühstück mit Würstchen, Panhas und Bratkartoffeln verdrückt, in Israel mundeten ihr Eiersalat und Rollmöpse ausgezeichnet und in Rumänien war ihr zu Brot, Schinken und Tomaten sogar Schnaps kredenzt worden. Die einzigen Nahrungsmittel, die ihr als Grundlage für einen langen Tag unvorstellbar erschienen waren Marmelade, Quark und Honig, oder – noch schlimmer – Müsli.
Gestärkt vermochte sie auch dem letzten, prüfenden Blick in den Spiegel standzuhalten. Entsetzlich: Ihr jungenhaft kurz geschnittenes Haar, das sie täglich sorgfältig wusch und föhnte, sah heute nicht gerade nach einer flotten Frisur aus und ihre Augen waren gerötet wie die eines Myxomatose kranken Kaninchens. Was soll’s? Sie sprühte sich mit ihrem Lieblingsparfum ein und blinzelte den Katzen zu: Nobody is perfect. Schon seit Langem hatte sie sich vorgenommen, einen Aufkleber mit diesem Spruch für ihren Badezimmerspiegel zu besorgen.
Um die Redaktion zu erreichen, brauchte sie nur über die Straße zu gehen. Die Kollegen, sofern sie nicht zu Terminen aufgebrochen waren, lümmelten sich an den Schreibtischen und lasen Zeitung. „Na, wie geht’s?“, erkundigte sich Helga. „Die pharmazeutische und die kosmetische Industrie halten mich aufrecht“, antwortete Judith.
Das war nur die halbe Wahrheit, denn der größte Muntermacher war der Artikel, den sie schon halb formuliert im Kopf hatte. So griff sie denn auch – während sich Helga noch über die Segnungen von Aspirin für ihr nicht gerade selten alkoholbelastetes Dasein ausließ – bereits zum Telefonhörer und bat um ein Gespräch mit Wolfgang Rufius. „Am besten, Sie kommen gleich rauf, Frau Faßberg“, meinte seine Sekretärin, „er ist in seinem Zimmer und liest Zeitungen.“
Читать дальше